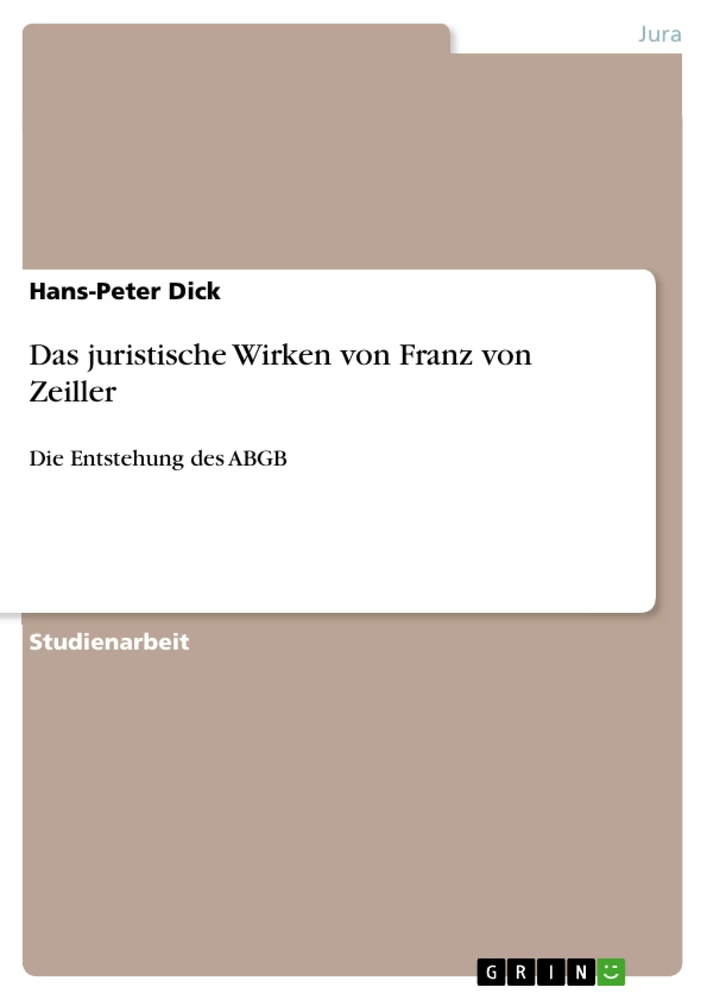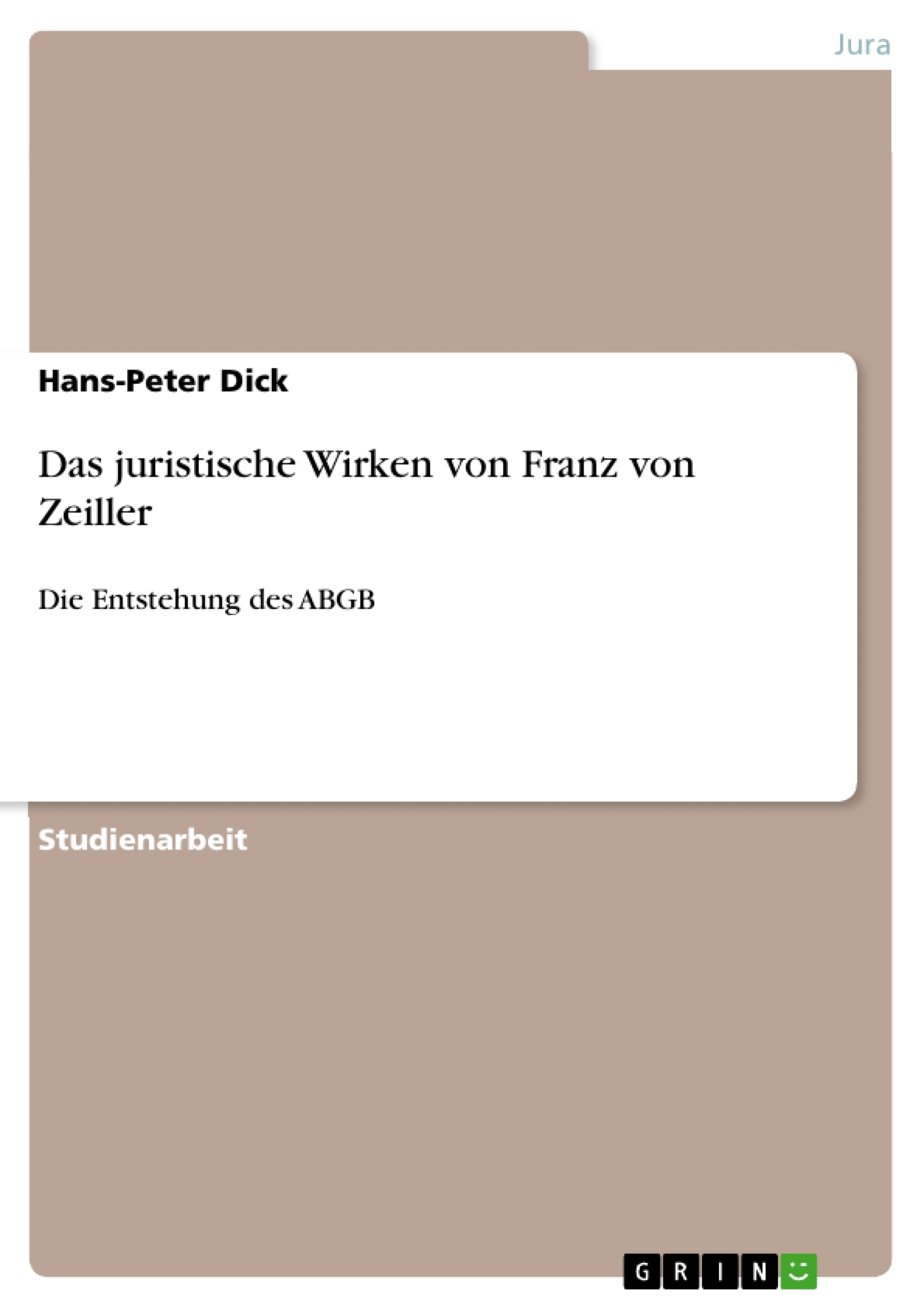In der Zeit der Aufklärung entstanden die drei großen klassischen Kodifikationen des Zivilrechts, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811/1812, das Allgemeine Landrecht von 1794 und der Code Civil von 1804.
Aufbauend auf den "Urentwurf" zum ABGB von Martini, der sich noch im Geist der Aufklärung entwickeln konnte, war es Zeiller trotz eines mittlerweile reaktionären Umfeldes möglich, ein revolutionäres Gesetzeswerk zu finalisieren, das mit 1.1.1812 in Kraft gesetzt wurde und in seinem Kern bis heute Gültigkeit hat.
Mit diesem reinen Zivilgesetzbuch wurde die bis dahin übliche Gelegenheitsgesetzgebung von einer planvollen Gesetzgebung abgelöst.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA
- II. SCHWERPUNKTERÖRTERUNG
- A. GESELLSCHAFTSPOLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
- B. DIE ÖSTERREICHISCHE NATURRECHTSSCHULE
- C. DIE ENTWICKLUNG DES ABGB
- 1. Von Martini zu Zeiller
- 2. Die Arbeit Zeillers
- a. Ausgangspunkt
- b. Philosophische Einflüsse auf das ABGB
- 3. Einige wesentliche Aspekte des ABGB
- a. Trennung von Zivil- und öffentlichem Recht
- b. Architektur des Rechts
- c. Die Trennung von Recht und Moral
- d. Die Freiheit des Individuums
- e. Persönlichkeitsschutz
- f. Der kategorische Imperativ
- g. Eigentumsrecht
- h. Der Gültigkeitsbereich
- 4. Ansatzpunkte für Kritik
- a. Geschlechterverhältnisse
- b. Arrangement mit dem Ancien Régime
- 5. Die kontroversielle Diskussion in Österreich
- III. ZUSAMMENFASSUNG DER GEWONNENEN ERKENNTNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem juristischen Wirken von Franz von Zeiller, einem bedeutenden österreichischen Juristen des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen seiner Zeit.
- Die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Zeit, in der Zeiller wirkte, insbesondere der aufgeklärte Absolutismus und die Ideen der Aufklärung.
- Die Entwicklung des ABGB und die Rolle von Franz von Zeiller in diesem Prozess, insbesondere seine Auseinandersetzung mit der österreichischen Naturrechtsschule und den philosophischen Einflüssen von Immanuel Kant.
- Wesentliche Aspekte des ABGB, wie die Trennung von Zivil- und öffentlichem Recht, die Architektur des Rechts, die Trennung von Recht und Moral, die Freiheit des Individuums und der Persönlichkeitsschutz.
- Kritikpunkte am ABGB, insbesondere die Geschlechterverhältnisse und das Arrangement mit dem Ancien Régime.
- Die kontroversielle Diskussion über die Bedeutung und das Werk von Franz von Zeiller in Österreich.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und stellt Franz von Zeiller als bedeutenden Juristen seiner Zeit vor. Es beleuchtet seine Karriere und seine Rolle in der Entwicklung des ABGB. Das zweite Kapitel analysiert die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die die Entstehung des ABGB prägten. Es beleuchtet den aufgeklärten Absolutismus und die Ideen der Aufklärung, die in dieser Zeit Verbreitung fanden. Das dritte Kapitel widmet sich der österreichischen Naturrechtsschule und beleuchtet die Entwicklung des ABGB im Kontext dieser Strömung. Es untersucht die Rolle von Zeiller als Nachfolger von Karl Anton von Martini und die philosophischen Einflüsse von Immanuel Kant auf seine Arbeit. Das vierte Kapitel analysiert einige wesentliche Aspekte des ABGB, wie die Trennung von Zivil- und öffentlichem Recht, die Architektur des Rechts und die Trennung von Recht und Moral. Es betrachtet auch die Betonung der Freiheit des Individuums und des Persönlichkeitsschutzes im ABGB.
Schlüsselwörter
Franz von Zeiller, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), österreichische Naturrechtsschule, Immanuel Kant, aufgeklärter Absolutismus, Aufklärung, Trennung von Recht und Moral, Freiheit des Individuums, Persönlichkeitsschutz, Kritik am ABGB.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Franz von Zeiller?
Zeiller war ein bedeutender österreichischer Jurist, der maßgeblich an der Fertigstellung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) von 1811 beteiligt war.
Welche philosophischen Einflüsse prägten das ABGB?
Das ABGB ist stark vom Geist der Aufklärung und insbesondere von der Moralphilosophie Immanuel Kants und dem kategorischen Imperativ beeinflusst.
Was ist das Besondere am ABGB von 1811?
Es war ein revolutionäres Gesetzeswerk, das die Freiheit des Individuums, den Persönlichkeitsschutz und die Trennung von Recht und Moral betonte.
Was kritisiert die Arbeit am Werk Zeillers?
Kritikpunkte sind die damaligen Geschlechterverhältnisse und das notwendige Arrangement des Gesetzbuches mit dem bestehenden absolutistischen Ancien Régime.
Gilt das ABGB heute noch?
Ja, in seinem Kern hat das ABGB in Österreich bis heute Gültigkeit, auch wenn es vielfach novelliert wurde.
- Arbeit zitieren
- Hans-Peter Dick (Autor:in), 2011, Das juristische Wirken von Franz von Zeiller, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414002