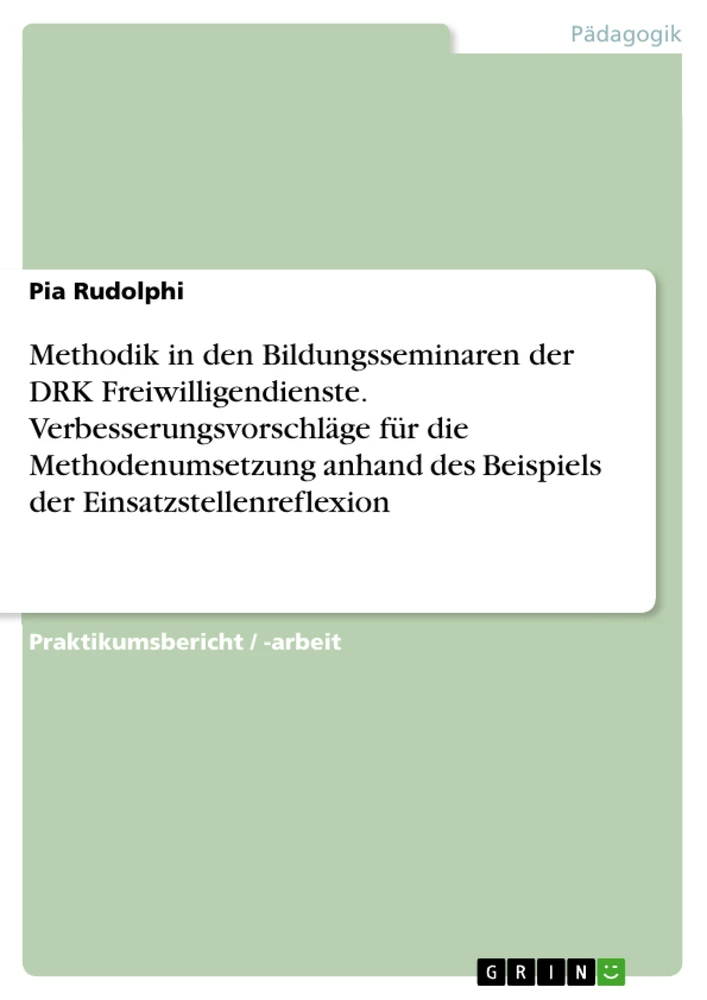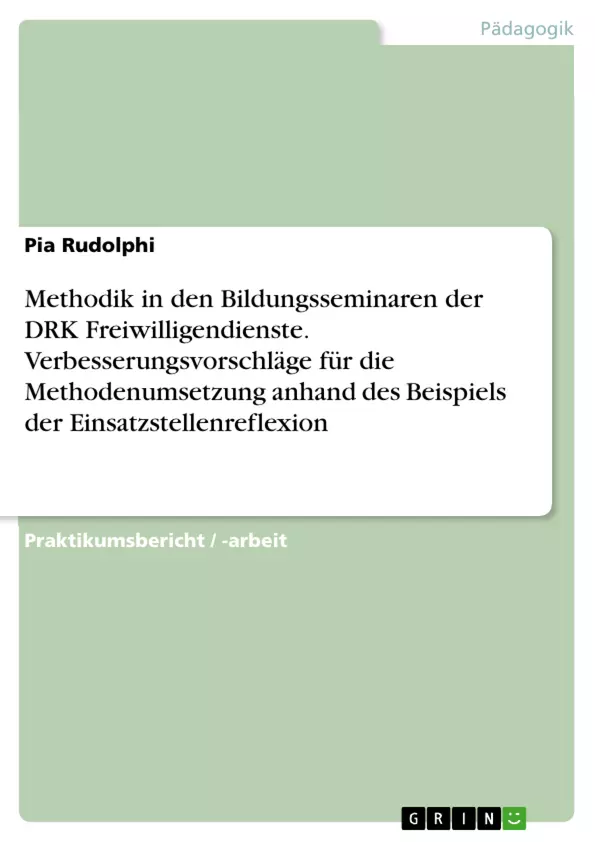In der vorliegenden Praxisreflexion wird meine Tätigkeit als pädagogische Honorarkraft beim Deutschen Roten Kreuz im Bereich der Freiwilligendienste dargestellt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Auseinandersetzung meiner dortigen Praxiserfahrung bzgl. der Thematik des Methodenbewusstseins und den damit einhergehenden möglichen Defiziten meiner Methodenumsetzung.
Im Laufe meines Studiums konnte ich bereits diverse pädagogische Erfahrungen sammeln. Mein Eignungspraktikum absolvierte ich an einer Förderschule, wodurch ich mit einer weiteren Einrichtung im Förderbereich in Kontakt kam, an welcher ich drei Jahre tätig war. Dabei handelte es sich um eine Offene Ganztagsschule, deren SchülerInnen diverse Förderbedarfe, sowohl psychisch als auch physisch, aufwiesen. Meine Motivation für sowohl das Praktikum als auch die berufliche Tätigkeit gründete sich einerseits auf dem Interesse der Inklusionsthematik. Andererseits auf „dem Blick über den Tellerrand“.
Es ist mir wichtig, während meines Studiums – neben der grundlegenden Theorie – einen weit gefächerten Blick auf das Feld der „Institution Schule“ als auch auf den Bereich des „Lernens“ zu bekommen. Dazu trägt auch meine Wahrnehmung der Ausbildung der SchülerInnen bei. Diese scheint größtenteils nur auf Funktionalität und „die möglichst nahtlose Einpassung Jugendlicher in ein gewöhnlich fremdbestimmtes Arbeitsleben“ ausgelegt zu sein. Hintergrund meines Interesses in dem Bereich der Freiwilligendienste auf Bildungsseminaren tätig zu sein war und ist die Arbeit mit jungen Erwachsenen losgelöst vom Kontext „Schule“. Für mich eröffnen sich dadurch neue Erfahrungen und Erkenntnisse – z.B. über die Thematik des Lernens. Die neuen Erfahrungen beziehen sich z.B. auf die Gruppendynamik in einem neuen Kontext. Die neuen Erkenntnisse bzgl. der Thematik des Lernens erwarb ich durch die Anwendung von Reflexionsmethoden. Während „Lernen“. im Kontext Schule vor allem als Wissenserwerb aufgefasst wird, liegt der Schwerpunkt von Reflexionsmethoden auf dem „Lernen […], welches Verhalten signifikant beeinflußt“. Ich konnte mir einen Eindruck von der Bereicherung für die Freiwilligen durch diese Art des Lernens verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Praktikumseinrichtung
- 2.1 DRK Freiwilligendienste
- 3. Methode
- 3.1 Einsatzstellenreflexion
- 3.2 Analyse der Methodenumsetzung
- 3.3 Verbesserungsvorschläge
- 4. Persönliche Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Praxisreflexion untersucht die Methodenumsetzung in Bildungsseminaren der DRK Freiwilligendienste, insbesondere die Einsatzstellenreflexion. Ziel ist die Identifizierung möglicher Defizite und die Formulierung von Verbesserungsvorschlägen für die zukünftige Anwendung von Reflexionsmethoden. Die Arbeit basiert auf den Praxiserfahrungen der Autorin als pädagogische Honorarkraft.
- Methodenbewusstsein und dessen Umsetzung in der Praxis
- Analyse der Reflexionsmethode "Wegemännchen"
- Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Reflexionsmethoden
- Der Einfluss von Reflexionsmethoden auf das Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung von Freiwilligen
- Die Rolle der pädagogischen Begleitung im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Tätigkeit der Autorin als pädagogische Honorarkraft beim DRK und den Schwerpunkt der Arbeit: die Auseinandersetzung mit dem Methodenbewusstsein und möglichen Defiziten in der Methodenumsetzung. Sie erläutert ihren bisherigen pädagogischen Hintergrund, ihr Interesse an Inklusion und die Motivation für die Tätigkeit im Bereich der Freiwilligendienste. Ein wichtiger Aspekt ist die Auseinandersetzung mit dem Verständnis von "Lernen" im schulischen und im Kontext der Freiwilligendienste. Die Autorin hebt die Bedeutung adäquater Anwendung von Reflexionsmethoden hervor und führt in das zentrale Problem der Arbeit ein: die fehlende strikte Regelung der Methodenumsetzung bei den Teamern.
2. Praktikumseinrichtung: Dieses Kapitel beschreibt die Institution der DRK Freiwilligendienste, den Kreisverband Münster und die Tätigkeit der Autorin als pädagogische Honorarkraft. Es erläutert die Ziele des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), die Vermittlung von berufsübergreifenden Qualifikationen und die Bedeutung der Begleitung der Freiwilligen durch pädagogische Hauptamtliche und Honorarkräfte. Die Rolle des DRK als Kooperationspartner zwischen Einsatzstellen und Freiwilligen wird hervorgehoben.
3. Methode: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einsatzstellenreflexion und der Analyse der Methodenumsetzung anhand des Beispiels der Reflexionsmethode "Wegemännchen". Es beinhaltet eine theoretische Auseinandersetzung mit der Einsatzstellenreflexion und deren vorgeschriebener Umsetzung. Die Autorin analysiert ihre eigene Umsetzung der Reflexionsmethode mithilfe von Brühwilers Aspekten für das Methodenbewusstsein und formuliert daraus Verbesserungsvorschläge für ihre zukünftige Methodenumsetzung.
Schlüsselwörter
DRK Freiwilligendienste, Bildungsseminare, Einsatzstellenreflexion, Methodenbewusstsein, Reflexionsmethoden, Wegemännchen, Pädagogische Begleitung, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Persönlichkeitsentwicklung, Methodenumsetzung, Verbesserungsvorschläge.
FAQ: Praxisreflexion der Methodenumsetzung in Bildungsseminaren der DRK Freiwilligendienste
Was ist der Gegenstand dieser Praxisreflexion?
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung von Reflexionsmethoden, insbesondere der Methode "Wegemännchen", in Bildungsseminaren der DRK Freiwilligendienste. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Defiziten und der Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für die pädagogische Praxis.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Reflexion basiert auf den Praxiserfahrungen der Autorin als pädagogische Honorarkraft. Die Analyse der Methodenumsetzung erfolgt unter Berücksichtigung von Brühwilers Aspekten für das Methodenbewusstsein. Die "Wegemännchen"-Methode dient als konkretes Beispiel für die Untersuchung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Reflexion?
Ziel ist die Verbesserung des Methodenbewusstseins und der Methodenumsetzung in der pädagogischen Arbeit mit Freiwilligen des DRK. Die Autorin möchte Defizite identifizieren und konkrete Verbesserungsvorschläge für die zukünftige Anwendung von Reflexionsmethoden formulieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Methodenbewusstsein, die Analyse der Reflexionsmethode "Wegemännchen", Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Reflexionsmethoden, den Einfluss von Reflexionsmethoden auf Lernen und Persönlichkeitsentwicklung der Freiwilligen sowie die Rolle der pädagogischen Begleitung im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).
Welche Institution steht im Mittelpunkt der Reflexion?
Die Praxisreflexion konzentriert sich auf die DRK Freiwilligendienste, insbesondere den Kreisverband Münster. Die Autorin beschreibt ihre Tätigkeit als pädagogische Honorarkraft und die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen und Einsatzstellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Praktikumseinrichtung (DRK Freiwilligendienste), ein Kapitel zur Methode (Einsatzstellenreflexion und Analyse der Methodenumsetzung), und eine persönliche Reflexion. Jedes Kapitel wird in der Arbeit ausführlich zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: DRK Freiwilligendienste, Bildungsseminare, Einsatzstellenreflexion, Methodenbewusstsein, Reflexionsmethoden, Wegemännchen, Pädagogische Begleitung, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Persönlichkeitsentwicklung, Methodenumsetzung, Verbesserungsvorschläge.
Was ist der Hintergrund der Autorin?
Die Autorin ist eine pädagogische Honorarkraft beim DRK mit Interesse an Inklusion. Sie beschreibt ihren pädagogischen Hintergrund und ihre Motivation für die Tätigkeit im Bereich der Freiwilligendienste. Ein wichtiger Aspekt ist ihre Auseinandersetzung mit dem Verständnis von "Lernen" im schulischen und im Kontext der Freiwilligendienste.
- Arbeit zitieren
- Pia Rudolphi (Autor:in), 2018, Methodik in den Bildungsseminaren der DRK Freiwilligendienste. Verbesserungsvorschläge für die Methodenumsetzung anhand des Beispiels der Einsatzstellenreflexion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414017