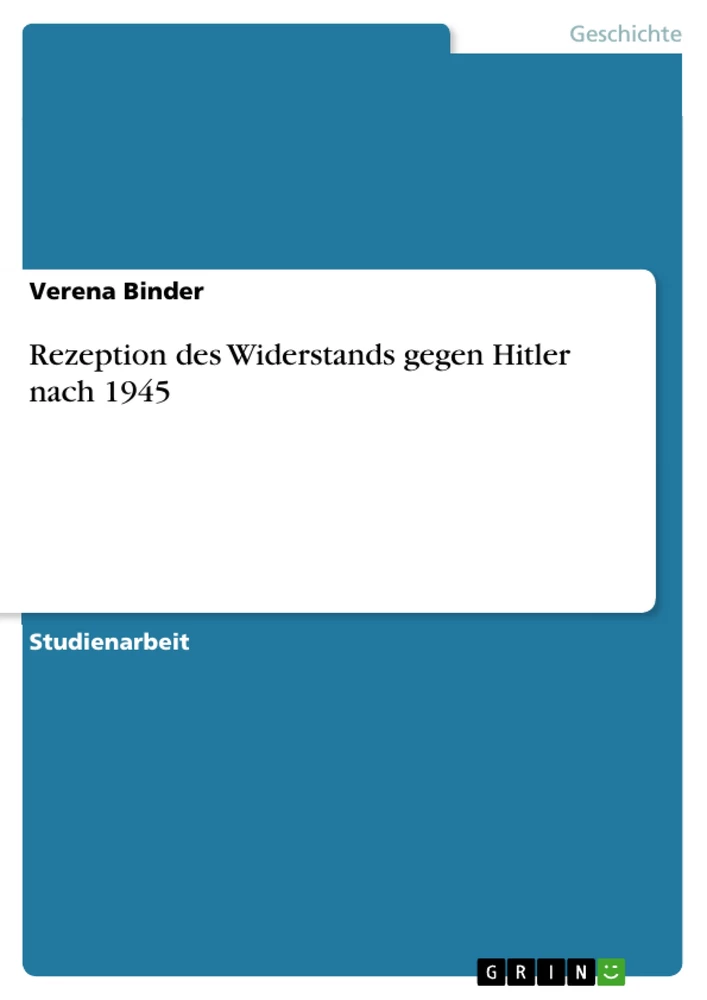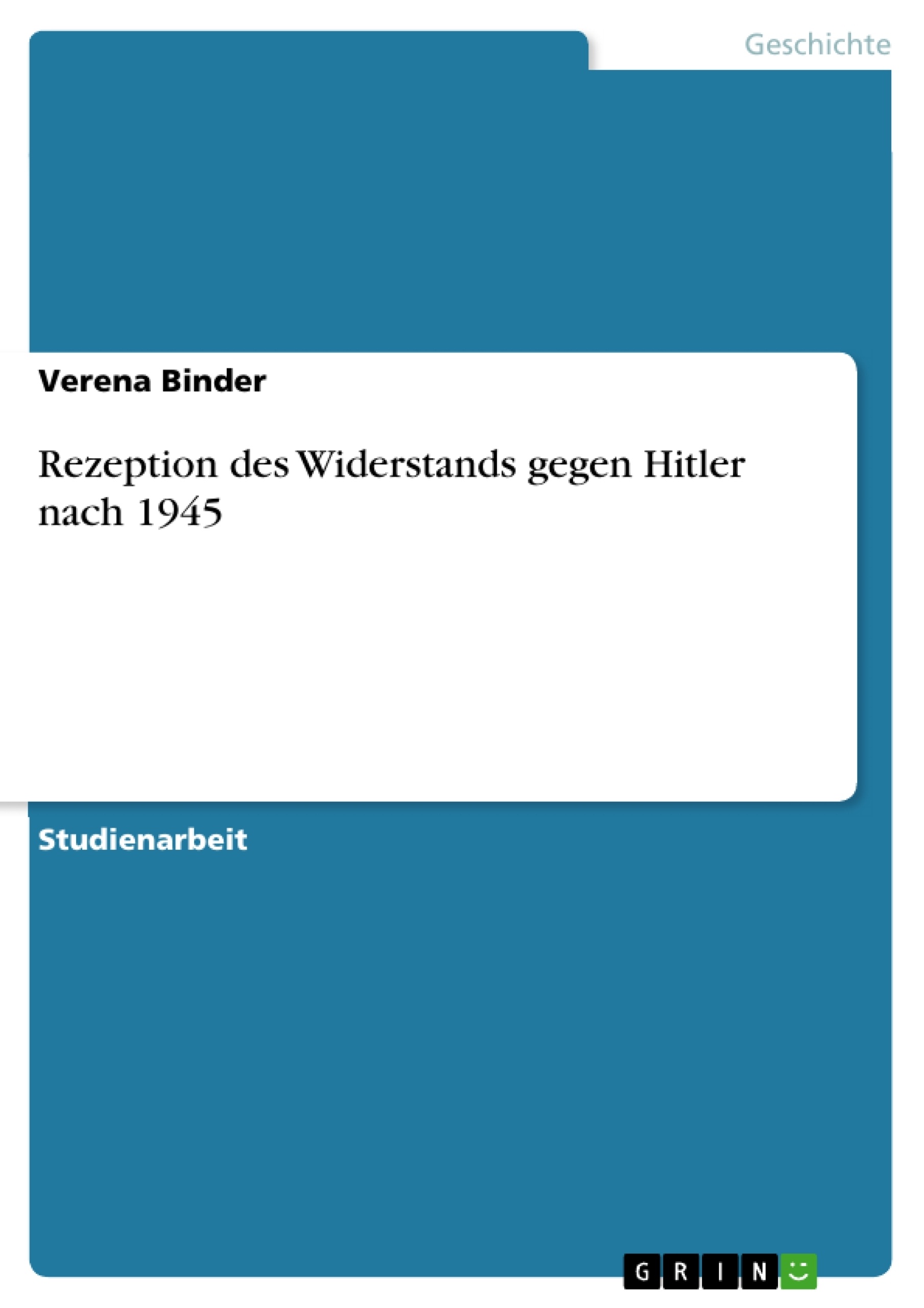Diese Arbeit handelt einem Referatskonzept mit dem Thema "Die Rezeption des Wiederstandes gegen Hitler nach 1945". Dabei betrachtet man späten vierziger Jahre bis heute.
Inhaltsverzeichnis
- Die späten vierziger Jahre
- Die fünfziger Jahre
- Auswahl von Bundeswehroffizieren
- Gedenktag 20. Juli
- Die sechziger Jahre
- Die siebziger Jahre
- Die achtziger Jahre
- Die neunziger Jahre
- Im 21. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption des Widerstandes gegen das NS-Regime in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Sie analysiert die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Instrumentalisierungen des Themas in verschiedenen Jahrzehnten und beleuchtet die damit verbundenen Kontroversen und Entwicklungen des kollektiven Gedächtnisses.
- Die politische Instrumentalisierung des Widerstandsgedenkens
- Die Entwicklung des Bildes vom Widerstand in der Öffentlichkeit
- Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen des Widerstands
- Der Einfluss des Kalten Krieges auf die Rezeption des Widerstands
- Die Rolle des 20. Juli 1944 im kollektiven Gedächtnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die späten vierziger Jahre: Die unmittelbare Nachkriegszeit war geprägt von der Notwendigkeit, die These einer Kollektivschuld der Deutschen zu widerlegen. Die Erinnerung an den Widerstand diente dabei als Beweis für den frühen Widerstand gegen das NS-Regime und als Impuls für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Gleichzeitig gab es erhebliche Vorbehalte gegenüber dem Widerstand, die von der Furcht vor einer neuen "Dolchstoßlegende" bis hin zur Sicht des Widerstands als Landesverrat reichten. Die Erinnerung war zunächst auf Angehörige und Freunde der Widerstandskämpfer beschränkt, eine objektive und umfassende Wahrnehmung war aufgrund der fehlenden Distanz schwierig.
Die fünfziger Jahre: Die 1950er Jahre waren gekennzeichnet von einem ambivalenten Umgang mit der NS-Vergangenheit. Während ein öffentliches Schweigen über den Nationalsozialismus vorherrschte, wurde die Erinnerung an den Widerstand zu bestimmten politischen Zwecken instrumentalisiert. Bücher wie "Die weiße Rose" erschienen, und Gedenkveranstaltungen belebten das kollektive Erinnern. Die Ehrung von Widerstandskämpfern diente auch außenpolitischen Zielen, etwa um die deutsche Annäherung an den Westen zu legitimieren. Der Prozess gegen Major Remer verdeutlicht die kontroversen juristischen Auseinandersetzungen um die Legitimität des Widerstands. Der Kabinettsbeschluss von 1951 zum Schutz der Erinnerung an den Widerstand zeigt die Sensibilität und zugleich die politische Nutzung des Themas. Die Einweihung des Widerstandsdenkmals in Berlin im Jahr 1953 sowie die Filmproduktionen zum 20. Juli unterstreichen die zunehmende öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema, wenngleich mit selektiven Darstellungen und Fokussierungen.
Die sechziger Jahre: In den 1960er Jahren wandelte sich das Verständnis des Widerstands. Die Legitimität staatlicher Herrschaft wurde an die Einhaltung von Recht und Moral geknüpft, was die Legitimität des Widerstands gegen den NS-Staat unterstrich. Die Würdigung des Widerstands durch Sozialdemokraten und die Rede Gustav Heinemanns markieren einen wichtigen Schritt hin zu einer umfassenderen Anerkennung aller Widerstandskämpfer. Allerdings blieb das Bild vom Widerstand noch immer auf den 20. Juli und die "Weiße Rose" fokussiert.
Die siebziger Jahre: Die 1970er Jahre waren von einer Erweiterung des Widerstandsbildes geprägt. Die Frage nach der Affinität von Widerstandskämpfern zum Nationalsozialismus rückte in den Vordergrund. Die Inflationierung des Begriffs "Widerstand" durch linksextreme Gruppen führte zu einer Kontroverse um die historische Bedeutung des Begriffs und dessen Abgrenzung vom Terrorismus. Die Erinnerung an den 20. Juli diente nun als Mahnung zur Bewahrung der demokratischen Errungenschaften im Angesicht neuer Bedrohungen.
Die achtziger Jahre: In den 1980er Jahren wurde die Erinnerung an den Widerstand als wichtiger Bestandteil der nationalen Identität, besonders in konservativen Kreisen, betont. Die Empfehlungen des Kultusministeriums zur Behandlung des Themas in Schulen zielten auf eine umfassendere Darstellung der Vielfalt des Widerstands ab.
Die neunziger Jahre: Die Debatten um die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin zeigen die anhaltende Auseinandersetzung mit der Definition von Widerstand und die Schwierigkeiten, ein umfassendes und ausgewogenes Bild zu vermitteln. Die Einbeziehung des "Nationalkomitees Freies Deutschland" führte zu Kontroversen.
Im 21. Jahrhundert: Die Erinnerung an den Widerstand wird im 21. Jahrhundert zur Legitimation der erreichten Werte und Normen und der Europäischen Union genutzt. Der Widerstand wird als wichtiges Zeichen auf dem Weg zu einem vereinten Europa gesehen.
Schlüsselwörter
Widerstand, Nationalsozialismus, Bundesrepublik Deutschland, DDR, 20. Juli, kollektives Gedächtnis, politische Instrumentalisierung, Erinnerungskultur, "Weiße Rose", Kalter Krieg, Legitimität, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen zur Rezeption des Widerstands gegen das NS-Regime in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption des Widerstandes gegen das NS-Regime in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Sie analysiert die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Instrumentalisierungen des Themas in verschiedenen Jahrzehnten und beleuchtet die damit verbundenen Kontroversen und Entwicklungen des kollektiven Gedächtnisses.
Welche Zeiträume werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Zeit von den späten 1940er Jahren bis ins 21. Jahrhundert, wobei jedes Jahrzehnt separat betrachtet wird.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Zentrale Themen sind die politische Instrumentalisierung des Widerstandsgedenkens, die Entwicklung des öffentlichen Bildes vom Widerstand, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen des Widerstands, der Einfluss des Kalten Krieges und die Rolle des 20. Juli 1944 im kollektiven Gedächtnis.
Wie wird der Widerstand in den späten 1940er Jahren dargestellt?
Die unmittelbare Nachkriegszeit war geprägt vom Versuch, die These einer Kollektivschuld zu widerlegen. Der Widerstand diente als Beweis für frühen Widerstand und Impuls für den demokratischen Aufbau. Gleichzeitig gab es Vorbehalte, von der Furcht vor einer neuen "Dolchstoßlegende" bis zur Sicht des Widerstands als Landesverrat. Die Erinnerung war zunächst auf Angehörige beschränkt.
Wie wurde der Widerstand in den 1950er Jahren wahrgenommen?
Die 1950er Jahre waren von einem ambivalenten Umgang mit der NS-Vergangenheit geprägt. Öffentliches Schweigen über den Nationalsozialismus war vorherrschend, doch der Widerstand wurde zu politischen Zwecken instrumentalisiert. Bücher wie "Die weiße Rose" und Gedenkveranstaltungen belebten das kollektive Erinnern. Die Ehrung von Widerstandskämpfern diente außenpolitischen Zielen. Der Prozess gegen Remer und der Kabinettsbeschluss von 1951 zeigen die kontroversen Auseinandersetzungen.
Wie veränderte sich die Wahrnehmung des Widerstands in den 1960er Jahren?
In den 1960er Jahren wandelte sich das Verständnis des Widerstands. Die Legitimität staatlicher Herrschaft wurde an Recht und Moral geknüpft, was die Legitimität des Widerstands gegen den NS-Staat unterstrich. Die Würdigung durch Sozialdemokraten und die Rede Heinemanns markieren einen wichtigen Schritt hin zu umfassenderer Anerkennung.
Welche Entwicklungen gab es in den 1970er Jahren?
Die 1970er Jahre waren von einer Erweiterung des Widerstandsbildes geprägt. Die Frage nach der Affinität von Widerstandskämpfern zum Nationalsozialismus rückte in den Vordergrund. Die Inflationierung des Begriffs "Widerstand" durch linksextreme Gruppen führte zu Kontroversen.
Wie wurde der Widerstand in den 1980er und 1990er Jahren erinnert?
In den 1980er Jahren wurde die Erinnerung an den Widerstand als wichtiger Bestandteil der nationalen Identität betont. Die Empfehlungen des Kultusministeriums zielten auf eine umfassendere Darstellung der Vielfalt des Widerstands ab. In den 1990er Jahren zeigten Debatten um die Gedenkstätte Deutscher Widerstand die anhaltende Auseinandersetzung mit der Definition von Widerstand.
Wie wird der Widerstand im 21. Jahrhundert gesehen?
Im 21. Jahrhundert wird die Erinnerung an den Widerstand zur Legitimation der erreichten Werte und Normen und der Europäischen Union genutzt. Der Widerstand wird als wichtiges Zeichen auf dem Weg zu einem vereinten Europa gesehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Widerstand, Nationalsozialismus, Bundesrepublik Deutschland, DDR, 20. Juli, kollektives Gedächtnis, politische Instrumentalisierung, Erinnerungskultur, "Weiße Rose", Kalter Krieg, Legitimität, Demokratie.
- Quote paper
- Verena Binder (Author), 2017, Rezeption des Widerstands gegen Hitler nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414144