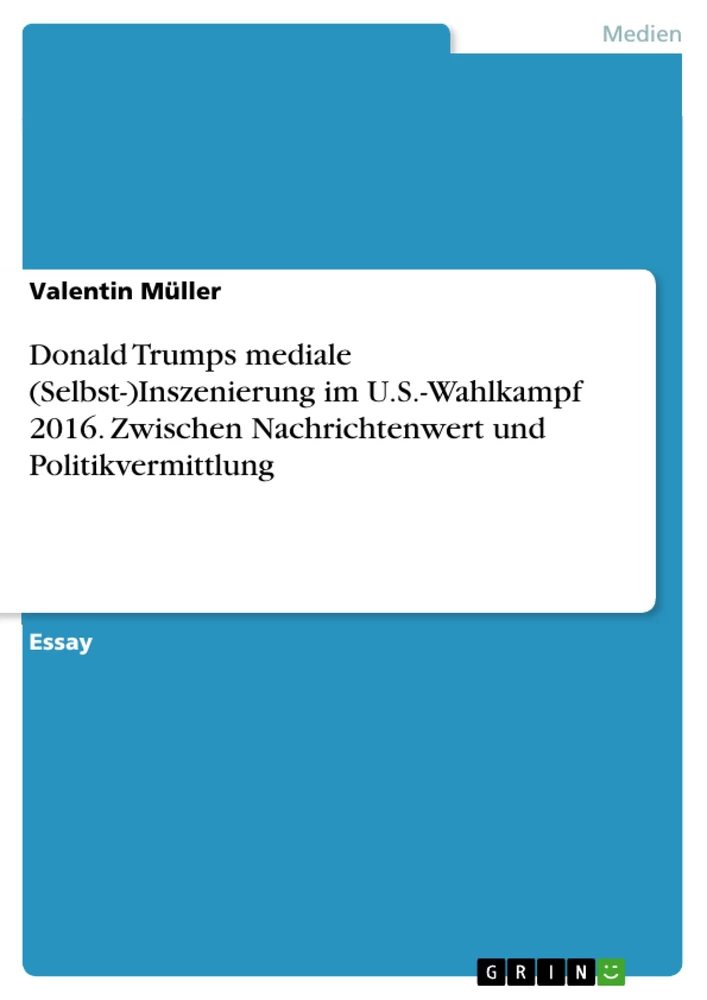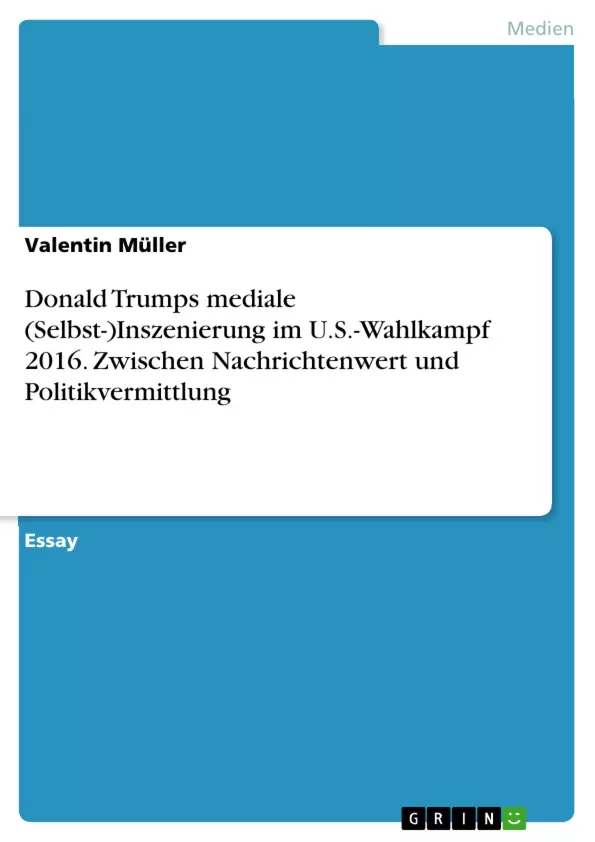In dieser Arbeit soll die Rolle, die die mediale Berichterstattung für den überraschenden Erfolg Trumps im US-Wahlkampf 2016 gespielt hat, nachgezeichnet werden. Angelehnt an das in der Kommunikationswissenschaft verbreitete Schema der „Nachrichtenfaktoren“ wird argumentiert, dass die etablierten Funktionsmechanismen der Auswahl und Gestaltung von Meldungen der Kampagne Trumps in die Hände gespielt hat. Hieraus werden Fragen zur Verantwortung und Zuständigkeit der Nachrichtenmedien abgeleitet.
Als Donald Trump im Sommer letzten Jahres seine Kandidatur bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen bekanntgab, wollte ihn niemand so richtig ernst nehmen. In dem Vorhaben des Unternehmers, aus dem Stand das höchste Amt der Vereinigten Staaten von Amerika bekleiden zu wollen, meinten stattdessen viele den Größenwahn eines vom Wohlstand verwöhnten Einzelgängers zu erkennen. Wenn auch der frische Wind, den Trumps eigensinnige Art in die politische Sphäre brachte, vielen Menschen zuzusagen schien, vertraute man doch insgeheim darauf, dass der große Wirbel um dessen Wahlantritt schnell wieder abklingen würde, wenn er den „richtigen“, seriösen Politikern Platz machen müsse.
Dass die rechtsstaatlichen Systeme es tatsächlich zulassen würden, dass jemand ohne jegliche Erfahrung in der Politik tatsächlich binnen kürzester zur einflussreichsten Person der Welt werden konnte, erschien vermutlich selbst ihren größten Kritikern wie Blasphemie. Selbst noch bei der Amtseinführung des Präsidenten am zwanzigsten Januar 2017 haftete dem Geschehen in den USA etwas Unwirkliches an – so als müsse man nur darauf warten, dass Trump von der politischen Realität einer globalisierten, hochgradig vernetzten Welt des einundzwanzigsten Jahrhunderts eingeholt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Nachrichtenwert“ vs. „wertvolle Nachrichten“?
- "Call me pig, but call me!"
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der medialen Berichterstattung im U.S.-Wahlkampf 2016 und analysiert, inwiefern die mediale (Selbst-)Inszenierung von Donald Trump zu seinem überraschenden Erfolg beigetragen hat. Dabei wird die Bedeutung von „Nachrichtenfaktoren“ im Kontext der Nachrichtenwerttheorie beleuchtet und die Frage nach der Verantwortung und Zuständigkeit der Nachrichtenmedien im digitalen Zeitalter gestellt.
- Mediale (Selbst-)Inszenierung im U.S.-Wahlkampf 2016
- Nachrichtenwerttheorie und „Nachrichtenfaktoren“
- Verantwortung und Zuständigkeit der Nachrichtenmedien
- Politikvermittlung im digitalen Zeitalter
- Einfluss von Social Media und Online-Plattformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Dabei wird die Bedeutung von Donald Trumps medialer Präsenz im Wahlkampf 2016 beleuchtet und der Forschungsfokus auf die Rolle der Nachrichtenwerttheorie gelegt.
„Nachrichtenwert“ vs. „wertvolle Nachrichten“?
Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von Globalisierung und Digitalisierung auf die Nachrichtenproduktion und -verbreitung. Es wird die Rolle der Medien als „Gatekeeper“ und die Funktionsweise der Nachrichtenwerttheorie anhand der „Nachrichtenfaktoren“ von Galtung und Ruge (1965) erläutert.
"Call me pig, but call me!"
Dieses Kapitel analysiert die mediale (Selbst-)Inszenierung von Donald Trump im Wahlkampf 2016. Es wird untersucht, wie er mit Hilfe von „Nachrichtenfaktoren“ die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen konnte und wie seine Botschaften im digitalen Zeitalter verbreitet wurden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Nachrichtenwert, Nachrichtenfaktoren, Medienlandschaft, Politikvermittlung, Digitalisierung, Social Media, Donald Trump, U.S.-Wahlkampf 2016, Medienspektakel, Entertainisierung der Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte Donald Trump Nachrichtenfaktoren für seinen Erfolg?
Durch Provokation und mediale Selbstinszenierung bediente er die Auswahlmechanismen der Medien, was ihm enorme Aufmerksamkeit verschaffte.
Was besagt die Nachrichtenwerttheorie?
Sie erklärt, warum bestimmte Ereignisse zu Nachrichten werden, basierend auf Faktoren wie Prominenz, Konflikt oder Überraschung.
Welche Rolle spielten die Medien als „Gatekeeper“?
Medien entscheiden, welche Informationen die Öffentlichkeit erreichen; im Fall Trump spielten ihnen seine unkonventionellen Methoden in die Hände.
Was ist mit „Entertainisierung der Politik“ gemeint?
Die Tendenz, politische Inhalte wie Unterhaltung zu inszenieren, um in einer digitalen Medienlandschaft Aufmerksamkeit zu generieren.
Welche Verantwortung tragen Nachrichtenmedien laut der Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt, ob Medien durch die Fokussierung auf den Nachrichtenwert ihre Pflicht zur Vermittlung wertvoller politischer Inhalte vernachlässigen.
- Quote paper
- Valentin Müller (Author), 2016, Donald Trumps mediale (Selbst-)Inszenierung im U.S.-Wahlkampf 2016. Zwischen Nachrichtenwert und Politikvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414269