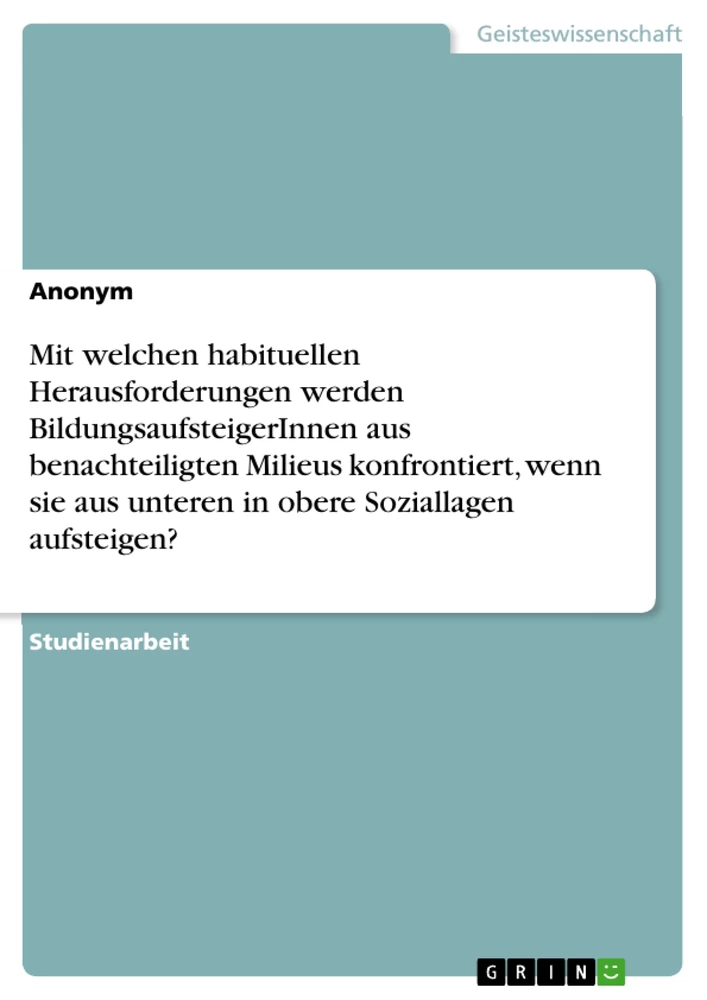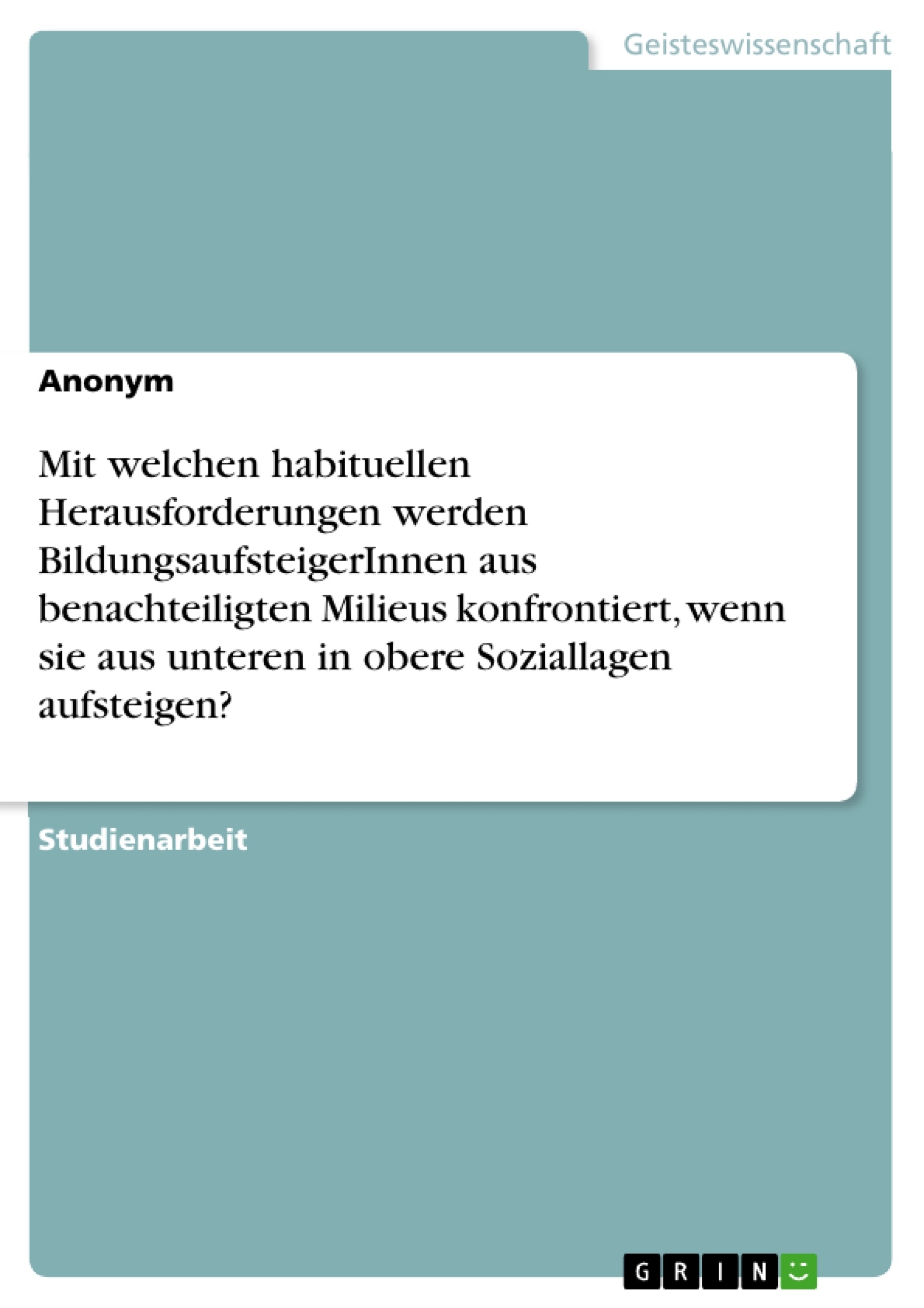In den letzten Jahren ist die Tendenz der Bildungsaufsteiger*innen in Deutschland gesunken . Trotzdem wird immer wieder der Spruch „Jeder ist seines Glückes Schmied“ verwendet und sogar als gut gemeinter Ratschlag erteilt. Doch hängt der Bildungserfolg wirklich noch von der eigenen Leistungsbereitschaft ab? Oder „fällt der Apfel [doch] nicht weit vom Stamm“? In der Soziologie beschäftigen sich vor allem seit Bourdieus Erkenntnissen zum Sozialen Raum viele Wissenschaftler mit dieser Frage. Nicht selten werden dabei die Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg untersucht. Dabei liegt der Fokus oftmals auf Individuen, die sich zwischen höheren und niedrigeren Positionen bewegen, diese sozialen Auf- und Abstiege werden auch Soziale Mobilität genannt . Bereits im Jahr 2000 zeigten die Untersuchungen der internationalen Schulleistungsstudie PISA, dass ein Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und erworbenen Kompetenzen besteht . Das heißt, Kinder, deren Eltern einen hohen gesellschaftlichen Status aufweisen, erreichen in der Regel ein höheres Kompetenzniveau, als Kinder aus der Arbeiterklasse . Aber warum ist das so? Und kann angesichts dieser Tatsache dann überhaupt noch von Chancengleichheit im Bildungssystem gesprochen werden? Doch trotz der abfallenden Tendenz von Bildungsaufsteiger*innen, gibt es dennoch Menschen, die gegen alle Erwartungen einen Bildungsaufstieg von der unteren in die obere Schicht schaffen. Aber was passiert während des Aufstiegs mit der Persönlichkeit? Mit welchen habituellen Herausforderungen werden die Bildungsaufsteiger*innen während und nach dem Aufstieg konfrontiert? Ziel dieser Hausarbeit ist es, diese Fragen mithilfe der theoretischen Konzepte Pierre Bourdieus zu klären und beantworten. Dazu sollen im ersten Kapitel die wichtigsten Begriffe definiert werden. Daraufhin folgen die Kapitalsorten nach Bourdieu, die wichtig zu erläutern sind, um das nachfolgende Kapitel besser verstehen zu können. In dem Kapitel geht es um die Herausforderungen und Nebenwirkungen, mit denen es Bildungsaufsteiger*innen während und nach dem Aufstieg zu tun haben. Dabei habe ich mich sehr an der Literatur von Aladdin El-Mafaalani orientiert. Schlussendlich ist am Ende der Hausarbeit noch eine kurze Zusammenfassung zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Habitus nach Pierre Bourdieu
- Soziale Ungleichheit
- Kapitalsorten nach Bourdieu
- Herausforderungen
- Habitustransformation
- Nebenwirkungen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den habituellen Herausforderungen, denen Bildungsaufsteiger*innen aus benachteiligten Milieus begegnen, wenn sie aus unteren in obere Soziallagen aufsteigen. Sie nutzt die theoretischen Konzepte Pierre Bourdieus, um zu untersuchen, wie sich der Aufstieg auf die Persönlichkeit und die Lebenswelt der Individuen auswirkt.
- Der Einfluss des Habitus auf Bildungserfolg und soziale Mobilität
- Die Rolle der Kapitalsorten nach Bourdieu (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital)
- Herausforderungen, die mit dem Aufstieg aus benachteiligten Milieus verbunden sind
- Die Transformation des Habitus während des Bildungsaufstiegs
- Nebenwirkungen des Bildungsaufstiegs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Hausarbeit dar. Sie beleuchtet die sinkende Tendenz von Bildungsaufsteiger*innen in Deutschland und stellt die Frage nach dem Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg.
- Definitionen: Dieses Kapitel erklärt die zentralen Begriffe Habitus, Soziale Ungleichheit und kulturelle Passung, um ein klares Verständnis für den weiteren Verlauf der Arbeit zu gewährleisten.
- Habitus nach Pierre Bourdieu: Hier wird die Habitustheorie von Pierre Bourdieu vorgestellt, insbesondere die Bedeutung des Habitus als verinnerlichte Denk- und Handlungsmuster, die durch die Erfahrungen und die soziale Herkunft geprägt werden.
- Soziale Ungleichheit: In diesem Kapitel wird die Definition der Sozialen Ungleichheit nach Stefan Hradil erläutert, die die ungleiche Verteilung von Ressourcen in Gesellschaften und deren Folgen für die Lebenschancen von Menschen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Habitus, Soziale Ungleichheit, Bildungsaufsteiger*innen, soziale Mobilität, Kapitalsorten (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), Pierre Bourdieu, soziale Herkunft, und Habitustransformation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Mit welchen habituellen Herausforderungen werden BildungsaufsteigerInnen aus benachteiligten Milieus konfrontiert, wenn sie aus unteren in obere Soziallagen aufsteigen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414391