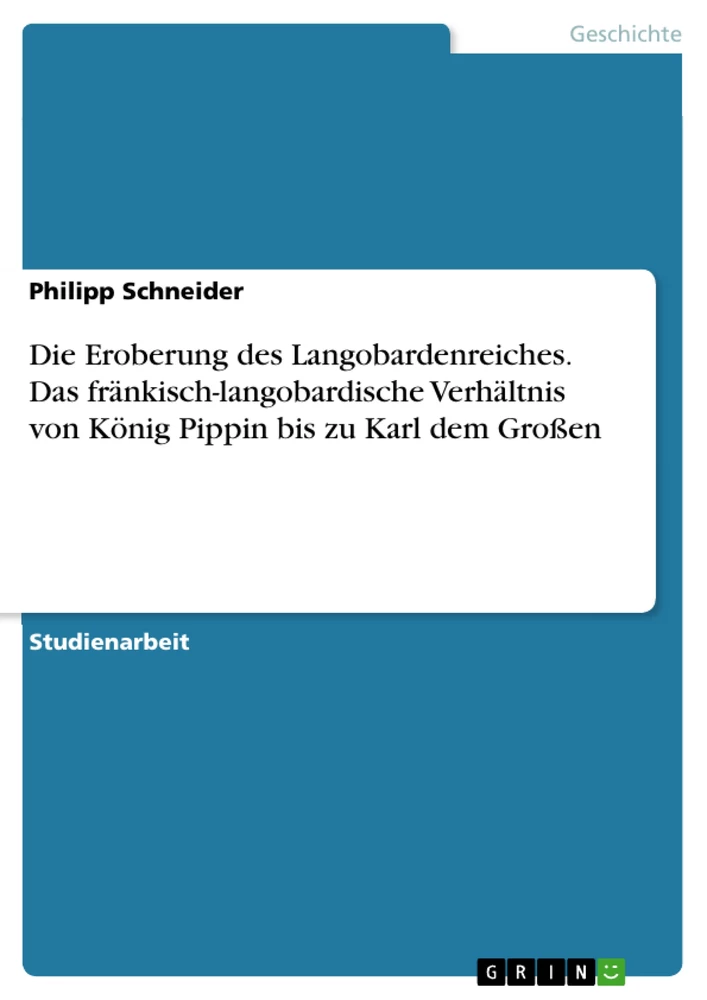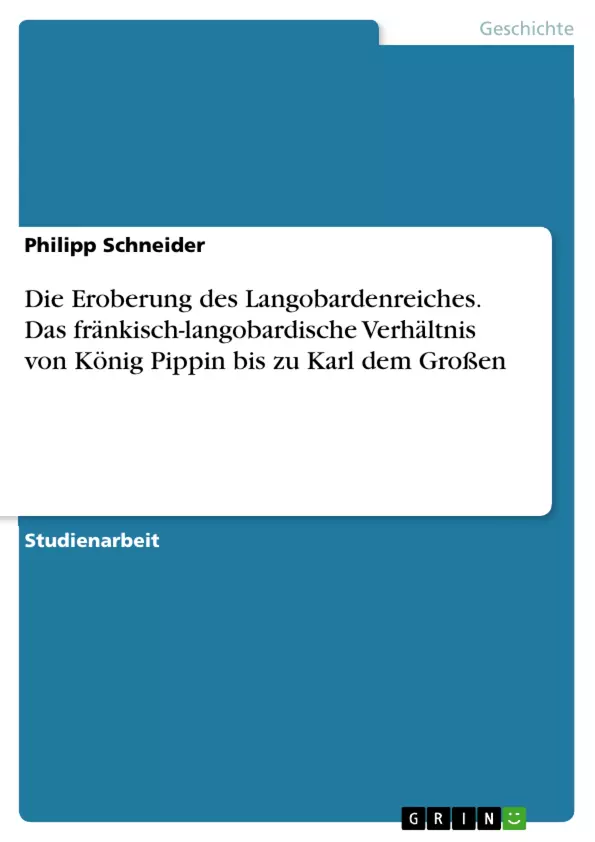Das Eingreifen der Franken unter König Pippin in Italien zugunsten des Papsttums führte zu einem entscheidenden Wandel des fränkisch-langobardischen Verhältnisses, welches schließlich in der Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen im Jahr 774 endete. Dieses führte jedoch nicht nur zum Ende der Selbständigkeit des Langobardenreiches, sondern schuf darüber hinaus wichtige Voraussetzungen zur Errichtung des fränkischen Kaisertums.
Diese Hausarbeit hat deshalb das Ziel, die fränkische Italienpolitik und ihre Ergebnisse von König Pippin bis zu Karl den Großen hinsichtlich dieser Voraussetzungen zu untersuchen. Es sollen daher die wichtigsten Etappen im fränkisch-langobardischen Verhältnis in Bezug auf diese Fragestellung analysiert werden. Zum besseren Verständnis wird vor dem Beginn der eigentlichen Untersuchung ein Überblick über die Beziehungen der Franken zu den Langobarden vom langobardischen Einfall in Italien 568 bis zur fränkischen Kirchenreform 744 gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Thematik
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Quellenlage
- 2 Grundzüge des fränkisch-langobardischen Verhältnisses 568-744
- 3 Die Wende der fränkischen Italienpolitik
- 3.1 Kirchenreform, karolingisches Königtum und die langobardische Offensive
- 3.2 Das fränkisch-päpstliche Bündnis
- 3.3 Die fränkischen Interventionen 754/56
- 3.4 Resultate und Schlussfolgerungen
- 4 Das Wiedererstarken des Langobardenreiches
- 4.1 Die Politik des Königs Desiderius bis zum Tod Pippins
- 4.2 Bertradas Bündnispolitik
- 4.3 Resultate und Schlussfolgerungen
- 5 Die Errichtung der fränkischen Herrschaft in Italien
- 5.1 Karls Alleinherrschaft und Bruch mit Desiderius
- 5.2 Das Ende des Langobardenreiches
- 5.3 Ordnung der italienischen Verhältnisse
- 5.4 Resultate und Schlussfolgerungen
- 6 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die fränkische Italienpolitik von König Pippin bis Karl dem Großen und deren Einfluss auf die Errichtung des fränkischen Kaisertums. Analysiert werden die wichtigsten Etappen im fränkisch-langobardischen Verhältnis in Bezug auf diese Fragestellung.
- Das fränkisch-langobardische Verhältnis von 568 bis 744
- Die Wende der fränkischen Italienpolitik durch die Kirchenreform und das fränkisch-päpstliche Bündnis
- Das Wiedererstarken des Langobardenreiches unter Desiderius
- Die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen
- Die Bedeutung der Eroberung für die Errichtung des fränkischen Kaisertums
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der fränkischen Italienpolitik von König Pippin bis Karl dem Großen ein. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit, die Untersuchung der Voraussetzungen für die Errichtung des fränkischen Kaisertums, und gibt einen Überblick über den Forschungsstand und die Quellenlage. Die einseitige Quellenlage, die hauptsächlich auf fränkischen und römischen Quellen beruht und langobardische Quellen vermisst, wird hervorgehoben.
2 Grundzüge des fränkisch-langobardischen Verhältnisses 568-744: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Beziehungen zwischen Franken und Langobarden vom Einfall der Langobarden in Italien 568 bis zur fränkischen Kirchenreform 744. Es beschreibt die anfänglichen Konflikte, die Phase der Unterwerfung der Langobarden unter die Franken, den Friedensschluss um 600 und die darauffolgende lange Friedenszeit, die erst durch einen fränkischen Einfall um 660 unterbrochen wurde. Der Höhepunkt der freundschaftlichen Beziehungen wird unter Karl Martell und Liutprand erreicht, geprägt durch eine enge persönliche Freundschaft und gegenseitiges Ansehen.
3 Die Wende der fränkischen Italienpolitik: Dieses Kapitel beschreibt die entscheidende Wende im fränkisch-langobardischen Verhältnis. Die Kirchenreform im Frankenreich unter Pippin und Karlmann, die verstärkte Bindung an Rom, und die Legitimation von Pippins Königsherrschaft durch Papst Zacharias führten zur Annäherung der Franken an das Papsttum und zur Abkehr von der traditionellen Freundschaft mit den Langobarden. Aistulfs expansive Politik und die Bitte von Papst Stephan II. um Hilfe gegen die Langobarden führten zu den fränkischen Interventionen und dem fränkisch-päpstlichen Bündnis, welches die Franken zum Schutzherren der römischen Kirche machte.
4 Das Wiedererstarken des Langobardenreiches: Nach dem Tod Aistulfs gelang es Desiderius, die Macht des Langobardenreiches wieder zu stärken. Er nutzte Pippins Abwesenheit im Frankenreich, die Teilung des Reiches nach dessen Tod, und diplomatisches Geschick aus, um den Frieden mit dem Papst zu wahren und seine Herrschaft auszudehnen. Die Bündnispolitik Bertradas, die zur Heirat Karls mit einer Tochter Desiderius führte, verstärkte diese Entwicklung und brachte das Langobardenreich vorübergehend wieder in eine Position der Vorherrschaft.
5 Die Errichtung der fränkischen Herrschaft in Italien: Nach dem Tod Karlmanns und dem Bruch des Bündnisses zwischen Karl und Desiderius kam es zum Krieg zwischen Franken und Langobarden. Karls Sieg über Desiderius bedeutete das Ende des Langobardenreiches und die Errichtung der fränkischen Herrschaft in Italien. Karl übernahm die langobardische Königswürde und beanspruchte, durch die Annahme des Patricius-Titels, kaiserliche Rechte über Rom. Diese Ereignisse bildeten wichtige Voraussetzungen für seine spätere Kaiserkrönung.
6 Resümee: Das Resümee fasst die drei zentralen Voraussetzungen für die Kaiserkrönung Karls des Großen zusammen: den fränkisch-päpstlichen Bund, die Verleihung und spätere Inanspruchnahme der Rechte des Patricius-Titels durch Karl, und den Machtgewinn des Frankenreiches durch die Eroberung des Langobardenreiches. Es wird betont, dass Karls Kaiserkrönung nicht die Errichtung eines neuen Reiches, sondern die Krönung einer bereits bestehenden und weitreichenden Macht bedeutete.
Schlüsselwörter
Fränkisch-langobardisches Verhältnis, Kirchenreform, karolingisches Königtum, fränkisch-päpstliches Bündnis, Pippin der Jüngere, Karl der Große, Desiderius, Eroberung des Langobardenreiches, Patricius Romanorum, Kaiserkrönung, Italienpolitik, Macht des Frankenreiches.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Fränkische Italienpolitik von Pippin bis Karl dem Großen
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die fränkische Italienpolitik von König Pippin bis Karl dem Großen und deren Einfluss auf die Errichtung des fränkischen Kaisertums. Sie analysiert die wichtigsten Etappen im fränkisch-langobardischen Verhältnis in Bezug auf diese Fragestellung.
Welche Zeitspanne wird behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zeitraum von der Ankunft der Langobarden in Italien (568) bis zur Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen und den damit verbundenen Voraussetzungen für seine Kaiserkrönung.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind das fränkisch-langobardische Verhältnis, die Wende der fränkischen Italienpolitik durch die Kirchenreform und das fränkisch-päpstliche Bündnis, das Wiedererstarken des Langobardenreiches unter Desiderius, die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen und die Bedeutung dieser Eroberung für die Errichtung des fränkischen Kaisertums.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundzüge des fränkisch-langobardischen Verhältnisses (568-744), Die Wende der fränkischen Italienpolitik, Das Wiedererstarken des Langobardenreiches, Die Errichtung der fränkischen Herrschaft in Italien und ein Resümee. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung dargestellt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf fränkischen und römischen Quellen. Es wird darauf hingewiesen, dass langobardische Quellen fehlen, was die Quellenlage einseitig macht.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Hausarbeit identifiziert drei zentrale Voraussetzungen für Karls Kaiserkrönung: den fränkisch-päpstlichen Bund, die Verleihung und Inanspruchnahme der Rechte des Patricius-Titels durch Karl und den Machtgewinn des Frankenreiches durch die Eroberung des Langobardenreiches. Die Kaiserkrönung wird als Krönung einer bereits bestehenden Macht dargestellt, nicht als die Errichtung eines neuen Reiches.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Fränkisch-langobardisches Verhältnis, Kirchenreform, karolingisches Königtum, fränkisch-päpstliches Bündnis, Pippin der Jüngere, Karl der Große, Desiderius, Eroberung des Langobardenreiches, Patricius Romanorum, Kaiserkrönung, Italienpolitik, Macht des Frankenreiches.
Welche Rolle spielt die Kirchenreform?
Die Kirchenreform im Frankenreich unter Pippin und Karlmann, die verstärkte Bindung an Rom und die Legitimation von Pippins Königsherrschaft durch Papst Zacharias führten zur Annäherung der Franken an das Papsttum und zur Abkehr von der traditionellen Freundschaft mit den Langobarden. Dies stellt eine entscheidende Wende in der fränkischen Italienpolitik dar.
Wie wird das Verhältnis zwischen Franken und Langobarden dargestellt?
Die Hausarbeit beschreibt ein wechselvolles Verhältnis, beginnend mit Konflikten, gefolgt von einer Phase der Unterwerfung und einer längeren Friedenszeit. Die Wende erfolgt durch die Kirchenreform und das fränkisch-päpstliche Bündnis, welches letztendlich zur Eroberung des Langobardenreiches führt.
Welche Bedeutung hat die Eroberung des Langobardenreiches?
Die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen war von entscheidender Bedeutung für die Errichtung des fränkischen Kaisertums. Sie brachte dem Frankenreich erheblichen Machtzuwachs und bildete eine der drei zentralen Voraussetzungen für Karls Kaiserkrönung.
- Quote paper
- Philipp Schneider (Author), 2001, Die Eroberung des Langobardenreiches. Das fränkisch-langobardische Verhältnis von König Pippin bis zu Karl dem Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414416