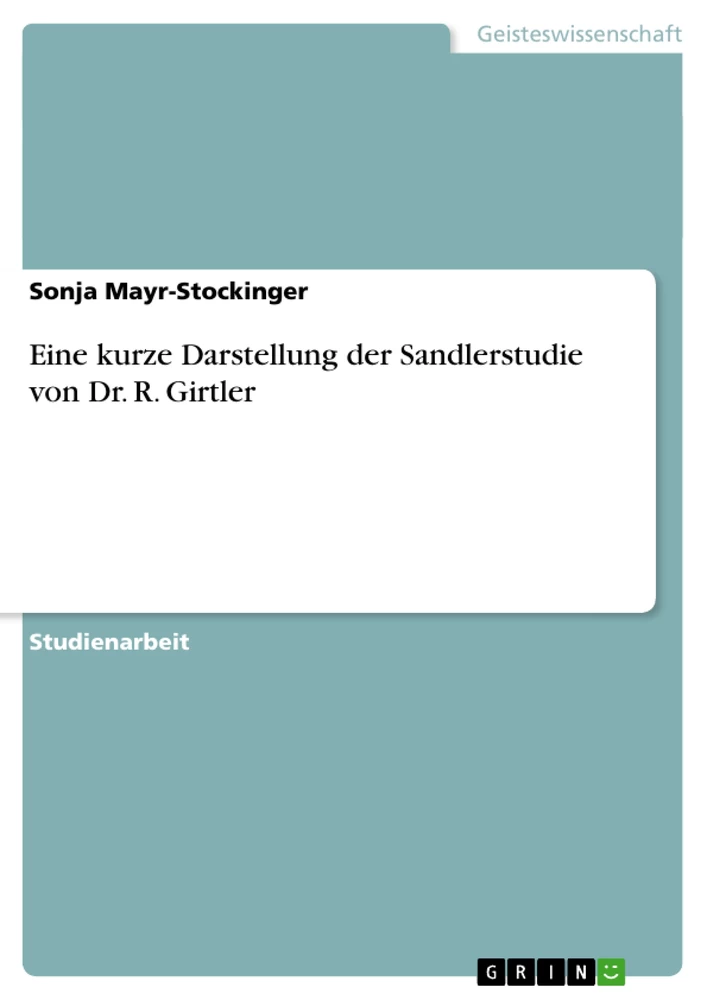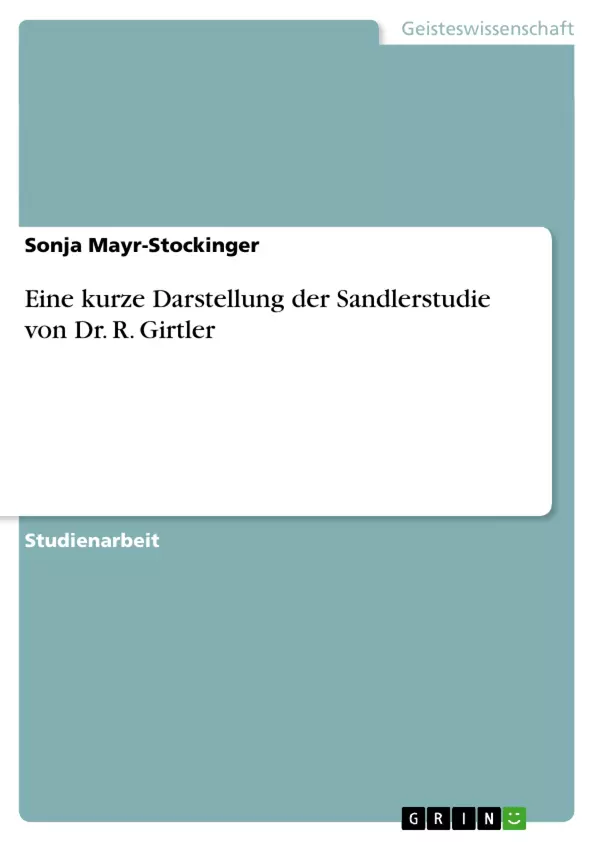Als Grundlage meiner Seminararbeit dient vor allem, die Sandlerstudie von Dr. Roland Girtler. Girtler hat für seine Untersuchung über die Obdachlosen Wiens, eine Methode angewendet, die unter Forscherkreisen nur sehr wenig angesehen ist und kaum angewendet wird, nämlich die der „unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung“.
Girtler hat in seiner Studie versucht, die Lebenswelt der Wiener Sandler, der Großstadtvagabunden, von verschiedenen Blickwinkeln her zu beschreiben und zu analysieren. Für seine Studie war hauptsächlich nur der Sandler wichtig, der aktiv sein Leben zu meistern versucht und der sich soziale Tendenzen im Kontakt zu anderen Sandlern zurecht legt, um autonom überleben zu können.
Für eine derartige Analyse ist es notwendig sich auf den Forschungsgegenstand einzulassen. Dieses Einlassen benötigt eine sehr hohe Sensibilität für den Gegenstand. Lamnek beschreibt dieses Einlassen folgendermaßen: „Will man eine möglichst vorurteilsfreie Einstellung erreichen, so bedarf es einer erhöhten Sensibilität für die eigenen Gefühle, Wünsche und Einstellungen des Forschers. Wer z.B. aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte zu Mißtrauen und Vorsicht neigt und gewohnt ist, bei der Erreichung seiner Ziele indirekte Wege zu bevorzugen, die von anderen nicht so ohne weiteres erkennbar sind, wird vielleicht dazu neigen, auch seinen Forschungsobjekten derartige Strategien zu unterstellen; wer selbst materielle Belohnungen gering schätzt, kann leicht ihren Wert für andere Menschen unterschätzen usw. Ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis und Selbstkritik scheint also unerläßlich, zumal individuelle Züge auch die Auswahl und Präferenz der Theorien beeinflussen. Eine grundsätzliche distanzierte Einstellung zu anderen Menschen verträgt sich z.B. leichter mit Lern- und Verhaltenstheorien oder Systemtheorien als mit der Humanistischen Psychologie.“ (Lamnek, 1993, S. 66)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung
- Offenheit
- Forschung als Kommunikation
- Der Prozeßcharakter von Forschung und Gegenstand
- Reflexivität von Gegenstand and Analyse
- Die Explikation
- Flexibilität
- Methode
- Die freie Feldforschung
- Die unstrukturierte teilnehmende Beobachtung
- Die unstrukturierte teilnehmende Beschreibung
- Biographien
- Das „,ero-epische Gespräch“
- Fragestellung
- Die Kontaktaufnahme
- Schlußfolgerung
- Einstellung höherer sozialer Schichten gegenüber dem Sandler
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Sandlerstudie von Dr. Roland Girtler, die sich mit der Lebenswelt Wiener Sandler beschäftigt. Girtler wendet die Methode der „unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung“ an, um die sozialen Tendenzen und das Streben nach Autonomie der Sandler zu untersuchen.
- Qualitative Sozialforschung
- Unstrukturierte teilnehmende Beobachtung
- Lebenswelt Wiener Sandler
- Soziale Tendenzen und Autonomie
- Reflexivität in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sandlerstudie ein und erläutert die Forschungsmethode der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung.
Das Kapitel „Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung“ beleuchtet wichtige Prinzipien dieser Forschungsrichtung, wie Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozeßhaftigkeit und Reflexivität.
Im Kapitel „Methode“ wird die Methode der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung detaillierter beschrieben, einschließlich der Aspekte der freien Feldforschung, Biographien und des „ero-epischen Gesprächs“.
Die Kapitel „Fragestellung“ und „Die Kontaktaufnahme“ beleuchten die Herangehensweise des Forschers an die Untersuchung und die Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit den Sandler.
Schlüsselwörter
Die Sandlerstudie konzentriert sich auf qualitative Sozialforschung, die unstrukturierte teilnehmende Beobachtung als Methode, die Lebenswelt Wiener Sandler, soziale Tendenzen, Autonomie, Reflexivität und die Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Sandlerstudie von Dr. Roland Girtler?
Die Studie untersucht die Lebenswelt der Wiener Obdachlosen (Sandler) und deren soziale Strategien zum autonomen Überleben.
Welche Forschungsmethode wendete Girtler an?
Er nutzte die "unstrukturierte teilnehmende Beobachtung", eine Methode der qualitativen Sozialforschung, bei der sich der Forscher direkt in das Feld begibt.
Was versteht man unter einem "ero-epischen Gespräch"?
Es handelt sich um eine spezielle Interviewform Girtlers, die eher einem natürlichen Gespräch ähnelt als einem starren Abfragen von Daten.
Warum ist Reflexivität in dieser Studie so wichtig?
Der Forscher muss seine eigenen Vorurteile und Einstellungen kennen, um die Lebenswelt der Sandler möglichst unverfälscht beschreiben zu können.
Wie reagieren höhere soziale Schichten laut der Studie auf Sandler?
Die Arbeit thematisiert die Einstellung und Distanzierung höherer Schichten gegenüber den Wiener Großstadtvagabunden.
- Quote paper
- Sonja Mayr-Stockinger (Author), 2003, Eine kurze Darstellung der Sandlerstudie von Dr. R. Girtler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41487