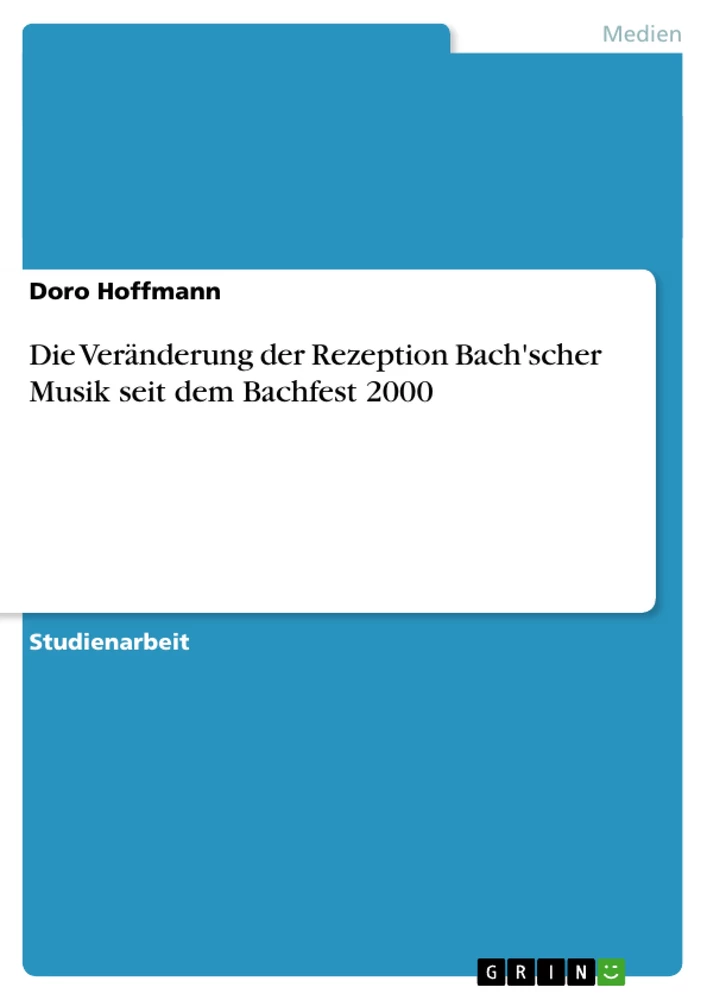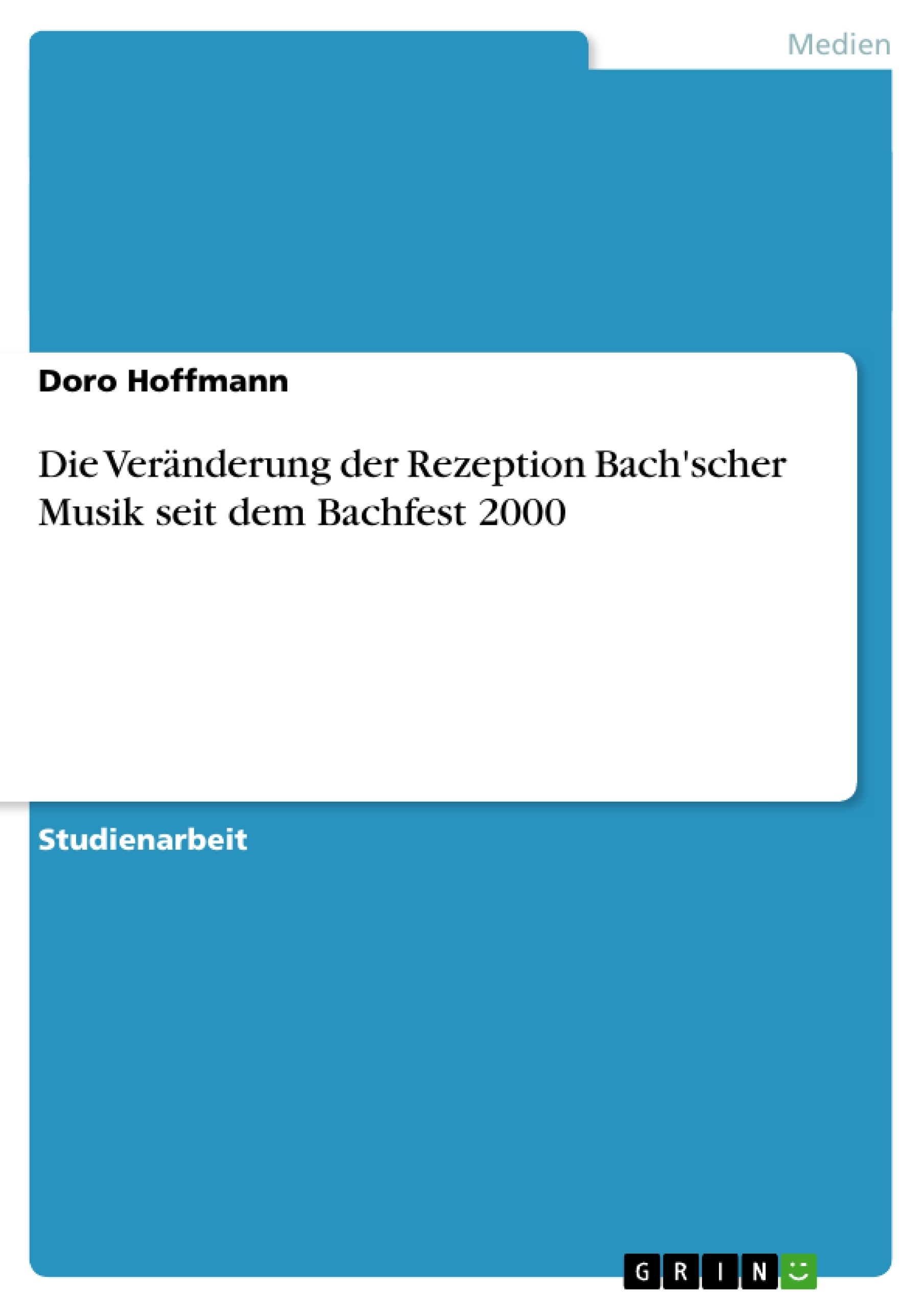Johann Sebastian Bach verbrachte einen Großteil seines Lebens und vor allem seiner Wirkungszeit in Leipzig. Dennoch verstand sich die Stadt nicht von Anfang an als ‚Bach- Stadt’. Im Gegenteil – während seiner Wirkungszeit in Leipzig hatte er oft mit den Stadtoberen zu kämpfen, die ihm immer wieder mehr oder weniger unabsichtlich bei der Ausführung seiner Pflichten Steine in den Weg legten. Auch Bach selbst dürfte seinen Dienst in Leipzig wohl kaum als Aufstieg gegenüber seinen vorherigen Anstellungen gesehen haben – er war schließlich Hofkapellmeister in Köthen und wollte dieses Amt eigentlich auch gern in Dresden ausfüllen. Dass er sich mit einer – noch dazu in dritter Wahl besetzten – Stelle als Kirchenmusiker zufrieden geben musste, die seinerzeit bei weitem nicht so hoch und ehrenhaft angesehen wurde wie eine höfische Stelle, dürfte ihn nicht nur wegen der fehlenden professionellen Musiker in Leipzig ordentlich geärgert haben. Erst mit der Wiederaufführung der Matthäuspassion durch Mendelssohn im Jahre 1819 – 69 Jahre nach Bachs Tod – begann die Stadt Leipzig, eine Art Selbstverständnis als Bach-Stadt zu entwickeln. Einhergehend mit dieser Entwicklung wurde Bach generell, auch über die Grenzen der Stadt hinaus, allmählich immer mehr als großartiger Musiker gesehen, der die Musik noch über Jahrhunderte prägen sollte und wird. Diese Bach-Renaissance vollzog sich zu Anfang großteils in den Kreisen von Komponisten, Musikwissenschaftlern und Klassik-Kennern. Ein Bild Bachs entwickelte sich, das geprägt war von Ernsthaftigkeit, von Seriosität und Strenge sowohl der Person Bach als auch seiner Musik. Institutionen wie das Bach-Museum, die Thomaskirche als authentischer Wirkungs- und Aufführungsstätte, das Bach-Archiv und die seit einhundert Jahren von der Bachgesellschaft bzw. der Neuen Bachgesellschaft organisierten und inzwischen jährlich wiederkehrenden Bachfeste bestärkten dieses Bild von einem strenggläubigen Christen, dessen Musik ernst zu nehmen ist und bestenfalls in der Thomaskirche original erklingen darf.
Diese eben erfolgte Darstellung ist natürlich pointiert. Eins zu eins umgesetzt kann sie sicher nicht bestätigt gefunden werden, auch nicht in der Vergangenheit, aber dennoch ging das Bach-Bild durchaus an vielen Stellen mehr oder weniger in die genannte Richtung. In den letzten Jahren jedoch hat sich ein interessanter Wandel in der Wahrnehmung von Bachs Person und Werk vollzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beobachtung und Beschreibung
- Auswertung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Veränderungen in der Rezeption von Bachs Musik seit dem Bachfest 2000. Sie untersucht die Faktoren, die zu diesem Wandel geführt haben, und die Auswirkungen auf die heutige Wahrnehmung von Bachs Werk. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf den Beitrag, den die Bachfeste in Leipzig seit 1999, besonders das Jubiläumsfest 2000, geleistet haben.
- Die Entwicklung der Rezeption von Bachs Musik seit dem Bachfest 2000
- Die Rolle der Bachfeste in Leipzig bei der Veränderung des Bach-Bildes
- Faktoren, die zur Neuinterpretation von Bachs Musik geführt haben
- Die Auswirkungen der veränderten Rezeption auf die heutige Aufführungspraxis
- Die Bedeutung des Bachfestes für die Stadt Leipzig als „Bach-Stadt“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Arbeit dar und erläutert den Wandel in der Rezeption von Bachs Musik seit dem Bachfest 2000. Sie beschreibt die historische Entwicklung des Bach-Bildes und die steigende Popularität von Bachs Musik in den letzten Jahren.
Beobachtung und Beschreibung
Dieses Kapitel präsentiert Fakten und Indizien für ein verändertes Bach-Bild. Es stützt sich auf Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, die sich mit dem Bachfest 2000 und den Folgeveranstaltungen befassen. Die Analyse zeigt die steigende Resonanz des Bachfestes in der überregionalen Presse und die wachsende Besucherzahl.
Auswertung
In diesem Kapitel werden die im vorherigen Kapitel dargestellten Fakten ausgewertet. Die Arbeit analysiert die Gründe für die Erneuerung des Bach-Bildes und die daraus resultierenden Folgen für die Rezeption von Bachs Musik in der heutigen Zeit.
Schlüsselwörter
Bach, Bachfest, Bach-Bild, Rezeption, Musikgeschichte, Leipzig, Thomaskirche, Bach-Archiv, Medienresonanz, Popularität, Erneuerung, Aufführungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Bild von Johann Sebastian Bach in Leipzig gewandelt?
Lange Zeit galt Bach als strenger, ernsthafter Kirchenmusiker. In den letzten Jahren, besonders seit dem Bachfest 2000, wandelte sich die Wahrnehmung hin zu einem lebendigeren und populäreren Bild.
Welche Bedeutung hatte das Bachfest 2000 für die Bach-Rezeption?
Das Jubiläumsjahr 2000 wirkte als Katalysator, der Bachs Musik einem breiteren Publikum öffnete und die mediale Aufmerksamkeit für die „Bach-Stadt“ Leipzig massiv steigerte.
Warum wurde Leipzig erst spät zur „Bach-Stadt“?
Zu Lebzeiten hatte Bach oft Konflikte mit den Stadtoberen. Erst durch Mendelssohns Wiederaufführung der Matthäuspassion 1829 begann Leipzig, ein echtes Selbstverständnis als Bach-Zentrum zu entwickeln.
Welche Institutionen pflegen heute das Erbe Bachs in Leipzig?
Zentrale Institutionen sind die Thomaskirche, das Bach-Archiv, das Bach-Museum und die Neue Bachgesellschaft.
Hat die Popularität Bachs Auswirkungen auf die Aufführungspraxis?
Ja, der Wandel in der Rezeption führt zu neuen Interpretationsansätzen, die Bachs Werk über die rein religiöse Strenge hinaus als facettenreiche, zeitlose Musik erlebbar machen.
- Quote paper
- Doro Hoffmann (Author), 2005, Die Veränderung der Rezeption Bach'scher Musik seit dem Bachfest 2000, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41492