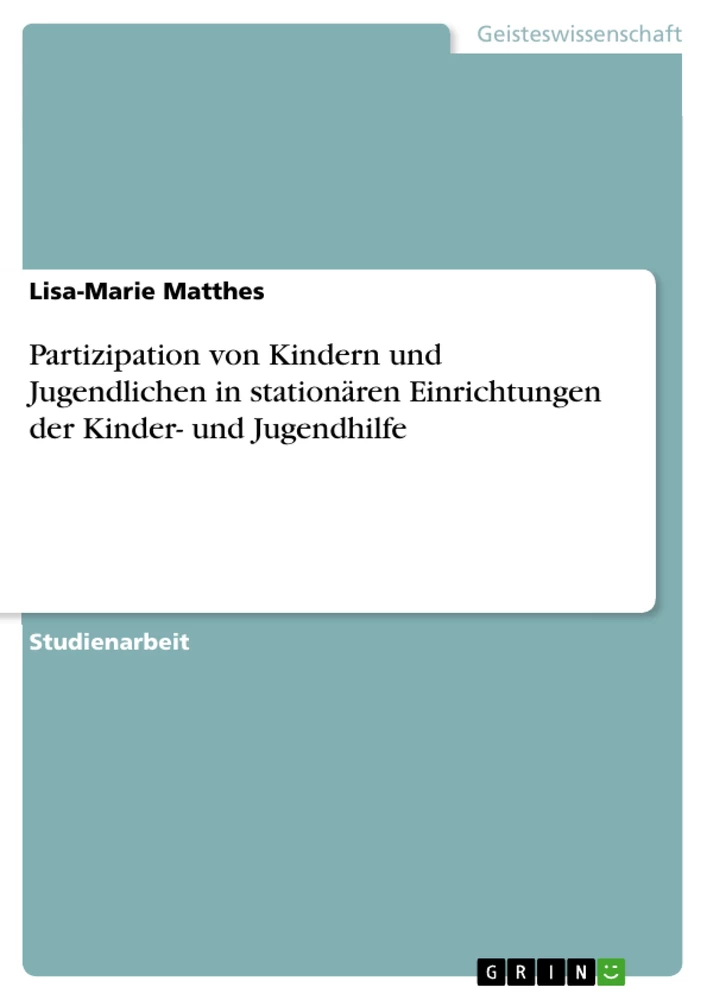In Deutschland leben die Menschen nach dem politischen System der Demokratie. Demnach werden alle Entscheidungen, die die Allgemeinheit betreffen, unmittelbar vom Volk selbst oder durch gewählte Volksvertreters getroffen. Die Menschen sind dazu angehalten, sich aktiv in die Gestaltung und Weiterentwicklung des Landes durch beispielsweise Wahlen, Bürgerinitiativen oder Volksentscheide zu integrieren. Damit sich Kinder und Jugendliche im Erwachsenenalter in politischen und gesellschaftlichen Belangen beteiligen können, ist es von enormer Wichtigkeit, sie bereits in jungen Jahren an Entscheidungen, die sie betreffen, einzubeziehen. Ziel ist es, sie zu autonomen Persönlichkeiten zu erziehen, die in der Gesellschaft mit Selbstbewusstsein ihr Mitbestimmungsrecht ausüben. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den stationären Erziehungshilfen nimmt somit eine zentrale Rolle ein. Die folgende Arbeit beschäftigt sich daher mit möglichen Beteiligungsformen, Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie rechtlichen Grundlagen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Grundlagen
- 2.1. Der Begriff Partizipation
- 2.2. Der Begriff Empowerment
- 3. Gesetzliche Grundlagen
- 3.1. UN-Kinderrechtskonvention
- 3.2. Kinder- und Jugendhilfegesetz
- 4. Beteiligungsformen
- 4.1. Individuelle Beteiligung
- 4.2. Alltägliche Beteiligung
- 4.3. Projektbezogene Beteiligung
- 4.4. Offene Beteiligung
- 4.5. Repräsentative Beteiligung
- 5. Gelingende Partizipation
- 5.1. Voraussetzungen
- 5.1.1. der Fachkräfte
- 5.1.2. der Kinder und Jugendlichen
- 5.1.3. der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
- 5.2. Ziele der Partizipation
- 5.3. Zusammenhang von Partizipation und Empowerment
- 5.1. Voraussetzungen
- 6. Schlussbemerkungen
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit untersucht die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist es zu klären, ob Partizipation dem zentralen Auftrag der Sozialen Arbeit in diesen Einrichtungen gerecht wird. Hierfür werden die Begrifflichkeiten von Partizipation und Empowerment geklärt, gesetzliche Grundlagen beleuchtet und verschiedene Beteiligungsformen analysiert.
- Definition und Abgrenzung von Partizipation und Empowerment
- Relevanz gesetzlicher Grundlagen (UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Vielfalt der Beteiligungsformen in der Praxis
- Voraussetzungen für gelingende Partizipation
- Ziele und Auswirkungen von Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ein. Sie verortet die Thematik im Kontext der demokratischen Gesellschaft und betont den hohen Entwicklungsbedarf in diesem Bereich. Der Bezug zur eigenen Arbeit in einer Wohngruppe wird hergestellt, und die Zielsetzung der Arbeit wird definiert: die Klärung, ob Partizipation dem zentralen Auftrag der Sozialen Arbeit in den Einrichtungen gerecht wird. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, mit der Ankündigung der Klärung der Begriffe Partizipation und Empowerment, der Analyse der gesetzlichen Grundlagen und der Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Zielen gelingender Partizipation.
2. Begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Partizipation und Empowerment. Partizipation wird als aktive Mitgestaltung von betroffenen jungen Menschen im Kontext der Selbstständigkeitserziehung definiert, während Empowerment als Ansatz der Sozialen Arbeit beschrieben wird, der Fachkräfte darin unterstützt, Menschen in schwierigen Lebenslagen zur Selbstbestimmung zu verhelfen. Die Kapitel differenzieren die vielseitigen Definitionen von Partizipation in der Praxis und Wissenschaft und betonen den Zusammenhang von Partizipation mit der Selbstständigkeitserziehung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sowie im Kontext politischer und gesellschaftlicher Prozesse. Der Begriff Empowerment wird eingeordnet als ein Ansatz, der die Selbstbemächtigung unterstützt.
3. Gesetzliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die nationalen und internationalen gesetzlichen Grundlagen, die die Rechte von Kindern und Jugendlichen festlegen. Es hebt die UN-Kinderrechtskonvention als wichtiges Abkommen hervor, das die Rechte auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Partizipation garantiert. Der Artikel 12 der Konvention, der das Recht des Kindes auf freie Meinungsäußerung in allen es betreffenden Angelegenheiten festschreibt, wird explizit erwähnt. Das Kapitel betont die globale Anerkennung der Bedeutung der Erziehung zu Autonomie und Beteiligung für die Zukunft der Welt und wie jedes Land die UN-Kinderrechtskonvention in nationale Gesetzgebungen integriert.
Schlüsselwörter
Partizipation, Empowerment, Kinder- und Jugendhilfe, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, UN-Kinderrechtskonvention, Beteiligungsformen, Soziale Arbeit, Heimerziehung, gesetzliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zentral ist die Frage, ob Partizipation dem zentralen Auftrag der Sozialen Arbeit in diesen Einrichtungen gerecht wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begrifflichkeiten von Partizipation und Empowerment, beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen (UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilfegesetz) und analysiert verschiedene Beteiligungsformen. Sie untersucht die Voraussetzungen für gelingende Partizipation, deren Ziele und Auswirkungen.
Wie werden Partizipation und Empowerment definiert?
Partizipation wird als aktive Mitgestaltung von betroffenen jungen Menschen im Kontext der Selbstständigkeitserziehung definiert. Empowerment wird als Ansatz der Sozialen Arbeit beschrieben, der Fachkräfte darin unterstützt, Menschen in schwierigen Lebenslagen zur Selbstbestimmung zu verhelfen.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere Artikel 12 (Recht auf freie Meinungsäußerung), und das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Es wird der Fokus auf die globale Anerkennung der Bedeutung von Autonomie und Beteiligung gelegt und wie die UN-Kinderrechtskonvention in nationale Gesetzgebungen integriert wird.
Welche Beteiligungsformen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Beteiligungsformen, darunter individuelle, alltägliche, projektbezogene, offene und repräsentative Beteiligung. Diese werden im Detail analysiert.
Welche Voraussetzungen sind für gelingende Partizipation notwendig?
Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen für gelingende Partizipation aus der Perspektive der Fachkräfte, der Kinder und Jugendlichen sowie der Einrichtungen selbst.
Welche Ziele verfolgt die Partizipation?
Die Arbeit analysiert die Ziele der Partizipation und deren Zusammenhang mit Empowerment.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Begrifflichen Grundlagen, den Gesetzlichen Grundlagen, den Beteiligungsformen, Gelingender Partizipation, Schlussbemerkungen und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Partizipation, Empowerment, Kinder- und Jugendhilfe, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, UN-Kinderrechtskonvention, Beteiligungsformen, Soziale Arbeit, Heimerziehung, gesetzliche Grundlagen.
- Quote paper
- Lisa-Marie Matthes (Author), 2016, Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415410