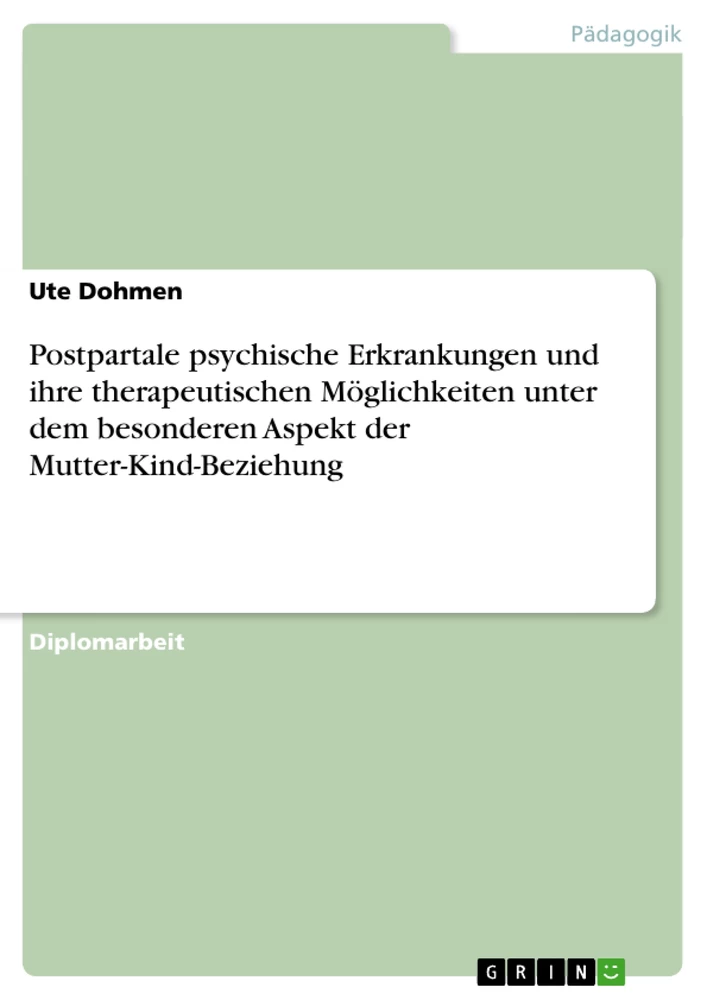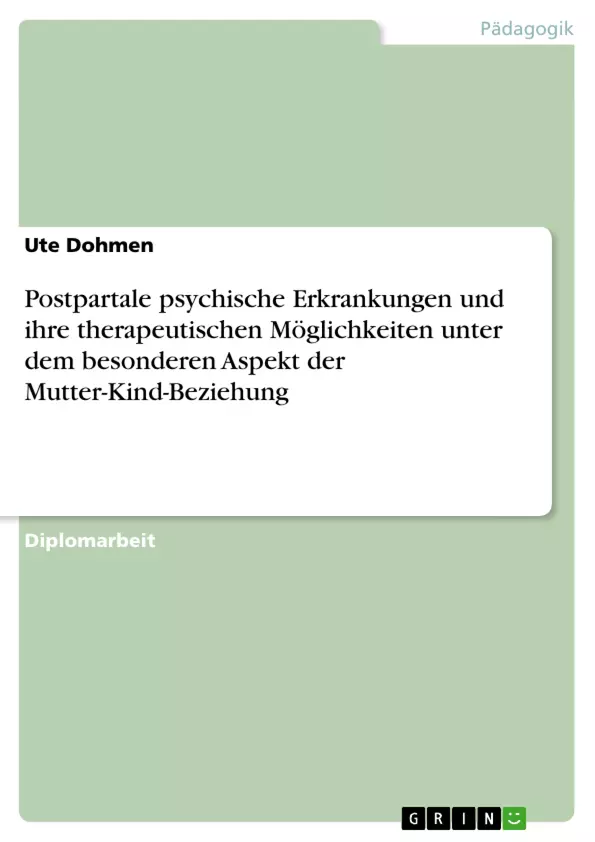Wenn eine Frau ein Kind erwartet, stellt sie sich viele Fragen, beispielsweise die Frage, ob sie eine gute Mutter sein wird, die Frage, ob ihr Kind gesund sein wird, aber auch die Frage, ob sie es stillen möchte und die Frage, wie sie das Kinderzimmer einrichten soll.
Die Frage, ob sie nach der Geburt eine psychische Erkrankung bekommen könnte, stellt sie sich meist nicht.
Obwohl postpartale (lat.: post partus = nach der Niederkunft) psychische Erkrankungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen bei Frauen vor dem Klimakterium (Wechseljahre) gehören, werden sie in der deutschsprachigen Literatur, insbesondere in vielen Büchern über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, häufig gar nicht erwähnt oder nur kurz angeschnitten (vgl. Sauer, B. 1993, S. 4).
Deshalb wissen die meisten werdenden und jungen Mütter allenfalls, dass viele Frauen nach der Geburt einige Tage niedergeschlagen sein können und in dieser Zeit viel weinen; diese postpartale Dysphorie (griech.: dysphorein = traurig sein), die umgangssprachlich meist als „Heultage“ oder „Babyblues“ bezeichnet wird, ist nicht behandlungsbedürftig.
Die postpartale Depression, die Puerperalpsychose (lat.: puerperium = Kindbett, Niederkunft, Geburt) und weitere, nicht ganz so häufig auftretende psychische Erkrankungen hingegen sollten therapiert werden; nicht nur wegen ihrer Auswirkungen auf die Mutter, sondern auch wegen ihrer Folgen für das Kind.
Das Unwissen über postpartale psychische Erkrankungen hat zur Folge, dass betroffene Frauen und auch ihre Partner, ihre Familie und ihre Freunde nicht wissen, unter welcher Erkrankung sie leiden und an wen sie sich wenden können, um fachkundige Hilfe zu erhalten.
Aus meiner Erfahrung heraus haben sich viele Pädagogen bisher mit diesem Thema nicht oder kaum beschäftigt; dabei fällt die Beratung und Therapie postpartal psychisch erkrankter Frauen und ihrer Kinder durchaus in deren Arbeitsfeld.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt darin, nicht nur die Folgen, die sich für die erkrankte Frau ergeben, sondern auch die Folgen für ihr Kind und die Mutter-Kind-Beziehung darzustellen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie alle Beteiligten trotz der Belastung durch die Erkrankung eine positive Beziehung zueinander und zu sich selbst aufbauen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biologische, soziale und psychische Veränderungen durch den Übergang zur Mutterschaft
- 2.1. Biologische Veränderungen
- 2.1.1. Schwangerschaft
- 2.1.2. Geburt
- 2.1.3. Wochenbett
- 2.2. Soziale und psychische Veränderungen
- 2.2.1. Partnerschaft
- 2.2.2. Freundschaften und Bekanntschaften
- 2.2.3. Mutter-Kind-Beziehung
- 2.2.4. Beziehung zu den eigenen Eltern
- 2.2.5. Identität als Mutter
- 2.2.6. Verlusterfahrungen
- 2.3. Prozessmodell nach Gloger-Tippelt
- 2.1. Biologische Veränderungen
- 3. Postpartale Dysphorie
- 3.1. Symptomatik, Verlauf und Häufigkeit
- 3.2. Ursachenforschung
- 3.3. Therapie
- 3.4. Ein Fall von postpartaler Dysphorie
- 4. Postpartale psychische Erkrankungen
- 4.1. Postpartale Depression
- 4.1.1. Definition und Symptomatik
- 4.1.2. Häufigkeit
- 4.1.3. Verlauf
- 4.1.4. Ursachenforschung
- 4.1.5. Ein Fall von postpartaler Depression
- 4.2. Puerperalpsychose
- 4.2.1. Definition und Symptomatik
- 4.2.2. Häufigkeit
- 4.2.3. Verlauf
- 4.2.4. Ursachenforschung
- 4.2.5. Ein Fall von Puerperalpsychose
- 4.3. Andere postpartale psychische Erkrankungen
- 4.3.1. Postpartale Angststörung
- 4.3.2. Postpartale Panikstörung
- 4.3.3. Postpartale Zwangsstörung
- 4.3.4. Postpartale posttraumatische Belastungsstörung
- 4.3.5. Mutter-Kind-Beziehungsstörungen
- 4.4. Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung
- 4.4.1. Mutter-Kind-Interaktion während der postpartalen Erkrankung
- 4.4.2. Langzeitfolgen
- 4.1. Postpartale Depression
- 5. Therapeutische Möglichkeiten in der Betreuung postpartal psychisch erkrankter Frauen unter dem besonderen Aspekt der Mutter-Kind-Beziehung
- 5.1. Somatotherapie
- 5.1.1. Psychopharmakotherapie
- 5.1.1.1. Übersicht über die wichtigsten Gruppen
- 5.1.1.2. Psychopharmakotherapie während der Stillzeit
- 5.1.1.3. Einfluss der Psychopharmakotherapie auf die Mutter-Kind-Beziehung
- 5.1.2. Hormontherapie
- 5.1.1. Psychopharmakotherapie
- 5.2. Psychotherapie
- 5.2.1. Analytische Psychotherapie
- 5.2.2. Tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie
- 5.2.3. Klientenzentrierte Gesprächstherapie
- 5.2.4. Verhaltenstherapie
- 5.2.5. Gruppentherapie
- 5.2.6. Einfluss der Psychotherapie auf die Mutter-Kind-Beziehung
- 5.3. Mutter-Kind-Therapie
- 5.3.1. Therapiekonzept und Verlauf
- 5.3.2. Einfluss der Mutter-Kind-Therapie auf die Mutter-Kind-Beziehung
- 5.4. Multimodulare Therapie
- 5.4.1. Ambulante Therapie
- 5.4.2. Teilstationäre Therapie
- 5.4.3. Stationäre Therapie ohne Mitaufnahme des Kindes
- 5.4.4. Mutter-Kind-Einheiten
- 5.4.4.1. Ausstattung
- 5.4.4.2. Pädagogische und psychotherapeutische Einwirkungen
- 5.4.4.3. Sicherheit
- 5.4.4.4. Vorteile der Mutter-Kind-Einheiten
- 5.4.4.5. Beispiel für den Therapieverlauf in einer Mutter-Kind-Einheit
- 5.1. Somatotherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert postpartale psychische Erkrankungen und deren therapeutische Möglichkeiten, wobei der Fokus auf der Mutter-Kind-Beziehung liegt. Sie soll ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse von Müttern nach der Geburt schaffen und Wege zur optimalen Unterstützung aufzeigen.
- Biologische und psychosoziale Veränderungen im Zusammenhang mit dem Übergang zur Mutterschaft
- Häufigkeit, Ursachen und Auswirkungen verschiedener postpartaler psychischer Erkrankungen
- Mögliche Folgen postpartaler psychischer Erkrankungen für die Mutter-Kind-Beziehung
- Therapiemöglichkeiten für postpartal psychisch erkrankte Frauen unter Berücksichtigung der Mutter-Kind-Beziehung
- Das Konzept der Mutter-Kind-Einheiten als unterstützende Maßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Relevanz des Themas postpartaler psychischer Erkrankungen und den Mangel an Aufklärung darüber. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den biologischen, sozialen und psychischen Veränderungen, die Frauen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett erleben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Veränderungen in der Mutter-Kind-Beziehung.
Kapitel 3 widmet sich der postpartalen Dysphorie und beleuchtet ihre Symptomatik, den Verlauf, Ursachenforschung und therapeutische Möglichkeiten. Es enthält auch ein Beispiel eines Falles von postpartaler Dysphorie. Kapitel 4 befasst sich mit postpartalen psychischen Erkrankungen wie Depression, Puerperalpsychose sowie Angst-, Panik- und Zwangsstörungen.
Dieses Kapitel zeigt die Auswirkungen dieser Erkrankungen auf die Mutter-Kind-Beziehung und gibt Einblicke in die Mutter-Kind-Interaktion während der Erkrankung. Kapitel 5 diskutiert verschiedene therapeutische Möglichkeiten für postpartal psychisch erkrankte Frauen, darunter Somatotherapie, Psychotherapie und Mutter-Kind-Therapie. Es beleuchtet auch die Rolle von multimodularen Therapieformen und die Bedeutung von Mutter-Kind-Einheiten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Postpartale psychische Erkrankungen, postpartale Dysphorie, postpartale Depression, Puerperalpsychose, Mutter-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Interaktion, Therapiemöglichkeiten, Mutter-Kind-Einheiten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter postpartaler Dysphorie?
Die postpartale Dysphorie, oft als „Babyblues“ oder „Heultage“ bezeichnet, tritt kurz nach der Geburt auf. Sie ist durch vorübergehende Niedergeschlagenheit und Weinen gekennzeichnet, gilt jedoch nicht als behandlungsbedürftige Erkrankung.
Welche schwerwiegenden psychischen Erkrankungen können nach einer Geburt auftreten?
Zu den ernsthafteren Erkrankungen zählen die postpartale Depression, die Puerperalpsychose sowie Angst-, Panik- und Zwangsstörungen, die fachkundige therapeutische Hilfe erfordern.
Welchen Einfluss haben diese Erkrankungen auf die Mutter-Kind-Beziehung?
Die Erkrankungen können die Interaktion zwischen Mutter und Kind erheblich stören und langfristige Folgen für die Bindung und die Entwicklung des Kindes haben, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden.
Was sind Mutter-Kind-Einheiten in der Therapie?
Mutter-Kind-Einheiten sind spezielle stationäre Einrichtungen, in denen die erkrankte Mutter gemeinsam mit ihrem Kind aufgenommen wird. Dies ermöglicht eine Therapie, die die Mutter-Kind-Beziehung direkt miteinbezieht und schützt.
Können Psychopharmaka während der Stillzeit eingenommen werden?
Ja, es gibt Möglichkeiten der Psychopharmakotherapie während der Stillzeit. Eine genaue Abwägung durch Fachärzte ist jedoch notwendig, um den Einfluss auf das Kind und die Mutter-Kind-Beziehung zu kontrollieren.
Welche Rolle spielen pädagogische Fachkräfte bei postpartalen Erkrankungen?
Pädagogen können in der Beratung und Therapie eine wichtige Rolle einnehmen, indem sie betroffene Frauen unterstützen und dabei helfen, trotz der Belastung eine positive Beziehung zum Kind aufzubauen.
- Arbeit zitieren
- Ute Dohmen (Autor:in), 2004, Postpartale psychische Erkrankungen und ihre therapeutischen Möglichkeiten unter dem besonderen Aspekt der Mutter-Kind-Beziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41553