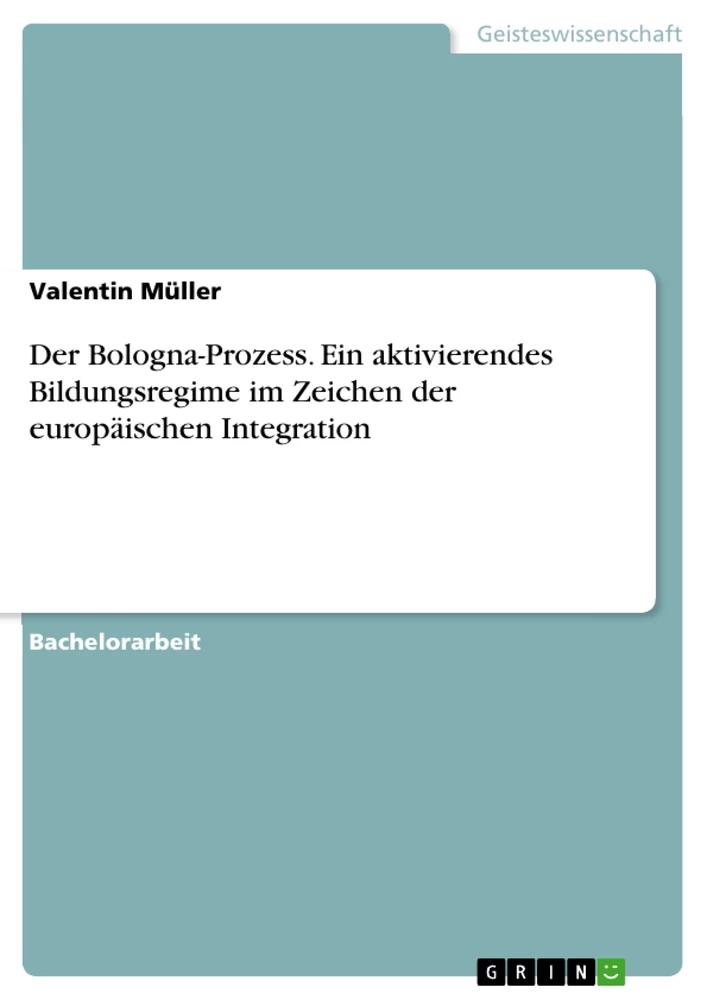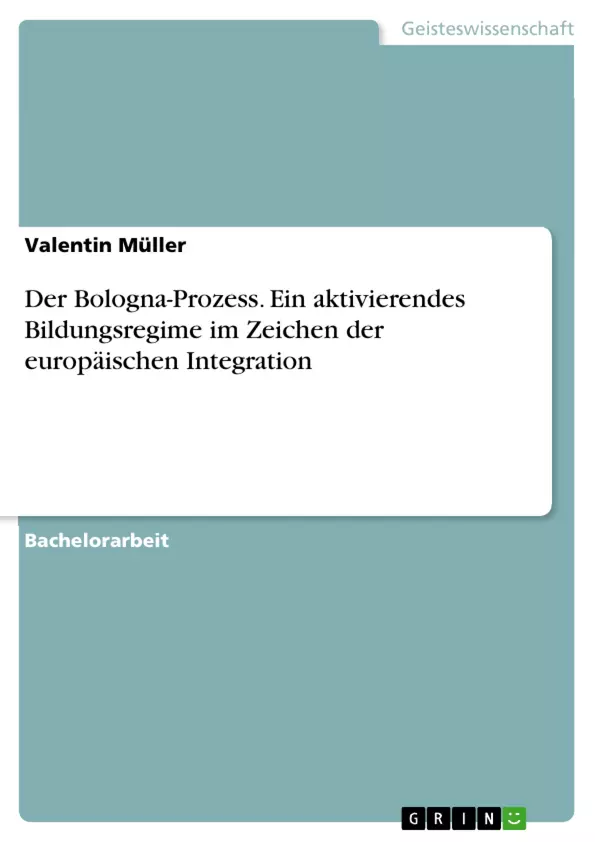Die Umstellung auf „unternehmerische Universitäten“ beschreibt eine Veränderung des Hochschulwesens hin zu einem System permanenter Anpassung an ökonomische Erfordernisse, die mit der wirtschaftlichen Annäherung zum zentralen Thema gesamteuropäischer Politik erhoben worden sind. Auf eine nie zuvor dagewesene Weise ist Hochschulbildung damit in den gesellschaftlichen Produktionsprozess eingebunden.
Alle vorangegangenen Auseinandersetzungen um den Stellenwert von Wissenschaft und Universität werden von den Reformen des „Bologna-Prozesses“ überschattet. Dabei stellt sich die Frage, wie innerhalb weniger Jahre ein politisches Aktionsprogramm eine derartige Wirkung entfalten konnte.
Im Folgenden wird die These vertreten, dass die „unternehmerische“ Universität dem politisch-normativen Leitbild der „Aktivierung“ folgt, das seit den 90er Jahren die Richtung der Sozial- und Bildungspolitik in Europa vorgibt. Indem es die Frage nach der Verwertbarkeit und Legitimität von Wissenschaft von der politischen auf eine subjektive Ebene transportiert, hat es maßgeblich dazu beigetragen, den „europäischen Hochschulraum“ als ein Regime aktivierender Selbstverwaltung neu zu erschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Universität und Arbeitsmarkt – (k)eine Wahlverwandtschaft
- 2.1. Neuhumanismus als Leitbild der europäischen Universitätsmodelle.
- 2.2. Motoren der Bildungsexpansion: Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit...
- 2.3. Der ,,aktivierende Staat“ als „Europäisches Sozialmodell“.
- 3. Europäische Hochschulpolitik zwischen Intergouvernementalismus
und Supranationalität
- 3.1. Agenda-Setting.
- 3.2. Startschuss: Die,,Sorbonne-Deklaration“.
- 3.3. Bologna und die Folgekonferenzen......
- 4. Vom Selbstzweck zur Selbstverantwortung: Hochschulbildung im „aktivierenden Staat“
- 4.1. Latente Funktionen der Hochschulreform.........
- 4.2. Humboldts Alptraum.
- 5. Zusammenfassung/Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel, den Bologna-Prozess als ein „aktivierendes Bildungsregime“ im Zeichen der europäischen Integration zu untersuchen. Sie analysiert die Veränderungen, die der Bologna-Prozess im europäischen Hochschulsystem bewirkt hat, und hinterfragt die Folgen dieser Veränderungen für die Rolle der Universität in der Gesellschaft.
- Der Bologna-Prozess und die „aktivierende“ Bildungspolitik in Europa
- Die Transformation des Hochschulsystems: Von der „alten“ Universität zur „unternehmerischen“ Universität
- Die Folgen der Bologna-Reform für die Wissenschaft, Forschung und Lehre
- Die Rolle der Universität in der europäischen Integration
- Die Herausforderungen des Bologna-Prozesses für die Zukunft der Universität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema der Arbeit und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Es wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der europäischen Universität gegeben und die Bedeutung der „aktivierenden“ Bildungspolitik im Kontext der europäischen Integration beleuchtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Universität und Arbeitsmarkt. Es wird auf den Einfluss des Neuhumanismus auf die europäischen Universitätsmodelle eingegangen, die Bildungsexpansion im Zeichen von Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit erläutert und die Rolle des „aktivierenden Staates“ als „Europäisches Sozialmodell“ beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die europäische Hochschulpolitik im Spannungsfeld zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalität. Es werden die Entstehung und Entwicklung des Bologna-Prozesses betrachtet, von der Agenda-Setting-Phase über die „Sorbonne-Deklaration“ bis hin zu den Folgekonferenzen.
Das vierte Kapitel untersucht die Folgen des Bologna-Prozesses für die Hochschulbildung im „aktivierenden Staat“. Es werden die latenten Funktionen der Hochschulreform beleuchtet und die Auswirkungen auf die Forschung und Lehre analysiert.
Schlüsselwörter
Bologna-Prozess, Aktivierende Bildungspolitik, Europäische Integration, Hochschulreform, Unternehmerische Universität, Neuhumanismus, Bildungsexpansion, Chancengleichheit, Wettbewerbsfähigkeit, Europäisches Sozialmodell, Intergouvernementalismus, Supranationalität, Agenda-Setting, Sorbonne-Deklaration, Wissenschaft, Forschung, Lehre, Selbstverantwortung, Latente Funktionen, Humboldts Alptraum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Bologna-Prozesses?
Ziel ist die Schaffung eines harmonisierten europäischen Hochschulraums durch vergleichbare Abschlüsse (Bachelor/Master) und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Was bedeutet der Begriff "unternehmerische Universität"?
Es beschreibt den Wandel von Hochschulen hin zu Systemen, die sich permanent an ökonomische Erfordernisse und die Verwertbarkeit von Wissen anpassen.
Wie verändert das Leitbild der "Aktivierung" die Bildung?
Bildung wird stärker als individuelle Selbstverantwortung zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit gesehen, statt als reiner Selbstzweck.
Was war die Sorbonne-Deklaration?
Sie gilt als Startschuss für die Harmonisierung der europäischen Hochschulpolitik und bereitete den eigentlichen Bologna-Prozess vor.
Was ist mit "Humboldts Alptraum" gemeint?
Es bezeichnet die Kritik, dass das idealistische Bildungsideal von Wilhelm von Humboldt durch die ökonomische Ausrichtung und Verschulung der Lehre verloren geht.
- Arbeit zitieren
- B.A. Valentin Müller (Autor:in), 2016, Der Bologna-Prozess. Ein aktivierendes Bildungsregime im Zeichen der europäischen Integration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415968