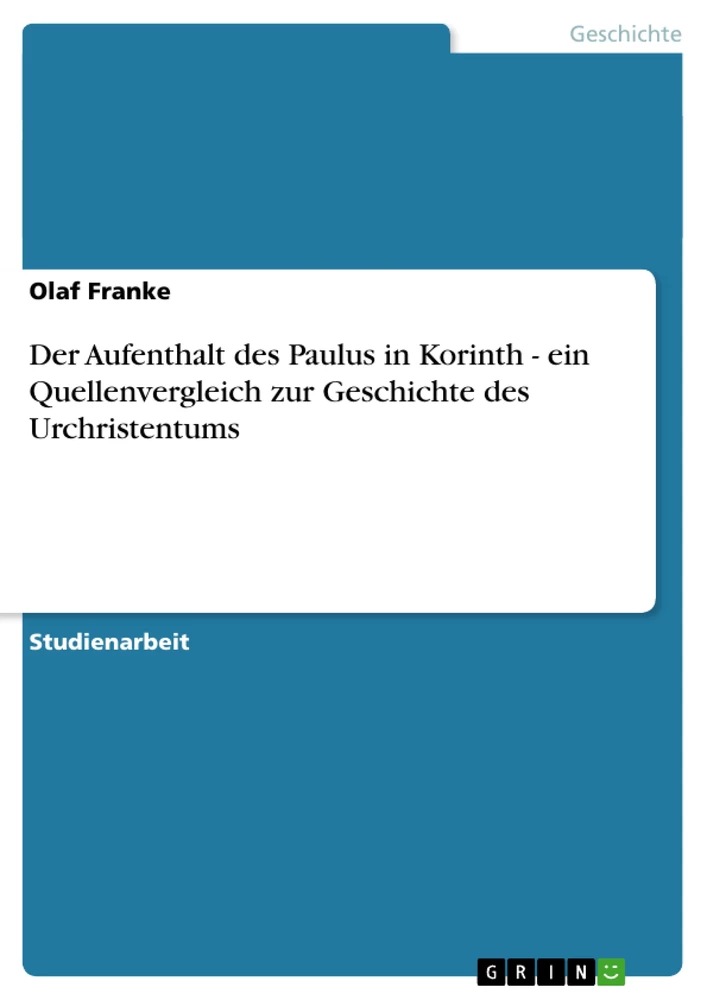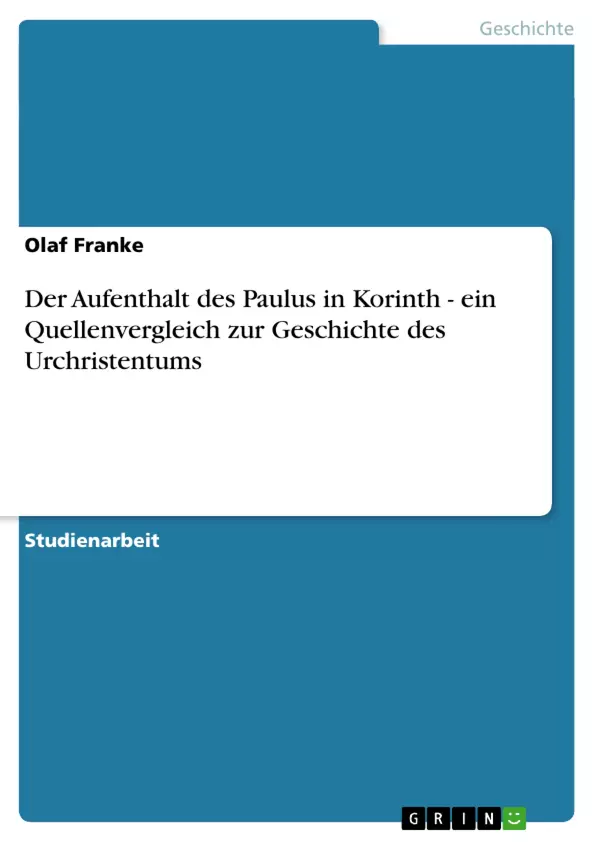Der Aufenthalt des Paulus in Korinth bietet die einzige Möglichkeit für eine sichere chronologische Rekonstruktion der Geschichte des Urchristentums.
In den Evangelien und Briefen des Neuen Testaments finden sich nur selten Angaben, die eine genauere Datierung der geschilderten Ereignisse zulassen. Das gilt auch für Lukas, den Geschichtsschreiber unter den Autoren des Neuen Testaments.
Doch im 18. Kapitel seiner Apostelgeschichte werden zwei Ereignisse erwähnt, die sich durch außerbiblische Quellen verifizieren lassen. Damit kann der ebenfalls in ApG 18 beschriebene Aufenthalt des Paulus datiert werden und erlaubt somit eine Berechnung einer absoluten Chronologie nicht nur für die Paulus-Vita, sondern für die Geschichte des Urchristentums überhaupt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Lukas, Apostelgeschichte 18, 2+12
- 2.1.1 Der Autor und sein Werk
- 2.1.2 Historischer Hintergrund
- 2.1.2.1 Gliederung des Textes
- 2.1.2.2 Die Quelle
- 2.1.2.3 Die Darstellung des Lukas
- 2.1.2.4 Fazit
- 2.2 Das Claudius Edikt
- 2.2.1 Einleitung
- 2.2.2 Sueton, Claudius 25,4
- 2.2.2.1 Der Autor und sein Werk
- 2.2.2.2 Die Quelle
- 2.2.2.3 Fazit
- 2.2.3 Orosius, Adversus Paganos VII, 6, 15-16
- 2.2.3.1 Der Autor und sein Werk
- 2.2.3.2 Die Quelle
- 2.2.3.3 Fazit
- 2.2.4 Cassius Dio, Historia 60,6
- 2.2.4.1 Der Autor und sein Werk
- 2.2.4.2 Die Quelle
- 2.2.4.3 Fazit
- 2.2.5 Exkurs 1: Das Schweigen des Tacitus
- 2.2.6 Zusammenfassung und Ausblick
- 2.2.7 Exkurs 2: Wurden alle Juden aus Rom ausgewiesen?
- 2.3 Die Gallio-Inschrift
- 2.3.1 Einleitung
- 2.3.1.1 Lucius Junius Gallio Annaeanus
- 2.3.2 Chronologische Fragen
- 2.3.2.1 Wann hat Gallio sein Amt angetreten?
- 2.3.2.2 Hat Gallio sein Amt vorzeitig abgebrochen?
- 2.3.2.3 Gab es ein zweites Prokonsulat Gallios?
- 2.3.1 Einleitung
- 2.4 Die Datierung des Prozesses vor Gallio
- 2.4.1 Fazit
- 2.4.2 Ausblick auf die weitere paulinische Chronologie
- 2.1 Lukas, Apostelgeschichte 18, 2+12
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Datierung des Aufenthalts des Paulus in Korinth anhand eines Quellenvergleichs zu präzisieren und die Glaubwürdigkeit der Angaben des Lukas in der Apostelgeschichte zu überprüfen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Verifizierung von Lukas' Bericht durch außerbiblische Quellen.
- Die Überprüfung der Angaben des Lukas in der Apostelgeschichte 18 hinsichtlich der Datierung des Paulusaufenthalts in Korinth.
- Der Vergleich der Angaben des Lukas mit den Informationen aus den außerbiblischen Quellen (Sueton, Cassius Dio, Orosius).
- Die Analyse des Claudius-Edikts und seiner Bedeutung für die Datierung.
- Die Untersuchung der Gallio-Inschrift und ihrer chronologischen Bedeutung.
- Die Erörterung der Glaubwürdigkeit der verschiedenen Quellen.
Zusammenfassung der Kapitel
2.1 Lukas, Apostelgeschichte 18, 2+12: Dieses Kapitel analysiert Lukas' Bericht in Apostelgeschichte 18 über den Aufenthalt des Paulus in Korinth. Es untersucht den Kontext des Edikts von Kaiser Claudius, das die Vertreibung der Juden aus Rom anordnete, und dessen Bedeutung für die Datierung des Paulusaufenthaltes. Der Fokus liegt auf der Auswertung von Lukas' Darstellung und deren Vergleichbarkeit mit externen Quellen. Der Abschnitt beleuchtet die Einbettung des Ereignisses in die Gesamtchronologie der Apostelgeschichte und die damit verbundenen methodischen Herausforderungen der Quellenkritik.
2.2 Das Claudius Edikt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem in der Apostelgeschichte erwähnten Edikt von Kaiser Claudius, welches die Juden aus Rom verbannte. Es analysiert die Berichte von Sueton, Cassius Dio und Orosius über dieses Edikt, wobei die jeweiligen Autoren, ihre Werke und die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben detailliert untersucht werden. Der Vergleich der verschiedenen Darstellungen zielt darauf ab, ein genaueres Verständnis des historischen Kontextes und der Auswirkungen des Edikts auf die frühe christliche Gemeinde zu gewinnen. Die Kapitel untersuchen kritisch die Übereinstimmung und Diskrepanzen zwischen den Quellen, um ein möglichst präzises Bild zu erhalten.
2.3 Die Gallio-Inschrift: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Gallio-Inschrift als wichtiger Quelle für die Datierung des Paulusprozesses in Korinth. Die Inschrift liefert Informationen über die Amtszeit des Prokonsuls Gallio in Achaia. Das Kapitel untersucht die chronologischen Aspekte der Inschrift und beleuchtet die damit verbundenen Fragen zur genauen Dauer und zum Zeitpunkt von Gallios Prokonsulat. Darüber hinaus werden ergänzende Informationen aus den Schriften von Senecas und Plinius einbezogen und deren Relevanz für die Datierungsfrage diskutiert. Die verschiedenen Interpretationen der Inschrift werden kritisch gewürdigt und miteinander abgeglichen.
2.4 Die Datierung des Prozesses vor Gallio: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Analysen zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Datierung des Prozesses des Paulus vor Gallio. Es diskutiert die Bedeutung der verschiedenen Quellen und deren jeweilige Stärken und Schwächen für die historische Rekonstruktion. Die Kapitel bietet einen Ausblick auf die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse für die weitere Erforschung der paulinischen Chronologie und geht auf die methodischen Schwierigkeiten und Grenzen der Datierung ein.
Schlüsselwörter
Paulus, Korinth, Apostelgeschichte, Claudius-Edikt, Gallio-Inschrift, Urchristentum, Chronologie, Quellenkritik, Achaia, Sueton, Cassius Dio, Orosius, Datierung, Prokonsulat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Datierung des Paulusaufenthalts in Korinth
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich mit der Datierung des Aufenthalts des Apostels Paulus in Korinth. Er analysiert verschiedene historische Quellen, um die Angaben des Lukas in der Apostelgeschichte zu überprüfen und zu präzisieren.
Welche Quellen werden im Text untersucht?
Der Text analysiert vor allem die Apostelgeschichte (Lukas), das Claudius-Edikt (berichtet von Sueton, Cassius Dio und Orosius) und die Gallio-Inschrift. Zusätzlich werden die Werke von Seneca und Plinius erwähnt.
Was ist das Ziel der Textanalyse?
Das Hauptziel ist die präzisere Datierung des Paulusaufenthalts in Korinth durch einen detaillierten Quellenvergleich und die Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Angaben des Lukas in der Apostelgeschichte. Es geht darum, die Angaben des Lukas mit außerbiblischen Quellen zu verifizieren.
Welche Aspekte des Claudius-Edikts werden behandelt?
Der Text untersucht die Berichte von Sueton, Cassius Dio und Orosius über das Edikt des Kaisers Claudius, welches die Vertreibung der Juden aus Rom anordnete. Analysiert werden die Autoren, ihre Werke, die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen und der Vergleich der verschiedenen Darstellungen, um ein genaueres Verständnis des historischen Kontextes zu erhalten.
Welche Rolle spielt die Gallio-Inschrift?
Die Gallio-Inschrift liefert wichtige Informationen zur Datierung des Prozesses von Paulus in Korinth, da sie Auskunft über die Amtszeit des Prokonsuls Gallio in Achaia gibt. Der Text analysiert die chronologischen Aspekte der Inschrift und diskutiert verschiedene Interpretationen.
Wie wird die Glaubwürdigkeit der Quellen bewertet?
Der Text bewertet die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Quellen durch eine kritische Analyse der Autoren, ihrer Werke und ihrer jeweiligen Aussagen. Er vergleicht die übereinstimmenden und abweichenden Informationen, um ein möglichst präzises Bild zu erstellen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in Kapitel zu Lukas' Bericht in der Apostelgeschichte (Kapitel 2.1), dem Claudius-Edikt (Kapitel 2.2), der Gallio-Inschrift (Kapitel 2.3) und der Datierung des Prozesses vor Gallio (Kapitel 2.4).
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text fasst die Ergebnisse der Quellenanalysen zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Datierung des Prozesses von Paulus vor Gallio. Er diskutiert die Stärken und Schwächen der verschiedenen Quellen und bietet einen Ausblick auf die weitere Erforschung der paulinischen Chronologie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Paulus, Korinth, Apostelgeschichte, Claudius-Edikt, Gallio-Inschrift, Urchristentum, Chronologie, Quellenkritik, Achaia, Sueton, Cassius Dio, Orosius, Datierung, Prokonsulat.
- Citar trabajo
- Olaf Franke (Autor), 2004, Der Aufenthalt des Paulus in Korinth - ein Quellenvergleich zur Geschichte des Urchristentums, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41605