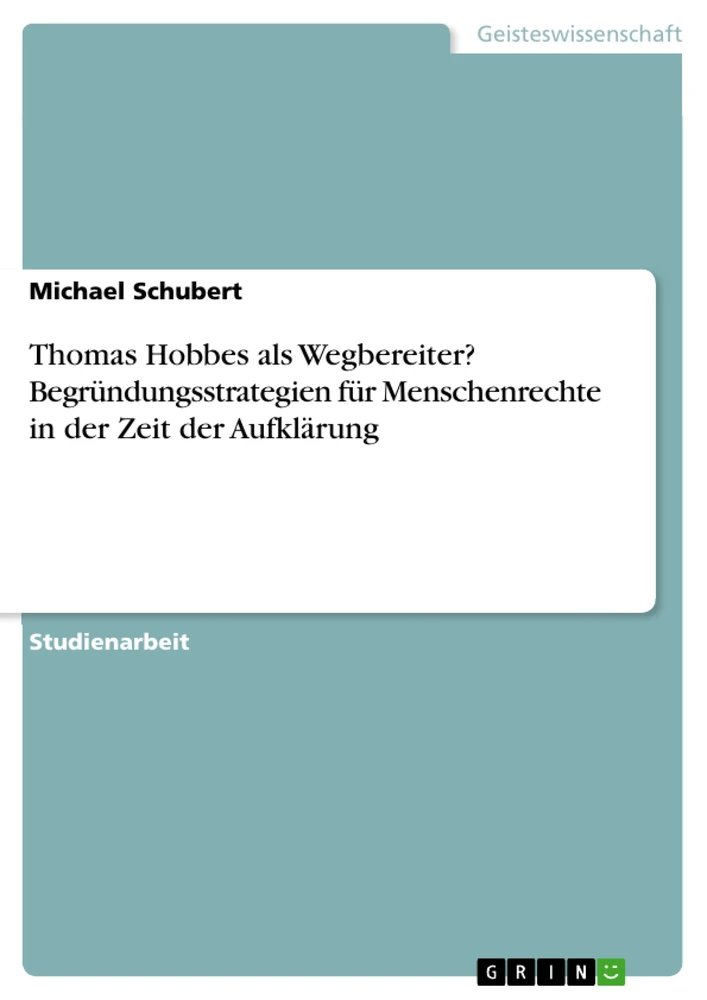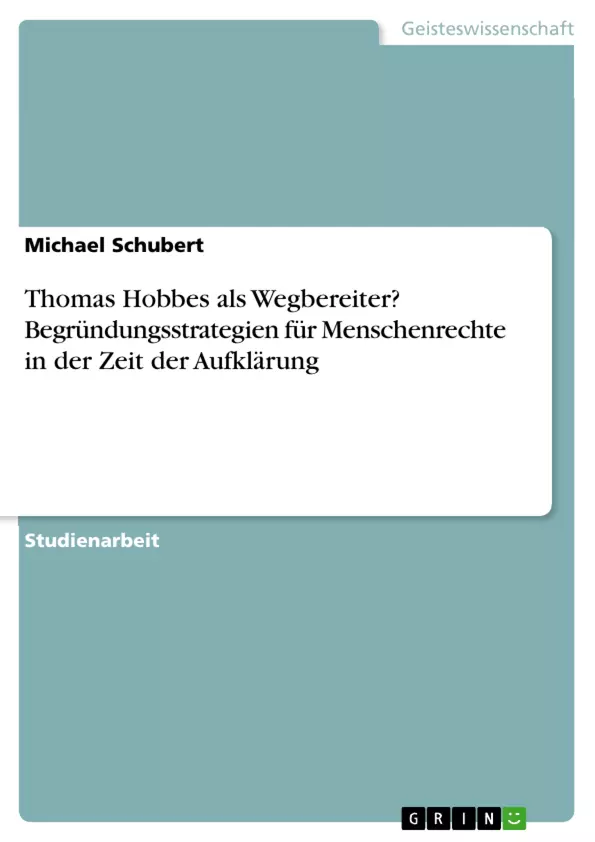Am 10. Dezember 1948 wurde in Paris die UN-Menschenrechtscharta verabschiedet. Sie zählt zu den größten Errungenschaften der Vereinten Nationen, da sie erstmals in der Geschichte einen international geschützten Code an Menschenrechten liefert. Doch erst in der Zeit der europäischen Aufklärung wurden unveräußerliche, unteilbare und universell geltende Menschenrechte für eine breite Öffentlichkeit formuliert. Die Begründung geht auf die Philosophen Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant zurück.
Diese Arbeit versteht sich als ein Beitrag zum Verständnis von Thomas Hobbes' Philosophie und Staatstheorie. Der Schwerpunkt liegt auf Hobbes' Rolle im Entwicklungsprozess des Menschenrechtsdenkens. Er lieferte hierzu systematische Grundlagen. Diese Arbeit wird jene Grundlagen erläutern, seine Theorie einordnen und dem Leser die wichtigsten Beiträge der Menschenrechtsentwicklung vorstellen. Die zentrale Analysefrage lautet: War Thomas Hobbes ein Wegbereiter für das moderne Menschenrechtsdenken? In diesem Zusammenhang werden politischen und anthropologischen Positionen beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG:
- 1.1 Hintergrund:
- 1.2 Erkenntnisinteresse und Vorgehensweise:
- II. DIE MENSCHENRECHTE:
- 2.1 Die Entwicklung der Menschenrechtsidee:
- 2.2 Merkmale von Menschenrechten:
- III. DIE BEGRÜNDUNG DER MENSCHENRECHTE IN DER AUFKLÄRUNG:
- 3.1 Thomas Hobbes: „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“.
- 3.2 John Locke: Freiheit, Gleicheit, Eigentum
- 3.3 Jean-Jacques Rousseau: Freiheit und Gemeinwille.
- 3.4 Immanuel Kant: Selbstzweck und Freiheit........
- IV. ZUSAMMENFASSUNG: WAR THOMAS HOBBES EIN WEGBEREITER?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle von Thomas Hobbes im Entwicklungsprozess des Menschenrechtsdenkens während der Aufklärung. Sie beleuchtet seine systematischen Grundlagen, ordnet seine Theorie ein und präsentiert die wichtigsten Beiträge der Menschenrechtsentwicklung. Die zentrale Frage ist, ob Hobbes als Wegbereiter für das moderne Menschenrechtsdenken betrachtet werden kann.
- Die Entwicklung der Menschenrechtsidee und ihre Ursprünge in der Antike.
- Die Merkmale von Menschenrechten, einschließlich ihrer Abwehrrechte gegen den Staat.
- Die Begründungsversuche der Menschenrechte in der Aufklärung durch Hobbes, Locke, Rousseau und Kant.
- Die Analyse der politischen und anthropologischen Positionen von Thomas Hobbes.
- Die Bewertung der Bedeutung von Hobbes' Philosophie für die Entwicklung des modernen Menschenrechtsdenkens.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1.1 stellt den historischen Hintergrund der Menschenrechtscharta dar und beschreibt die Bedeutung der Aufklärung für die Entwicklung der Menschenrechtsidee. Kapitel 1.2 erläutert das Erkenntnisinteresse der Arbeit und skizziert die Vorgehensweise der Analyse.
Kapitel 2.1 beschreibt die Entwicklung der Menschenrechtsidee von der Antike bis zur europäischen Aufklärung. Kapitel 2.2 definiert den Begriff der Menschenrechte und benennt ihre wichtigsten Merkmale.
Kapitel 3.1 beleuchtet die politische Philosophie von Thomas Hobbes und seine These vom Naturzustand. Kapitel 3.2 untersucht die Freiheits- und Eigentumsrechte, die John Locke in seiner Philosophie formuliert. Kapitel 3.3 analysiert Jean-Jacques Rousseaus Konzept des Gemeinwillens und seine Gedanken zur Freiheit. Kapitel 3.4 untersucht Immanuel Kants Begründungsversuche der Menschenrechte aus der Perspektive des Selbstzwecks und der Freiheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Menschenrechte, Aufklärung, Naturrecht, Kontraktualismus, politische Philosophie, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Herrschaftslegitimation, individualistische Abwehrrechte, Gleichheit, Freiheit, Eigentum, Gemeinwille, Selbstzweck.
Häufig gestellte Fragen
War Thomas Hobbes ein Wegbereiter für Menschenrechte?
Obwohl Hobbes einen starken Staat (Leviathan) forderte, legte er durch seine individualistische Naturrechtstheorie und den Gedanken des Gesellschaftsvertrags wichtige Grundlagen für das spätere Menschenrechtsdenken.
Was bedeutet Hobbes' Satz „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“?
Er beschreibt damit den hypothetischen Naturzustand, in dem ohne staatliche Ordnung ein „Krieg aller gegen alle“ herrscht, da jeder nur nach seinem eigenen Vorteil strebt.
Wie unterschied sich John Lockes Ansatz von Hobbes?
Locke sah im Gegensatz zu Hobbes unveräußerliche Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum bereits im Naturzustand gegeben, die der Staat schützen muss, anstatt sie zu unterdrücken.
Welchen Beitrag leistete Kant zur Menschenrechtsidee?
Kant begründete Menschenrechte durch die Würde des Menschen, der niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Selbstzweck behandelt werden darf.
Was ist der Kern des Kontraktualismus?
Der Kontraktualismus besagt, dass staatliche Herrschaft nur dann legitim ist, wenn sie auf der (hypothetischen) Zustimmung freier und gleicher Individuen durch einen Vertrag basiert.
- Arbeit zitieren
- Michael Schubert (Autor:in), 2018, Thomas Hobbes als Wegbereiter? Begründungsstrategien für Menschenrechte in der Zeit der Aufklärung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416187