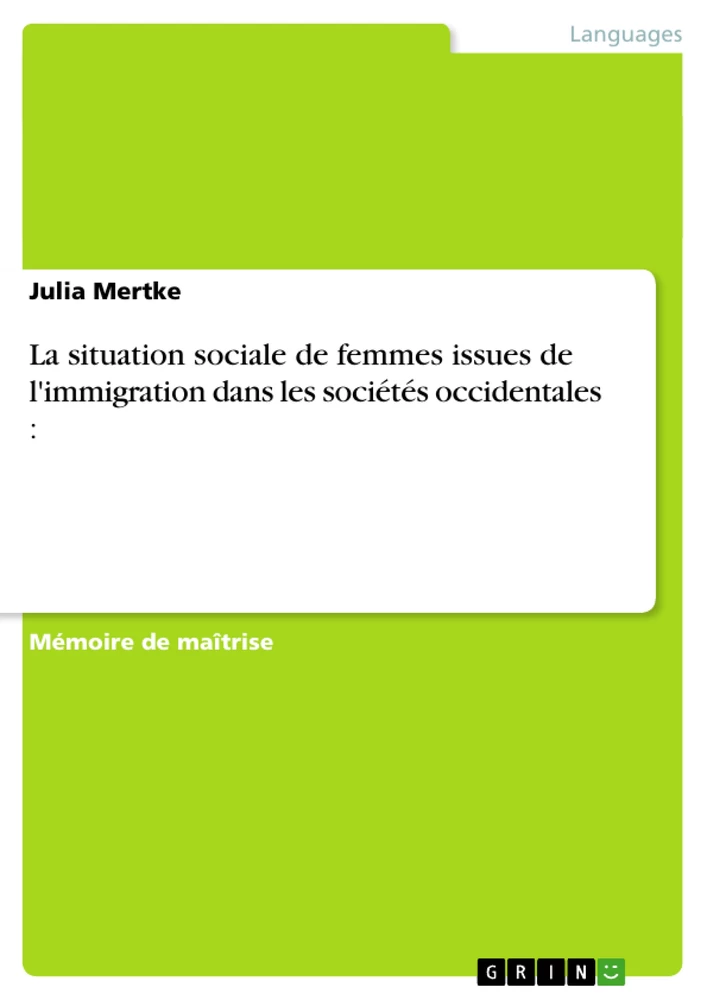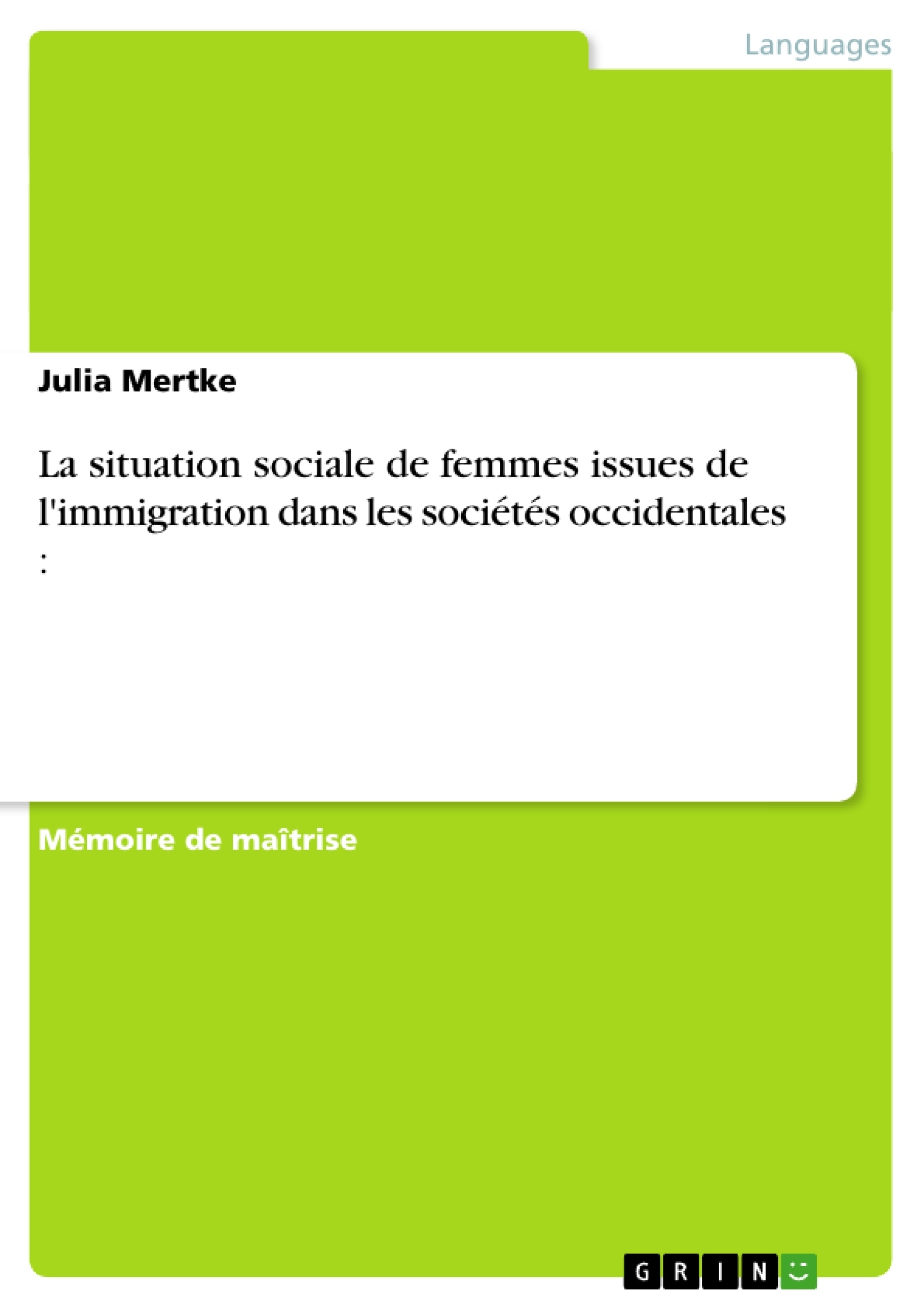«J’ai réussi à dissocier ma personnalité, à faire cohabiter en moi deux personnages opposés:
la Française que je suis, l’Algérienne que mes parents auraient voulu que je sois.»
Cette citation d’Aïcha Benaïssa résume la description du déchirement intérieur qui contribue souvent à la rupture avec la culture d’origine, que font de nombreux auteurs, sociologues, pédagogues et personnages politiques de la situation des jeunes femmes d’origine non européenne, qui ont grandi et qui vivent avec leurs familles dans des pays occidentaux.
Dans ce travail sera étudiée la vie quotidienne de femmes d’origine maghrébine en France et d’origine turque en Allemagne, afin de savoir à quel point leur situation sociale ressemble à l’image diffusée par les médias. La fille soumise, enfermée à la maison et privée des droits dont jouissent ses semblables européennes, constitue-t-elle la règle ou existe-t-il des jeunes femmes sûres d’elles qui ont trouvé pour elles-mêmes une vie satisfaisante avec les deux cultures qui les entourent, et qui voient leur double contexte culturel comme enrichissement ?
Avec ce travail, je voudrais essayer de donner une réponse aux questions suivantes : les jeunes femmes vivent-elles leur situation particulière d’une socialisation marquée par deux cultures et comment définissent-elles leur propre statut dans cette situation ?
Parmi l’ensemble des immigrés de nationalités différentes en Allemagne et en France, les Turcs, ainsi que les Maghrébins, c’est-à-dire des personnes d’origine algérienne, marocaine et tunisienne, jouent un rôle important et ils sont les plus concernés par cette discussion autour du conflit culturel causé par leur origine non européenne et leur religion non chrétienne. De plus, ils représentent plus ou moins les groupes d’immigrés les plus importants dans ces pays. Bien qu’il y ait évidemment de différents groupes ethniques et culturels dans les pays d’origines, à nommer notamment les Kurdes en Turquie et les Kabyles en Algérie, il est quasiment impossible de les distinguer clairement dans un tel travail, raison pour laquelle ces minorités seront inclues dans les termes “turc“ et “maghrébin“. De plus, l’Algérie sera souvent traitée comme le pays représentatif des trois pays formant le Maghreb à cause de la proportion supérieure des Algériens parmi les Maghrébins vivant en France.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Introduction
- 2. Terminologie
- 2.1. Definitionen
- 2.2. Erklärung der Theorie des Kulturkonflikts
- 3. Geschichte der Einwanderung und allgemeine Informationen
- 3.1. Türken in Deutschland
- 3.2. Maghrebiner in Frankreich
- 4. Immigranten in der Literatur
- 4.1. Immigrantenliteratur in Frankreich und Deutschland
- 4.2. Ausgewählte Autorinnen und Bücher
- 4.2.1. Renan Demirkan und Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker (1991)
- 4.2.2. Fatma B. und Hennamond – Mein Leben zwischen zwei Welten (1999)
- 4.2.3. Djura und Le voile du silence (1990)
- 4.2.4. Aïcha Benaïssa und Née en France – histoire d'une jeune beur (1990)
- 4.3. Der Kulturkonflikt
- 4.4. Schlussfolgerung
- 5. Die aktuelle Situation
- 5.1. Die allgemeine Situation der Familien
- 5.2. Die spezifische Situation der Mädchen
- 5.2.1. Bedeutung der Werte für Eltern und junge Mädchen
- 5.2.2. Selbstbilder, Bilder des Anderen und daraus resultierende Vorurteile
- 5.2.3. Bikulturalismus und Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Situation von Frauen mit maghrebinischem Migrationshintergrund in Frankreich und türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Ziel ist es, die gängigen Medienbilder mit der Realität zu vergleichen und die Lebenserfahrungen dieser Frauen zu beleuchten. Es werden Fragen nach der Bewältigung der biculturellen Sozialisation und der Selbstdefinition in diesem Kontext untersucht.
- Die Auswirkungen des Kulturkonflikts auf junge Frauen mit Migrationshintergrund
- Der Vergleich von Medienbildern und der Realität der Lebensumstände
- Die Rolle der Familie und der traditionellen Werte
- Die Entwicklung der Identität im Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen
- Analyse von autobiografischen Erzählungen als empirische Quelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Introduction: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der sozialen Situation von Frauen mit maghrebinischem (Frankreich) und türkischem (Deutschland) Migrationshintergrund vor. Sie problematisiert die gängigen, oft negativ konnotierten Medienbilder und kündigt den Vergleich mit den Lebensrealitäten an. Die Arbeit fokussiert auf die zweite Generation von Migrantinnen und ihre Bewältigung der biculturellen Sozialisation. Türken und Maghrebiner werden als Schwerpunktgruppen aufgrund ihrer zahlenmäßigen Bedeutung und der Relevanz des Kulturkonflikt-Diskurses ausgewählt. Die Autorin betont die Grenzen empirischer Forschung und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die sowohl autobiografische Texte als auch soziologische Literatur heranzieht.
2. Terminologie: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Kultur“ und beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungsnuancen in der französischen und deutschen Sprache. Es wird auf die Unterscheidung zwischen „Kultur 1“ (Wissen, Kunst, Literatur) und „Kultur 2“ (tägliche Praktiken) eingegangen. Die Bedeutung des Begriffs „Kulturkonflikt“ wird im Kontext der Einwanderung diskutiert.
3. Geschichte der Einwanderung und allgemeine Informationen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Einwanderungsgeschichte in Deutschland und Frankreich, wobei der Fokus auf türkischen Migranten in Deutschland und maghrebinischen Migranten in Frankreich liegt. Es werden allgemeine Informationen zu den jeweiligen Gruppen und den Herausforderungen der Integration bereitgestellt. Die Kapitel behandeln die Besonderheiten der Einwanderung aus der Türkei und dem Maghreb in die jeweiligen Zielländer, inklusive der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
4. Immigranten in der Literatur: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Migrantinnen in der Literatur Frankreichs und Deutschlands. Es werden ausgewählte Autobiografien von türkischen und maghrebinischen Autorinnen vorgestellt, um die individuellen Erfahrungen des Kulturkonflikts zu beleuchten. Die therapeutische Funktion autobiografischen Schreibens wird hervorgehoben. Die Kapitel untersuchen den Konflikt, der innerhalb der Familien und der Gesellschaft entstanden ist, und wie dieser in der Literatur reflektiert wird. Es wird die Entwicklung der literarischen Darstellung über die Jahre betrachtet.
5. Die aktuelle Situation: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle soziale Situation von Familien und insbesondere jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Es analysiert die Bedeutung traditioneller Werte für die Familien und den Einfluss auf das Leben der jungen Frauen. Die Kapitel analysiert die Themen Selbstbild, Vorurteile und den Umgang mit der biculturellen Identität. Es beleuchtet den Einfluss der Familienkultur und der sozialen Umgebung auf die Integration.
Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Kulturkonflikt, biculturelle Sozialisation, Identität, Selbstbild, Integration, Frauen, Türkei, Maghreb, Deutschland, Frankreich, Immigrantenliteratur, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Soziale Situation von Frauen mit Migrationshintergrund in Frankreich und Deutschland
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die soziale Situation von Frauen mit maghrebinischem Migrationshintergrund in Frankreich und türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Sie vergleicht gängige Medienbilder mit der Realität und beleuchtet die Lebenserfahrungen dieser Frauen, insbesondere im Hinblick auf die biculturelle Sozialisation und die Selbstdefinition.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Auswirkungen des Kulturkonflikts auf junge Frauen mit Migrationshintergrund zu analysieren, Medienbilder mit der Realität zu vergleichen, die Rolle der Familie und traditioneller Werte zu untersuchen und die Identitätsentwicklung im Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen zu beleuchten. Autobiografische Erzählungen dienen als empirische Quelle.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des Kulturkonflikts, den Vergleich von Medienbildern und Lebensrealität, die Rolle der Familie und traditioneller Werte, die Identitätsentwicklung im Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen und die Analyse autobiografischer Erzählungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Terminologie, 3. Geschichte der Einwanderung und allgemeine Informationen, 4. Immigranten in der Literatur und 5. Die aktuelle Situation. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird im Kapitel "Terminologie" behandelt?
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Kultur“ und erläutert die unterschiedlichen Bedeutungsnuancen in der französischen und deutschen Sprache. Es wird zwischen „Kultur 1“ (Wissen, Kunst, Literatur) und „Kultur 2“ (tägliche Praktiken) unterschieden und der Begriff „Kulturkonflikt“ im Kontext der Einwanderung diskutiert.
Was wird im Kapitel "Geschichte der Einwanderung" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Einwanderungsgeschichte in Deutschland und Frankreich, fokussiert auf türkische Migranten in Deutschland und maghrebinische Migranten in Frankreich. Es liefert allgemeine Informationen zu den jeweiligen Gruppen und den Herausforderungen der Integration.
Was wird im Kapitel "Immigranten in der Literatur" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Migrantinnen in der Literatur Frankreichs und Deutschlands. Ausgewählte Autobiografien türkischer und maghrebinischer Autorinnen werden vorgestellt, um individuelle Erfahrungen des Kulturkonflikts zu beleuchten. Die therapeutische Funktion autobiografischen Schreibens und die literarische Reflexion des Konflikts innerhalb von Familien und Gesellschaft werden thematisiert.
Was wird im Kapitel "Die aktuelle Situation" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle soziale Situation von Familien und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Es analysiert die Bedeutung traditioneller Werte, Selbstbilder, Vorurteile und den Umgang mit bicultureller Identität sowie den Einfluss von Familienkultur und sozialer Umgebung auf die Integration.
Welche Autorinnen und Bücher werden im Kapitel "Immigranten in der Literatur" behandelt?
Es werden unter anderem die Werke von Renan Demirkan ("Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker"), Fatma B. ("Hennamond – Mein Leben zwischen zwei Welten"), Djura ("Le voile du silence") und Aïcha Benaïssa ("Née en France – histoire d'une jeune beur") vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Migrationshintergrund, Kulturkonflikt, biculturelle Sozialisation, Identität, Selbstbild, Integration, Frauen, Türkei, Maghreb, Deutschland, Frankreich, Immigrantenliteratur, empirische Forschung.
- Citation du texte
- Julia Mertke (Auteur), 2005, La situation sociale de femmes issues de l'immigration dans les sociétés occidentales :, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41624