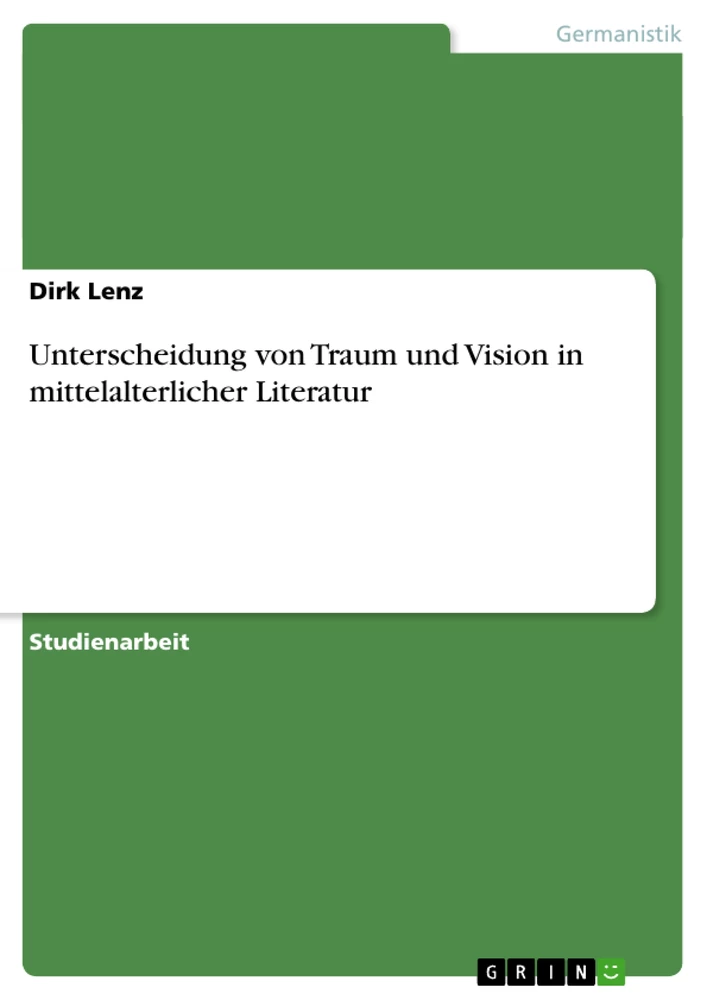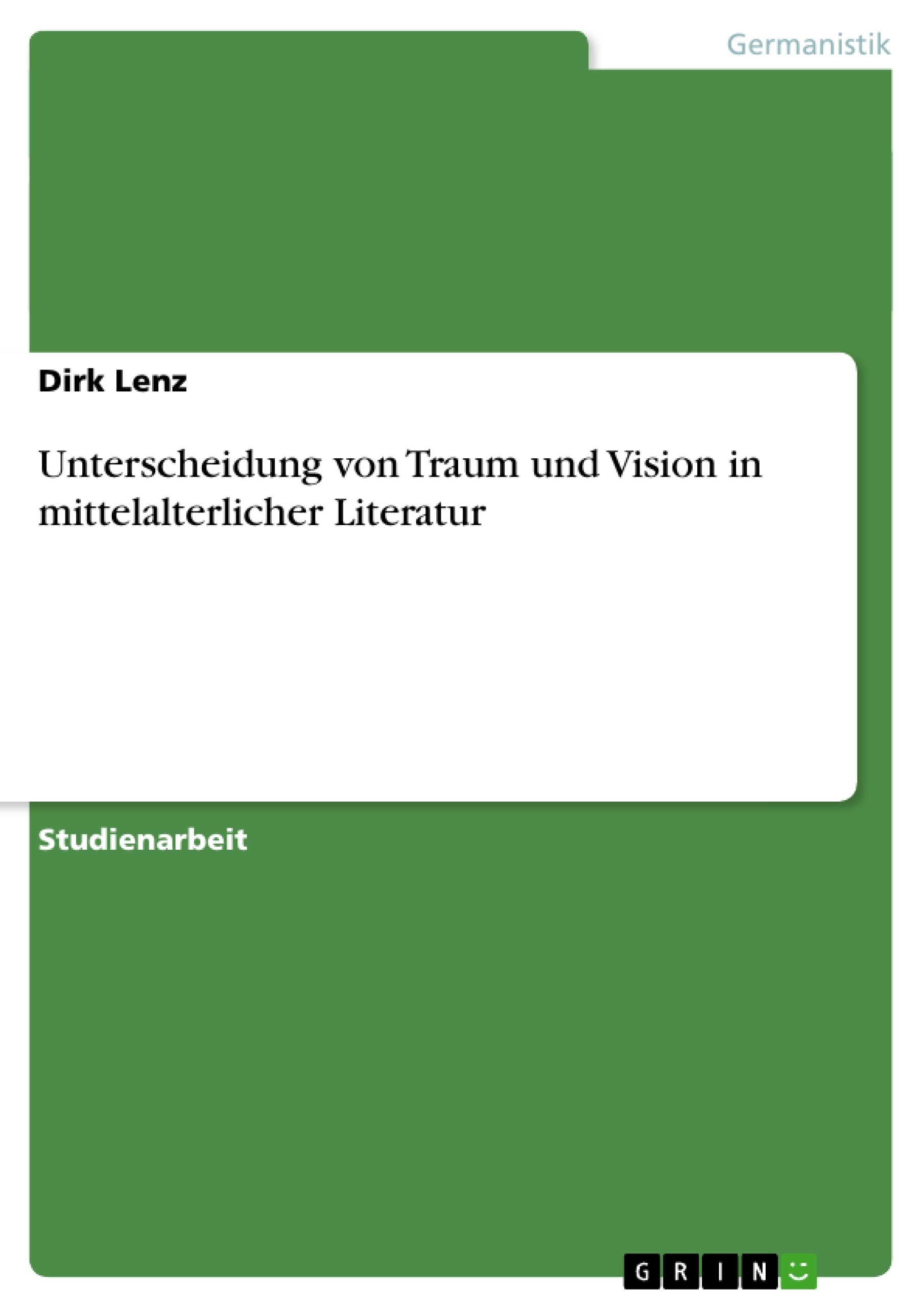Die mittelalterliche Literatur ist reich an Beispielen für Visionen und Träume, in der Wissenschaft spricht man gar schon von der eigenständigen Gattung der Visionsliteratur. Wie einflussreich und ausgebreitet diese Texte im Mittelalter waren, sieht man nicht zuletzt daran, dass zum Beispiel die Visio Tnugdali heute noch in über 200 Handschriften erhalten ist. Träume sind ähnlich stark in der Historie verwurzelt, sie treten in annähernd jedem wichtigen Text des Mittelalters auf, wichtige Traumbücher mit Deutungen zu geläufigen Erscheinungen wurden geschrieben.
Dies alles ist Grund genug, Traum und Vision in ihrem Auftreten in mittelalterlicher Literatur einer genauen Analyse bezüglich ihrer Abgrenzung voneinander zu untersuchen. So schreiben beispielsweise Bagliani und Stabile, dass „der Traum eine Unterart der Vision“ sei. Dass dies nicht ohne weiteres hingenommen werden kann, will diese Arbeit zeigen. So stellt schon Jean-Claude Schmitt fest, dass „die Erzählliteratur [...] den Traum sehr genau von anderen übernatürlichen Phänomenen wie Visionen [unterscheidet]“. Diesen Punkt verfolgend, werde ich in im weiteren Verlauf die Unterschiede zwischen Vision und Traum in mehrfacher Hinsicht hervorheben, dazu werde ich im Hauptteil Situation, Inhalt, Textumfeld, Gewichtung, etc. dieser Phänomene anhand einiger mittelalterlicher Texte untersuchen.
Exemplarisch für die Träume analysiere ich Beispiele aus dem Nibelungenlied und dem Prosa-Lancelot. Auf Seiten der Vision werde ich mich auf die Jenseitsvisionen des 12. Jh. beschränken, die den Höhepunkt eines von zwei Visionstypen markieren, ich vernachlässige bewusst die später auftretenden Heiligenvisionen, die hauptsächlich in der Literatur zur Frauenmystik auftauchten und eine besondere Unterart dieses Phänomens darstellen. Als Beispiele für Visionen dienen mir die Visio Tnugdali und die Visio Alberici.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Situation und Stand des Sehers sowie Textumfeld
- Inhalt und Funktion innerhalb des Werkes
- Gewichtung des Ereignisses außerhalb des Werkes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung von Traum und Vision in der mittelalterlichen Literatur. Sie beleuchtet die Unterschiede in Bezug auf die Situation des Sehers, das textliche Umfeld, den Inhalt und die Gewichtung der Phänomene. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale beider Phänomene aufzuzeigen und ihre Funktion innerhalb der jeweiligen Werke zu analysieren.
- Unterscheidung von Traum und Vision in mittelalterlicher Literatur
- Analyse des Sehers und seines Standorts in der jeweiligen Erzählung
- Bedeutung und Funktion von Träumen und Visionen innerhalb der Werke
- Untersuchung der Rezeption und Gewichtung der Ereignisse außerhalb der Werke
- Vergleich von Träumen und Visionen anhand exemplarischer Beispiele
Zusammenfassung der Kapitel
- Hinführung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Träumen und Visionen in der mittelalterlichen Literatur heraus und befasst sich mit der Abgrenzung beider Phänomene. Sie betont die Notwendigkeit einer genauen Analyse, um die Unterschiede zwischen Traum und Vision aufzuzeigen.
- Situation und Stand des Sehers sowie Textumfeldes: Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede in der Darstellung von Träumen und Visionen in Bezug auf den Seher und sein Umfeld. Der Traum wird im Vergleich zur Vision als subjektives, oft traumatisches Erlebnis dargestellt, während die Vision eine objektive, transzendentale Erfahrung beschreibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Traum und Vision in der mittelhochdeutschen Literatur. Im Zentrum stehen die Analyse der beiden Phänomene, ihre Abgrenzung und die Untersuchung ihrer Funktion in den jeweiligen Texten. Wichtige Themenfelder sind die Situation des Sehers, das textliche Umfeld, der Inhalt und die Gewichtung der Ereignisse. Exemplarisch werden Werke wie das Nibelungenlied, der Prosa-Lancelot, die Visio Tnugdali und die Visio Alberici betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Dirk Lenz (Autor:in), 2005, Unterscheidung von Traum und Vision in mittelalterlicher Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41626