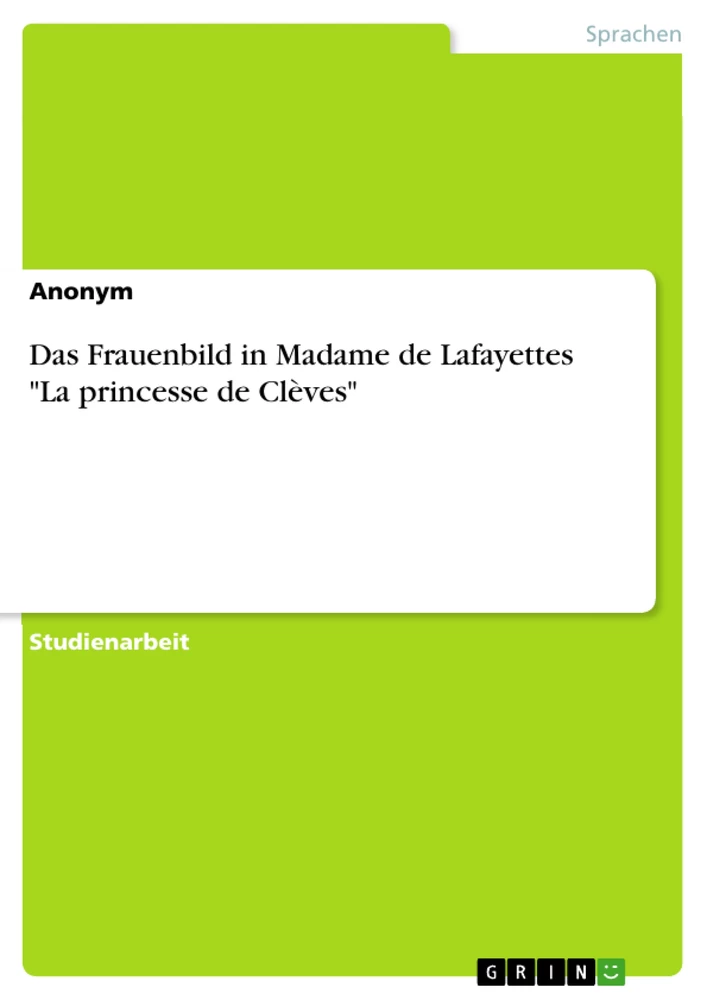Der im Jahre 1678 erschienene Roman La princesse de Clèves von Madame de Lafayette, der von der brisanten Dreiecksbeziehung der verheirateten Madame de Clèves und dem Duc de Nemours handelt, gilt als das Meisterwerk der französischen Klassik und dient noch heute zahlreichen literaturtheoretischen Untersuchungen als Gegenstand. Nicht nur die Tatsache, dass es sich bei der Hauptfigur des Romans um eine weibliche Protagonistin handelt, die der Feder einer weiblichen, im siècle classique wirkenden Autorin entspringt, rechtfertigt die Wahl dieses Romans als Grundlage zur Analyse des Frauenbildes im Zeitalter der französischen Klassik, sondern besonders die Entwicklung der Titelheldin und dessen durch ihre Autorin feine psychologische Ausgestaltung ermöglichen Einblicke in die Konfliktsituation der Frauen in der höfischen Gesellschaft des siebzehnten Jahrhunderts.
Von einiger Wichtigkeit für das Verständnis der Situation der Frauen zu dieser Zeit sei die allgemeine gesellschaftliche Situation in und um den absolutistischen Hof des Königs Ludwig XIV, dessen Normen und Werte das gesellschaftliche Leben jener Zeit bestimmten, sowie das Idealbild der honnêtes gens, welches gleichermaßen für Männer (honnête homme) und Frauen (honnête femme) galt.
So soll in einem ersten theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit zum einen auf die für die spätere Analyse der Entwicklung der Prinzessin und des sich daraus ableitenden im Roman vertretenen Frauenbildes wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Hintergründe der Herrschaftszeit von Ludwig XIV eingegangen werden und zum anderen sollen die relevanten Werte und Normen der Hofgesellschaft und die bereits erwähnten Idealbilder erläutert werden.
Im zweiten theoretischen Teil der Arbeit wird auf die Situation der Frau im klassischen Zeitalter und die beginnende Entwicklung eines sich wandelnden Frauenbildes eingegangen, um schließlich die im Hauptteil folgende ausführliche Analyse der Entwicklung unserer Prinzessin, die sich stets an der Frage nach des der Erzählung zugrundeliegenden Frauenbildes orientieren wird, auf einen fruchtbaren Boden zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historische Kontext des Romans
- 2.1 Die höfische Gesellschaft und das Rationalitätsprinzip
- 2.2 Das Frauenbild im klassischen Zeitalter
- 3. Analyse: Die Entwicklung der Titelheldin La princesse de Clèves
- 4. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Madame de Lafayettes Roman "La princesse de Clèves" (1678) und untersucht das darin präsentierte Frauenbild im Kontext der französischen Klassik. Ziel ist es, die Entwicklung der Titelheldin im Lichte der gesellschaftlichen Normen und Werte des absolutistischen Hofes Ludwigs XIV. zu beleuchten.
- Das Frauenbild im 17. Jahrhundert Frankreich
- Die höfische Gesellschaft und ihre Etikette unter Ludwig XIV.
- Das Ideal der Honnêteté und seine Auswirkungen auf Frauen
- Die psychologische Entwicklung der Prinzessin de Clèves
- Konflikte zwischen persönlichem Glück und gesellschaftlichen Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung von Madame de Lafayettes "La princesse de Clèves" als Meisterwerk der französischen Klassik und als Gegenstand literaturtheoretischer Untersuchungen. Sie begründet die Wahl dieses Romans für die Analyse des Frauenbildes im 17. Jahrhundert und skizziert den Aufbau der Arbeit, der eine Analyse des historischen Kontextes und eine detaillierte Analyse der Entwicklung der Titelheldin umfasst.
2. Der historische Kontext des Romans: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des Romans. Es analysiert die höfische Gesellschaft unter Ludwig XIV., die durch eine strenge Etikette und das Streben nach Rationalität und "Honnêteté" gekennzeichnet war. Die zunehmende Verhofung des Adels unter Ludwig XIV. führte zu einer Verfeinerung der sozialen Umgangsformen und einer Veräußerlichung der Normen, die emotionale Regungen unterdrückte. Der Abschnitt untersucht das Idealbild des "honnête homme" und seine Bedeutung für die gesellschaftliche Ordnung. Der Einfluss des Königtums und die Rolle des Adels werden ausführlich erläutert, und es wird die Bedeutung der rationalen Selbstkontrolle für den sozialen Aufstieg am Hofe hervorgehoben. Der Abschnitt über das Frauenbild skizziert die Veränderungen des traditionellen misogynen Bildes, beeinflusst durch die Salonkultur, und stellt die Frage nach der Übertragbarkeit des Honnêteté-Ideals auf Frauen.
Schlüsselwörter
La princesse de Clèves, Madame de Lafayette, Französische Klassik, Frauenbild, Hofgesellschaft Ludwig XIV., Honnêteté, Rationalität, Etikette, Salonkultur, psychologische Entwicklung, gesellschaftliche Normen, Konflikt, Dreiecksbeziehung.
Häufig gestellte Fragen zu "La princesse de Clèves" - Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Madame de Lafayettes Roman "La princesse de Clèves" (1678) und untersucht das darin präsentierte Frauenbild im Kontext der französischen Klassik. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Titelheldin im Lichte der gesellschaftlichen Normen und Werte des absolutistischen Hofes Ludwigs XIV.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Frauenbild im 17. Jahrhundert Frankreich, die höfische Gesellschaft und ihre Etikette unter Ludwig XIV., das Ideal der Honnêteté und seine Auswirkungen auf Frauen, die psychologische Entwicklung der Prinzessin de Clèves und Konflikte zwischen persönlichem Glück und gesellschaftlichen Erwartungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der historische Kontext des Romans (inkl. höfische Gesellschaft, Rationalitätsprinzip und Frauenbild im klassischen Zeitalter), Analyse: Die Entwicklung der Titelheldin La princesse de Clèves und Zusammenfassung und Schluss. Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Wahl des Romans. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Hintergrund, Kapitel 3 analysiert die Titelheldin und das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der historische Kontext des Romans dargestellt?
Das Kapitel zum historischen Kontext analysiert die höfische Gesellschaft unter Ludwig XIV., die strenge Etikette, das Streben nach Rationalität und "Honnêteté", die zunehmende Verhofung des Adels und die Verfeinerung der sozialen Umgangsformen. Es untersucht das Ideal des "honnête homme", den Einfluss des Königtums, die Rolle des Adels und die Bedeutung der rationalen Selbstkontrolle. Es wird auch das Frauenbild im Kontext dieser Entwicklungen untersucht, inklusive des Einflusses der Salonkultur und der Frage nach der Übertragbarkeit des Honnêteté-Ideals auf Frauen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: La princesse de Clèves, Madame de Lafayette, Französische Klassik, Frauenbild, Hofgesellschaft Ludwig XIV., Honnêteté, Rationalität, Etikette, Salonkultur, psychologische Entwicklung, gesellschaftliche Normen, Konflikt, Dreiecksbeziehung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Titelheldin im Lichte der gesellschaftlichen Normen und Werte des absolutistischen Hofes Ludwigs XIV. zu beleuchten und das Frauenbild im Kontext der französischen Klassik zu analysieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Das Frauenbild in Madame de Lafayettes "La princesse de Clèves", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416688