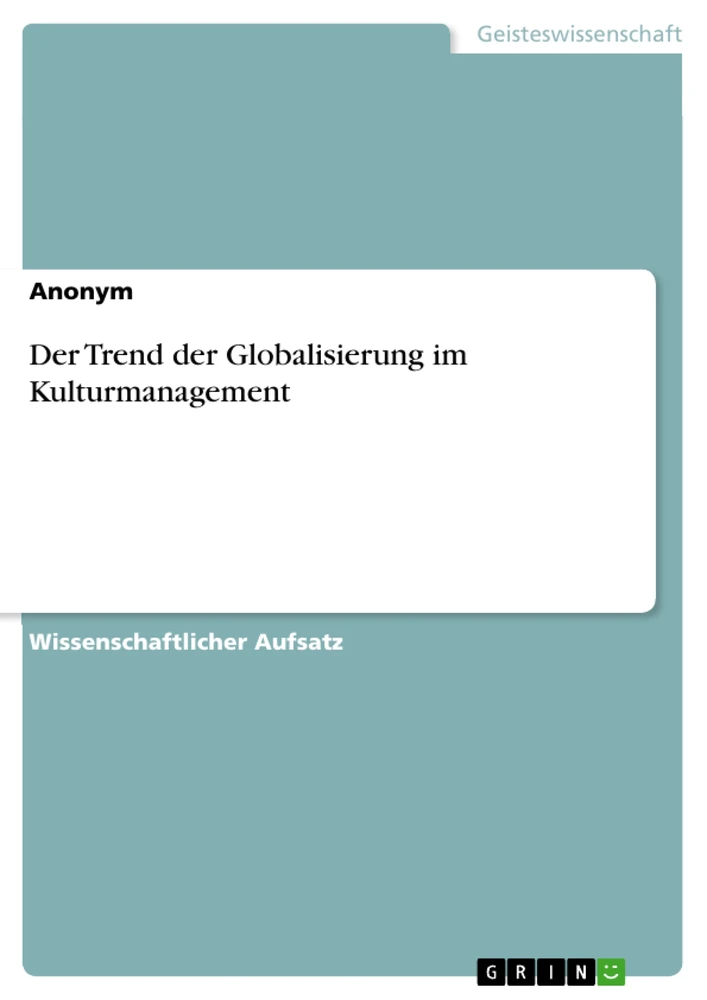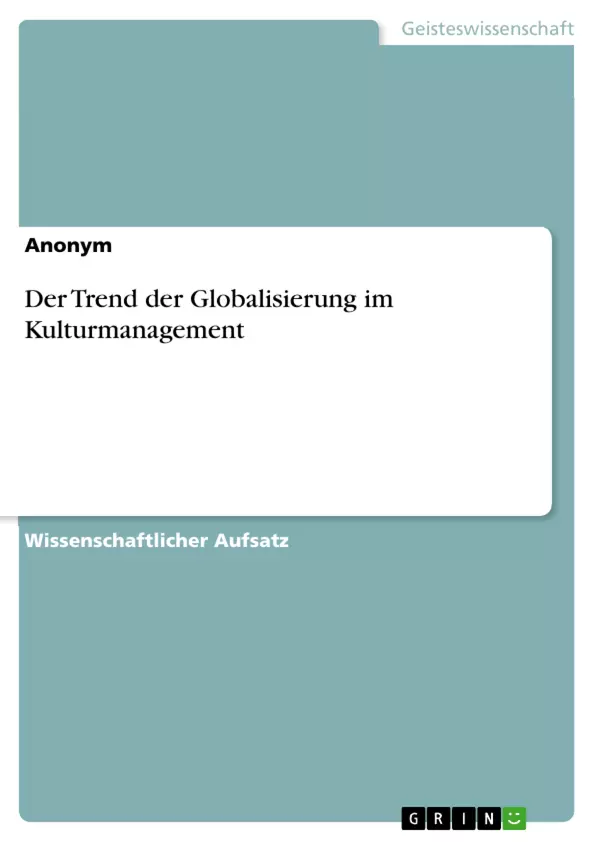Gerade im Bereich der Kunst und Kultur sind Internationalisierung und weltweiter Austausch keine neuen Phänomene. Die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert brachte auch die Sehnsucht des Kennenlernens anderer Künste und Kulturen mit sich. Aus dieser Bewegung entwickelten sich die damals häufig genutzten Begriffe Weltbürger und Weltliteratur. Mit der Erfindung der Mittel zur technischen Konservierung und Verbreitung von Musik kam auch der Begriff der Weltmusik hinzu. Auch die bildende Kunst erfuhr wesentliche Anregungen aus globalen Eindrücken. Dieses Spektrum hat sich in letzter Zeit mit Medien wie Film und Fotografie erheblich erweitert, und wurde durch neue Vernetzungsmöglichkeiten wie zuletzt dem Internet rasant vorangetrieben. Diese Internationalisierungsprozesse betrafen lange Zeit jedoch ausschließlich die Kunst und damit nur einen Teilbereich der Kultur, während sie in der Gegenwart weit darüber hinausreichen und sowohl die Alltagskulturen, als auch die mit der Kultur vermittelten Wertvorstellungen und Konventionen einschließen. Darüber hinaus war der Austausch früher auf Metropolen und deren kosmopolitisch ausgerichtete Gesellschaftsschichten beschränkt, während er heute flächendeckend stattfindet und die gesamte Gesellschaft umfasst. Kulturmanagement als eigenständige, wissenschaftliche Disziplin kann in Europa weitreichend noch als sehr jung bezeichnet werden. Erst nach dem Öffnen der Grenzen in Europa zwischen Ost und West und dem Ende zentralistischer Kulturfördersysteme etablierten sich die ersten Kulturmanagement Studiengänge. Anfangs war Kulturmanagement fast rein marktwirtschaftlich orientiert und im Umgang und Verständnis von Kunst, Kultur und Kulturpolitik länderspezifisch geprägt. Mit der Tendenz zur Globalisierung, den neuen Medien und deren dadurch neu geschaffenen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für die Gesellschaft haben sich nicht nur neue Wege eröffnet, sondern es haben sich auch Geschwindigkeit und die Intensität der kulturellen Veränderung und Vermengung signifikant erhöht. Dieser Trend der Globalisierung führt auch zu neuen Anforderungen, Herausforderungen und Ansichtsweisen im Kulturmanagement. Ziel dieser Arbeit ist es den Trend der Globalisierung in Bezug und Einfluss auf Kulturmanagement zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturelle Globalisierung
- Entwicklung einer Weltgesellschaft
- Migrationsbewegung
- Verändertes Kulturverständnis
- Neue Wege im Kulturmanagement
- Conclusio und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Einfluss der Globalisierung auf das Kulturmanagement. Sie analysiert die Veränderungen in unserer Gesellschaft, die durch die kulturelle Globalisierung entstanden sind, beleuchtet die Erweiterung des Kulturbegriffs und untersucht die Auswirkungen auf die Verwaltung und das Management von Kultur. Die Arbeit soll einen Einblick in die Grundlagen des Trends der Globalisierung im Kulturmanagement bieten, ohne jedoch einen vollständigen Überblick zu gewährleisten.
- Entwicklung einer Weltgesellschaft
- Migrationsbewegung
- Verändertes Kulturverständnis
- Neue Wege im Kulturmanagement
- Einfluss der Globalisierung auf das Kulturmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Internationalisierung und des weltweiten Austausches im Bereich von Kunst und Kultur dar. Es wird die historische Entwicklung von Begriffen wie Weltbürger, Weltliteratur und Weltmusik beleuchtet und die rasante Beschleunigung der Internationalisierungsprozesse durch Medien wie Film, Fotografie und das Internet hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Bedeutung der Globalisierung für die Alltagskulturen, Wertvorstellungen und Konventionen, die über den Bereich der Kunst hinausgeht.
Kulturelle Globalisierung
Dieses Kapitel befasst sich mit den Entwicklungen und veränderten Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, die die gegenwärtigen Alltags- und Popkulturen prägen. Es werden drei maßgebliche Entwicklungen vorgestellt, die die kulturelle Globalisierung vorangetrieben haben:
- Die Entwicklung einer Weltgesellschaft, die durch den globalen Austausch von Waren, Dienstleistungen und Lebensbereichen geprägt ist.
- Die Migrationsbewegungen im 21. Jahrhundert, die ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben.
- Das veränderte Kulturverständnis, das durch den globalen Kulturaustausch beeinflusst wird.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Globalisierung, Kulturmanagement, Kulturelle Globalisierung, Weltgesellschaft, Migrationsbewegung, Verändertes Kulturverständnis, Neue Wege im Kulturmanagement, Internationalisierung, Kulturbegriff, Alltagskulturen, Popkulturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Globalisierung das Kulturmanagement?
Globalisierung führt zu neuen Anforderungen, wie der Verwaltung von Migrationsbewegungen, einem veränderten Kulturverständnis und der Nutzung neuer Medien im Management.
Was versteht man unter einer "Weltgesellschaft"?
Es beschreibt die zunehmende globale Vernetzung durch den Austausch von Waren, Dienstleistungen und kulturellen Werten, die über nationale Grenzen hinausgehen.
Wie hat sich der Kulturbegriff gewandelt?
Früher war der Austausch auf die "Hochkunst" und Eliten beschränkt. Heute umfasst er die gesamte Gesellschaft und schließt Alltagskulturen sowie Popkulturen mit ein.
Welche Rolle spielt das Internet im Kulturmanagement?
Das Internet hat die Geschwindigkeit und Intensität des kulturellen Austauschs rasant vorangetrieben und neue Wege für die Verbreitung von Kunst und Kultur geschaffen.
Ist Kulturmanagement eine junge Disziplin?
Ja, in Europa etablierte es sich erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als eigenständige wissenschaftliche Disziplin mit spezifischen Studiengängen.
Welchen Einfluss hat Migration auf die Kulturarbeit?
Migration führt zu einer Vermengung von Kulturen und stellt das Management vor die Herausforderung, diverse Identitäten und Traditionen in das kulturelle Angebot zu integrieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Der Trend der Globalisierung im Kulturmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417137