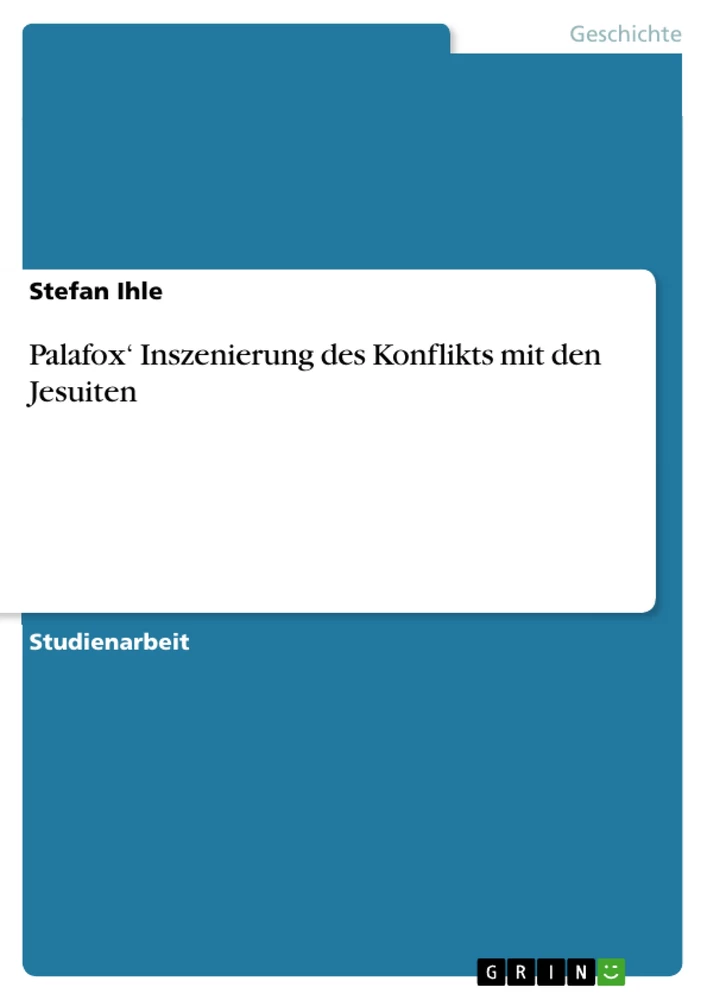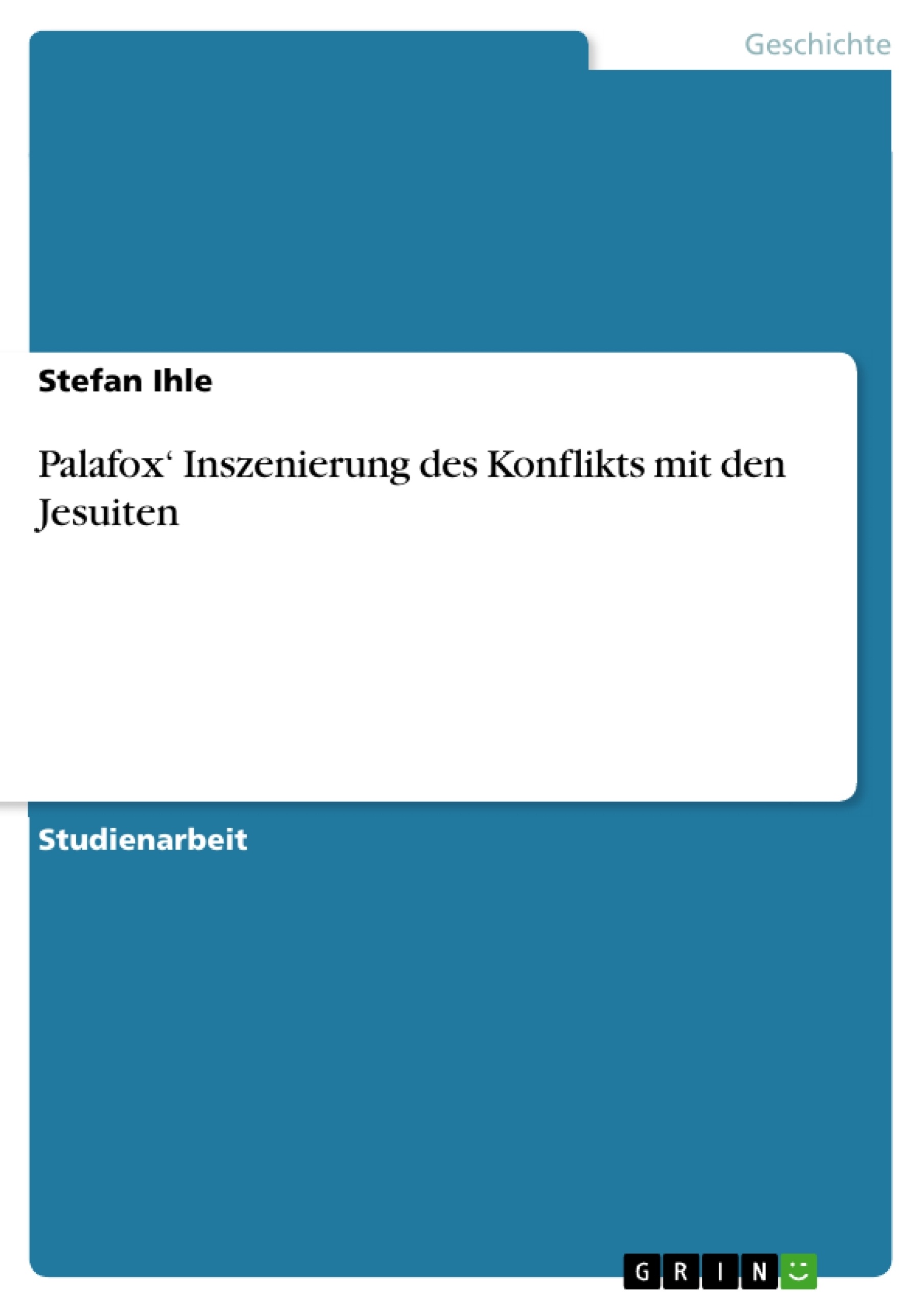Gegenstand dieser Arbeit soll eine Analyse der Darstellung des Konflikts Palafox‘ mit dem Jesuitenorden aus dessen Briefen an Papst Innozenz. Dabei ist die Argumentationslinie des Autors nachzuvollziehen. Ausgangspunkt dafür ist es, dass die Briefe als Handlung der Inszenierung in den Blickpunkt gerückt werden. Denn der Urheber hat eine klare Vorstellung davon, was er mit den Schriften erreichen wollte.
Die Briefe sind deshalb nicht als Abbild der Geschehnisse zu verstehen, sondern durch die Schilderungen in den Schriftstücken soll beim Adressaten eine Wirklichkeit erschaffen werden, die bestimmte Handlungen erzwingen sollte. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll, die Texte nach der Leitfrage zu untersuchen, welche Geschichte der Autor erzählte. Durch Kontextualisierung dieser Erzählung soll es möglich sein, Antworten auf die Frage zu liefern, warum Palafox dieses Narrativ gebrauchte und was er damit erreichen wollte. Es wird also versucht werden, eine intentionale Erklärung aus der Perspektive des damaligen Akteurs zu finden. Durch die inhaltliche Analyse der Briefe wird es gleichzeitig möglich sein, die Frage nach den Mitteln zu beantworten, die der Schreiber wählte, um seine Ziele zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Orden mächtiger als ein Bischof?
- Ein Orden als Gefahr für die Christenheit
- Fazit der Auseinandersetzung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Darstellung des Konflikts zwischen Juan de Palafox y Mendoza und dem Jesuitenorden in dessen Briefen an Papst Innozenz X. Ziel ist es, die Argumentationslinie des Autors nachzuvollziehen und zu verstehen, welche Geschichte er erzählte und warum er dieses Narrativ gebrauchte. Die Briefe werden als Handlung der Inszenierung betrachtet, um Antworten auf die Frage zu liefern, was Palafox mit seinen Schriften erreichen wollte.
- Der Konflikt zwischen Palafox und den Jesuiten im Kontext der Reform Neuspaniens
- Palafox' Argumentationslinie in seinen Briefen an Papst Innozenz X.
- Die Rolle des Jesuitenordens im Vizekönigreich Neuspanien
- Die Intentionen von Palafox in seiner Auseinandersetzung mit den Jesuiten
- Die Mittel, die Palafox in seinen Briefen einsetzt, um seine Ziele zu erreichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das 17. Jahrhundert war für das spanische Weltreich von zahlreichen Konflikten geprägt. Um die Kontrolle über seine Kolonien zu festigen, ernannte der spanische König Juan de Palafox y Mendoza zum Generalvisitator von Neuspanien. Palafox' umfassende Vollmachten führten jedoch zu Konflikten mit dem Vizekönig und mit verschiedenen Orden, insbesondere mit den Jesuiten. Die Arbeit analysiert die Briefe Palafox' an Papst Innozenz X. im Hinblick auf die Darstellung des Konflikts mit den Jesuiten und deren Intention.
2. Ein Orden mächtiger als ein Bischof?
Palafox' erster Brief an Papst Innozenz X. entstand im Mai 1647, als der Konflikt mit den Jesuiten seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Der Brief ist nicht allein auf die Auseinandersetzung um bischöfliche Vorrechte zurückzuführen, sondern steht auch im Kontext der Reform Neuspaniens. Palafox war mit dem Vizekönig in Konflikt, da sie unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Vizekönigreiches hatten. Dieser interne Konflikt verschärfte die bereits bestehende Auseinandersetzung mit dem Jesuitenorden.
Schlüsselwörter
Juan de Palafox y Mendoza, Jesuitenorden, Neuspanien, Generalvisitation, Reform, Konflikt, Papst Innozenz X., Briefe, Inszenierung, Geschichte, Argumentationslinie, Intention, Vizekönig, innerkirchliche Streitigkeiten, bischöfliche Vorrechte
Häufig gestellte Fragen
Wer war Juan de Palafox y Mendoza?
Er war ein einflussreicher Bischof und Generalvisitator in Neuspanien (Mexiko) im 17. Jahrhundert, der weitreichende Reformen anstrebte.
Worüber stritt Palafox mit den Jesuiten?
Es ging primär um bischöfliche Vorrechte, die Kontrolle über die Missionen und die Machtstellung des Jesuitenordens im Vizekönigreich.
Welche Quellen werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse stützt sich auf Briefe, die Palafox an Papst Innozenz X. schrieb, um seine Position im Konflikt zu rechtfertigen.
Warum wird von einer „Inszenierung“ des Konflikts gesprochen?
Die Arbeit argumentiert, dass Palafox seine Briefe gezielt rhetorisch gestaltete, um beim Papst eine bestimmte Wirklichkeit zu erzeugen und Handlungen zu erzwingen.
Was wollte Palafox mit seinen Schriften erreichen?
Sein Ziel war es, den Einfluss des Jesuitenordens zu begrenzen und die bischöfliche sowie königliche Autorität in den Kolonien zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Stefan Ihle (Autor:in), 2017, Palafox‘ Inszenierung des Konflikts mit den Jesuiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417144