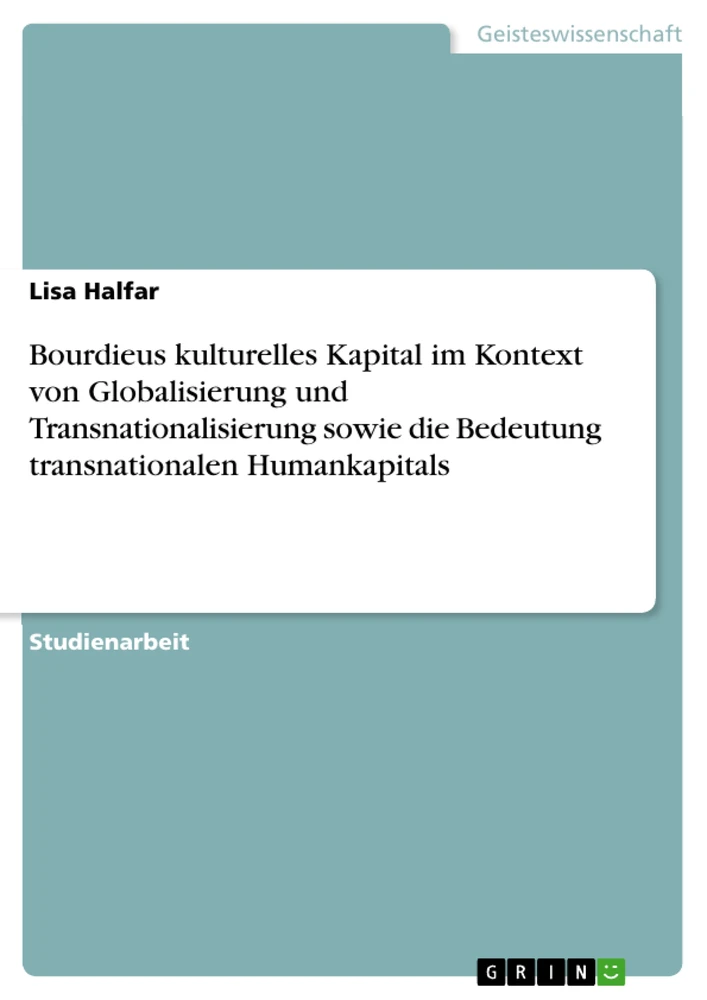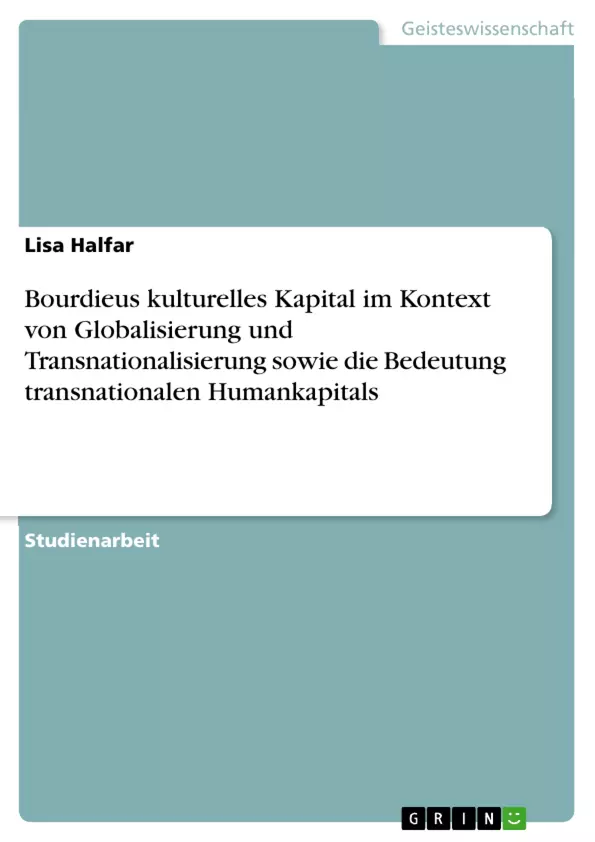Globalisierungs- und Transnationalisierungsprozesse haben nationalstaatliche Grenzen zunehmend verschwimmen lassen, sind seit den 1970er Jahren sprunghaft gewachsen und haben dadurch neue Phänomene, wie zum Beispiel transnationale Netzwerke und Akteure hervorgebracht. Die kontinuierliche Bedeutungszunahme von transnationalen Kompetenzen wird daher konstatiert und zum Ausgangspunkt der vorliegenden Ausarbeitung gemacht.
Im Hinblick auf diese anzunehmende Bedeutungszunahme transnationaler Kompetenzen ist die Thematik von äußerster Relevanz, da durch unterschiedliche Ausprägungen der Kompetenzen bei Individuen wiederum soziale Ungleichheiten verschärft werden können. Die Aufweichung der Grenzen hat unmittelbar Einfluss auf die Verteilung von sozialem, ökonomischem und besonders kulturellem Kapital. Hinsichtlich diesen Kapitalsorten soll die folgende Ausarbeitung seine Grundlage auf die Bourdieusche Kapitaltheorie legen und veranschaulichen, wie sich die unterschiedlichen Kapitalien im Kontext von Globalisierung und Transnationalisierung verändern.
Da Bourdieu in seiner Kapitaltheorie Globalisierungs- und Transnationalisierungsprozesse unbeachtet lässt und sich seine Kapitalsorten innerhalb nationalstaatlicher Grenzen bewegen, scheint es interessant herauszufinden, ob seine Kapitaltheorie auch im Kontext heutiger Globalisierung Anwendung findet und Erklärungsarbeit leisten kann. Die Kernfrage der Ausarbeitung, die im weiteren Verlauf beantwortet werden soll, lautet demnach: Ist Bourdieus Kapitaltheorie auf eine sich zunehmend globalisierende Welt mit transnationalen Akteuren anwendbar?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bourdieus Kapitalbegriff
- Die Kapitalsorten
- Kapitalumwandlungen
- Kulturelles Kapital im transnationalen Kontext
- Transnationalisierung und Globalisierung
- Transnationales kulturelles Kapital am Beispiel des Kapitalerwerbs bis zum Abschluss des Studiums
- Die Bedeutung transnationalen Humankapitals
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Bourdieus Theorie des kulturellen Kapitals im Kontext von Globalisierung und Transnationalisierung. Dabei wird die Frage gestellt, ob und wie sich Bourdieus Kapitaltheorie auf eine sich globalisierende Welt mit transnationalen Akteuren anwenden lässt.
- Der Kapitalbegriff nach Bourdieu und seine verschiedenen Sorten (ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital)
- Die Bedeutung von transnationalen Kompetenzen und transnationalem kulturellem Kapital im Kontext von Globalisierung und Transnationalisierung
- Der Erwerb und die Verwertbarkeit von transnationalem kulturellem Kapital im Lebenslauf eines Individuums, insbesondere bis zum Abschluss des Studiums
- Die Rolle des sozialen Raums und der Klassenspezifischen Zugangsweisen zum transnationalen kulturellen Kapital
- Die Bedeutung von transnationalem Humankapital für Bildungs- und Berufskarrieren sowie die Distinktionsfunktion transnationaler Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Globalisierung und Transnationalisierung ein und stellt die Relevanz transnationaler Kompetenzen heraus.
Kapitel 2 liefert einen Überblick über Bourdieus Kapitalbegriff und die verschiedenen Kapitalsorten, insbesondere das kulturelle Kapital.
Kapitel 3 analysiert die Bedeutung des kulturellen Kapitals im transnationalen Kontext, betrachtet die Globalisierung und Transnationalisierungsprozesse sowie den Erwerb von transnationalem kulturellen Kapital anhand des Beispiels eines Lebenslaufs bis zum Abschluss des Studiums.
Schlüsselwörter
Bourdieu, Kapitaltheorie, kulturelles Kapital, Globalisierung, Transnationalisierung, transnationales Humankapital, soziale Ungleichheit, Distinktion, Bildungs- und Berufskarrieren.
Häufig gestellte Fragen
Ist Bourdieus Kapitaltheorie noch in einer globalisierten Welt anwendbar?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage, da Bourdieu seine Theorie ursprünglich auf nationalstaatliche Grenzen bezog, während heutige Akteure zunehmend transnational agieren.
Was versteht man unter transnationalem kulturellem Kapital?
Es handelt sich um Kompetenzen wie Fremdsprachenkenntnisse oder internationale Abschlüsse, die über nationale Grenzen hinweg verwertbar sind und soziale Distinktion ermöglichen.
Wie hängen Globalisierung und soziale Ungleichheit zusammen?
Unterschiedliche Zugänge zu transnationalen Kompetenzen können bestehende soziale Ungleichheiten verschärfen, da sie die Verteilung von ökonomischem und kulturellem Kapital beeinflussen.
Welche Bedeutung hat transnationales Humankapital für die Karriere?
Es spielt eine entscheidende Rolle für Bildungs- und Berufskarrieren, da internationale Erfahrungen und Netzwerke zunehmend als wertvolle Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt gelten.
Wie wird kulturelles Kapital im Lebenslauf erworben?
Die Arbeit analysiert den Kapitalerwerb beispielhaft bis zum Studienabschluss und zeigt, wie klassenspezifische Zugangsweisen den Erwerb transnationaler Kompetenzen prägen.
- Arbeit zitieren
- B.A. Lisa Halfar (Autor:in), 2018, Bourdieus kulturelles Kapital im Kontext von Globalisierung und Transnationalisierung sowie die Bedeutung transnationalen Humankapitals, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417261