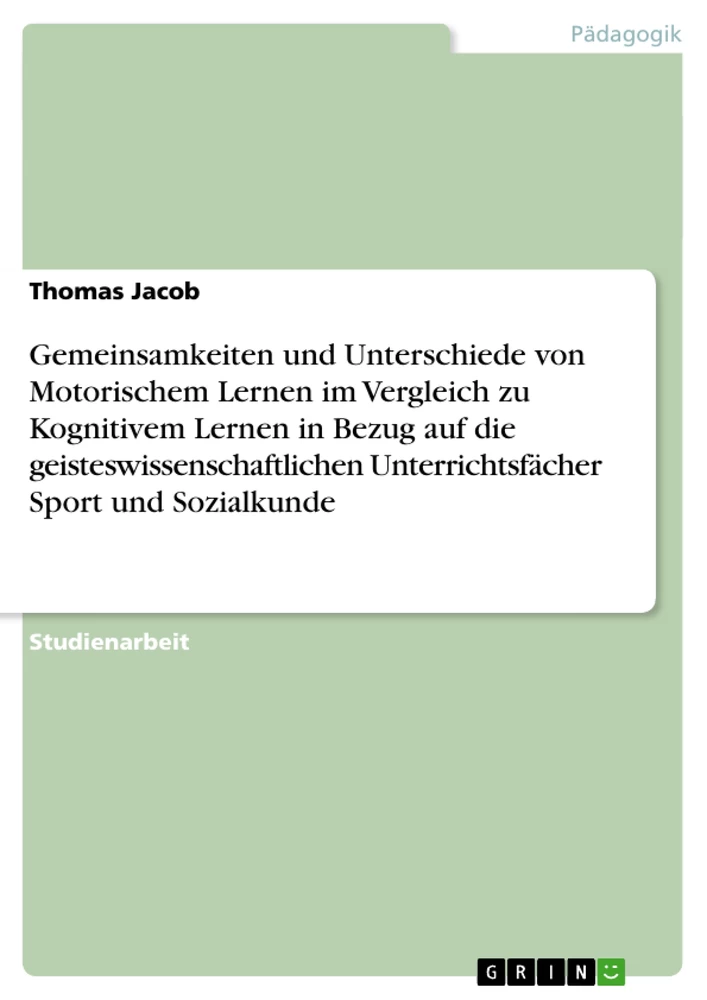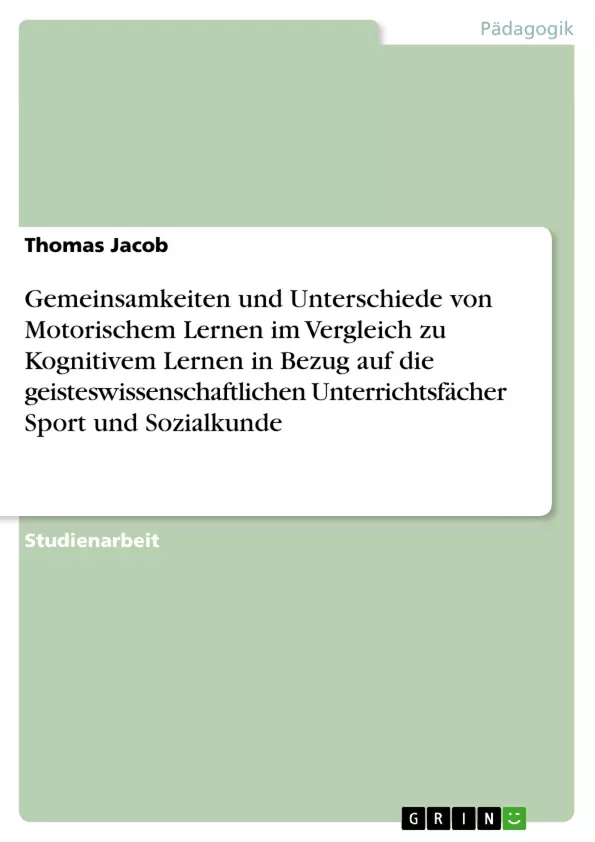Der Schulalltag soll für den Schüler nicht nur reine Wissens- und Informationsanhäufung darstelln, sondern auch Gedankenzusammenhänge und Verstehensprozesse vermitteln. Damit dies geschehen kann müssen Schüler denen ihnen angebotenen Lehrstoff internalisieren und durch individuell- gedankliche Prozesse für sich verständlich machen. Dabei ist das Ziel, sofern man von Ziel sprechen kann, der Gedankenprozess des Einzelnen. Diese Verstehensprozesse laufen im ZNS (Hirnrinde) ab und folgen intrapsychischen Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten bei kognitiven Vorgängen sind Gegenstand des ersten Teiles der Arbeit.
Doch nicht nur geistige Fähigkeiten kommen in der Schule zur Anwendung. Auch im motorischen Bereich lernt der Schüler und versucht durch Übung und Training individuelle Fähigkeiten in den jeweiligen Disziplinen zu verfeinern. Dabei kommt es ebenso zu Lernvorgängen, die auf Gesetzmäßigkeiten basieren. Im Vergleich sollen die Lernvorgänge des motorischen mit denen des kognitiven erläutert werden und an Wesensmerkmalen festgemacht werden.
Auf den ersten Blick scheinen beide Begriffe relativ selbständig zu agieren und schließen die Beteiligung des Anderen größtenteils aus. Dies ist jedoch nach genauerer Analyse nur bedingt richtig. Motorische Informationen (i.S. der Rückinformation über eine motorische Aktivität), wie auch kognitive (geistige) Informationen sind „unverzichtbare Nahrung“ für geistiges und körperliches Leben und Überleben eines Menschen. Dabei ist der eigentliche Vorgang das Resultat vieler komplexer und vernetzter Prozesse, die einen direkten Zugang von Außen nur schwer möglich machen. Erwiesen ist, das der Mensch einen regelrechten „Drang“ verspürt, Informationen aufzunehmen um die Welt mit „seinen Augen“ zu entdecken. Motorische Aktionen sind dafür unabdingbar und geben den Weg frei für vielfältige Bewegungsausführungen bis hin zu speziellen Sportarten.
Jedoch nicht nur körperliche Reize sind bei der Entwicklung gegeben, auch „geistige Reize“ i.S. vom Entdecken der Welt und ihren Zusammenhängen stehen im Vordergrund. Kognitiv- psychische Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten sind dabei ein entscheidender Indikator für kognitives Lernen, abgesehen davon ob es sich jetzt um spezielles Wissen über eine Sache handelt oder um schlicht primitive Zusammenhänge (der Ofen ist heiß; das Messer ist scharf etc.) handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung
- Voraussetzung und Grundlagen für den kognitiven Lernprozess
- Einleitung
- Begriffe der Psychophysik
- Der Erkenntnisprozess
- Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung
- Gesetzmäßigkeiten der Vorstellungen
- Formen und Ebenen des Denkens
- Das Lernen
- Allgemeines
- Lerntheorien
- Kognitives Lernen
- Psychomotorik
- Allgemeines
- Begriffe und Sinnbestimmung
- Physiologisch- Anatomische Voraussetzungen
- Motorisches Handeln
- Modellvorstellungen
- Motorisches Lernen
- Vergleich Motorisches Lernen vs. Kognitives Lernen
- Allgemeines
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen motorischem und kognitivem Lernen im Kontext der geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächer Sport und Sozialkunde zu beleuchten. Dabei werden die Grundlagen des kognitiven Lernprozesses sowie die spezifischen Merkmale des motorischen Lernens untersucht, um einen Vergleich beider Lernformen zu ermöglichen.
- Der kognitive Lernprozess als Grundlage für das Verstehen von Inhalten und Gedankenzusammenhängen
- Die Bedeutung von Wahrnehmung, Vorstellung und Denken im kognitiven Lernprozess
- Der Einfluss von Gedächtnisprozessen auf die kognitive Leistung
- Die Rolle der Psychomotorik und des motorischen Lernens im Schulalltag
- Vergleichende Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen motorischem und kognitivem Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung der Aufgabenstellung, die die Relevanz des Themas im Kontext des schulischen Lernens unterstreicht. Anschließend werden die Voraussetzungen und Grundlagen des kognitiven Lernprozesses beleuchtet. In diesem Zusammenhang werden wichtige Begriffe der Psychophysik und die Funktionsweise des sensorischen und rationalen Erkenntnisprozesses erläutert.
Die Arbeit beschäftigt sich weiter mit dem Thema der Psychomotorik und beleuchtet die relevanten Begriffe und physiologischen Voraussetzungen für motorisches Lernen. Das Kapitel analysiert zudem die Modellvorstellungen und die spezifischen Merkmale des motorischen Lernprozesses. Schließlich stellt die Arbeit einen Vergleich zwischen motorischem und kognitivem Lernen auf und betrachtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Lernformen im Detail.
Schlüsselwörter
Kognitives Lernen, Motorisches Lernen, Psychomotorik, Wahrnehmung, Vorstellung, Denken, Gedächtnis, Schulalltag, Sport, Sozialkunde, Unterrichtsfächer, Gemeinsamkeiten, Unterschiede
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen motorischem und kognitivem Lernen?
Kognitives Lernen konzentriert sich auf die Aufnahme von Wissen und das Verstehen von Zusammenhängen im ZNS, während motorisches Lernen die Verfeinerung körperlicher Bewegungsabläufe durch Übung und Training zum Ziel hat.
Welche Rolle spielen Wahrnehmung und Vorstellung beim Lernen?
Beide sind zentrale Gesetzmäßigkeiten des Erkenntnisprozesses. Wahrnehmung liefert die Reize, während Vorstellungen die Grundlage für das Abspeichern und Abrufen von Informationen bilden.
Was bedeutet Psychomotorik im schulischen Kontext?
Psychomotorik beschreibt das Zusammenspiel von psychischen Vorgängen und körperlicher Bewegung. Im Sportunterricht ist sie essenziell für die Entwicklung koordinativer Fähigkeiten.
Wie hängen kognitive und motorische Reize zusammen?
Der Mensch hat einen natürlichen Drang zur Informationsaufnahme. Motorische Aktionen ermöglichen das Entdecken der Welt, was wiederum kognitive Lernprozesse anstößt.
Warum ist motorisches Lernen für Fächer wie Sozialkunde relevant?
Obwohl Sozialkunde ein geisteswissenschaftliches Fach ist, hängen Verstehensprozesse oft mit der Internalisation von Informationen zusammen, die durch vielfältige (auch motorische) Erfahrungen gestützt werden können.
- Quote paper
- Thomas Jacob (Author), 2003, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Motorischem Lernen im Vergleich zu Kognitivem Lernen in Bezug auf die geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächer Sport und Sozialkunde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41750