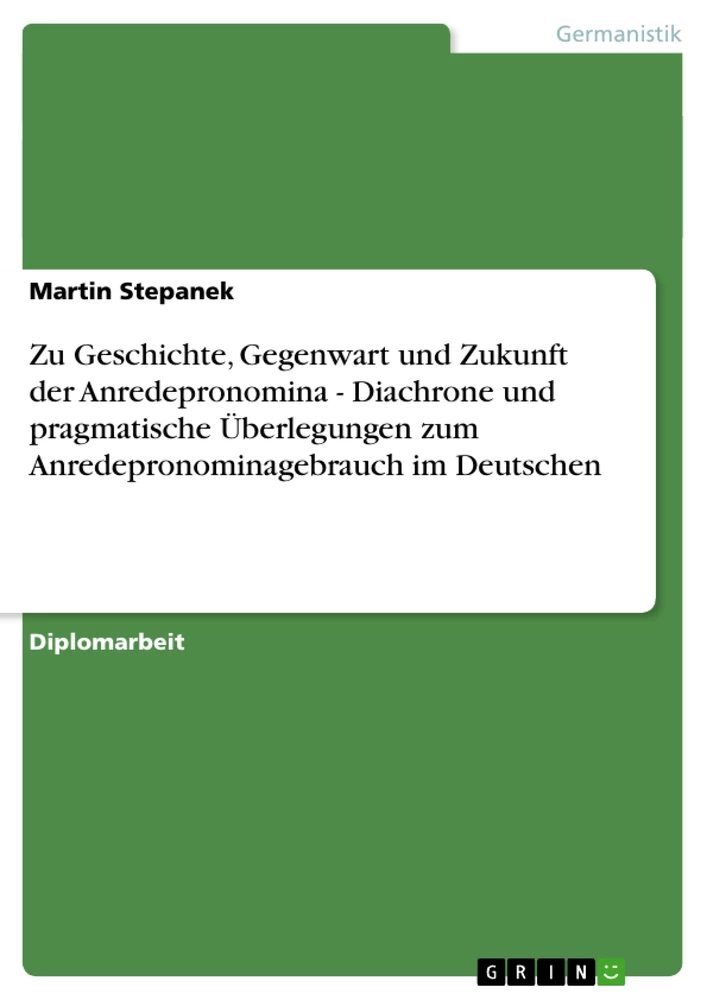Eine Diplomarbeit zum Thema der Anredepronomina im Deutschen zu verfassen ist rückwirkend betrachtet ein recht seltsames Unterfangen. Wenngleich „die Anzahl der linguistischen Untersuchungen zur Anrede mittlerweile praktisch unüberschaubar angewachsen ist“, wie Simon (2003: 4) in seiner bemerkenswerten Arbeit "Für eine grammatische Kategorie <Respekt> im Deutschen" richtig vermerkt, fand sich der Diplomand dennoch in der paradoxen Situation wieder, dass, abgesehen von zahlreichen Publikationen zur Diachronie der Anrede im Deutschen und einer Vielzahl von Veröffentlichungen im englischsprachigen Raum zu Anrede- und Höflichkeitsstrategien in verschiedenen indogermanischen Sprachen, wissenschaftliche Arbeiten zum konkreten Themenbereich, dem Anredepronominagebrauch im deutschen Sprachgebiet des 20. und 21. Jh., überraschenderweise recht spärlich gesät sind. Aus diesem Grund erschien es mir als unerlässlich neben einem historischen Überblick über die diachrone Entwicklung der Anrede im Deutschen und einer Zusammenfassung der wichtigsten theoretischen Abhandlungen zum Thema einen empirisch motivierten Teil zu gestalten, der aktuelles Anredeverhalten einfangen und auf wissenschaftlicher Basis verwerten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Historischer Hintergrund
- 1.1. Entstehung der Pluralanrede
- 1.2. Historischer Überblick über die Anrede im deutschen Sprachraum
- 1.2.1. Anredepronomina ab dem 9. Jh.: Du - Ihr
- 1.2.2. Anredepronomina ab dem 17. Jh.: Du - Ihr - Er/Sie
- 1.2.3. Anredepronomina ab dem 18. Jh.: Du - Ihr - Er/Sie - Sie
- 1.2.4. Anredepronominagebrauch des 18. Jh. am Beispiel von Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti
- 1.3. Zusammenfassung der sprachhistorischen Betrachtungen
- 2. Sprachwissenschaftstheoretische Denkansätze zum Anredepronominagebrauch
- 2.1. Power vs. Solidarity: Brown/Gilman
- 2.2. Weiterführende theoretische und praktische Überlegungen für den deutschsprachigen Raum
- 2.2.1. Soziale Funktion der pronominalen Anrede: Ammon
- 2.2.2. Hochschuldiskussionen der 70-er Jahre: Bausinger - Bayer
- 2.2.3. Anredegebrauch in der ehemaligen DDR: Kempf
- 2.2.4. Zur Distanzanrede: Buchenau
- 2.3. Grammatisch motivierte Herangehensweise: Simon
- 3. Zur Pragmatik der Anredepronomina: Von der Theorie zur Praxis
- 3.1.Vorbereitungen
- 3.2. Interviewanalysen
- 3.2.1. Fallstudie A (Jg. 1969)
- 3.2.2. Fallstudie B (Jg. 1941)
- 3.2.3. Fallstudie C (Jg. 1987): Asymmetrische Anredesituationen
- 3.3. Generationsübergreifende Beobachtungen: Konnotierter Anredegebrauch vs. Standardanrede
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Anredepronominagebrauchs im Deutschen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die diachrone Entwicklung der Anredeformen zu geben und diesen mit aktuellen pragmatischen und soziolinguistischen Ansätzen zu verknüpfen. Die Arbeit kombiniert sprachhistorische Analysen mit empirischen Daten aus Interviews, um ein aktuelles Bild des Anredeverhaltens zu zeichnen.
- Diachrone Entwicklung der Anredepronomina im Deutschen
- Soziolinguistische und pragmatische Ansätze zur Erklärung des Anredegebrauchs
- Analyse des aktuellen Anredeverhaltens im deutschsprachigen Raum
- Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht und sozialer Hierarchie auf die Anredewahl
- Generationsübergreifende Unterschiede im Anredegebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation für die Arbeit, die auf der überraschenden Knappheit an wissenschaftlichen Untersuchungen zum aktuellen Anredepronominagebrauch im 20. und 21. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum basiert. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der einen historischen Überblick, eine Darstellung theoretischer Ansätze und einen empirischen Teil umfasst. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, historische Entwicklung mit aktueller Praxis zu verbinden.
1. Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die historische Entwicklung der Anredepronomina im Deutschen. Es beginnt mit der Entstehung der Pluralanrede für Einzelpersonen im indogermanischen Raum und verfolgt die Entwicklung von der Zweizahl (Du/Ihr) zur Vierzahl (Du/Ihr/Er/Sie/Sie) über die Jahrhunderte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der gesellschaftlichen und sprachlichen Veränderungen, die die jeweiligen Anredeformen beeinflusst haben. Das Kapitel beleuchtet exemplarisch den Anredegebrauch im Werk Lessings, um den historischen Kontext zu verdeutlichen und die historische Entwicklung nachzuvollziehen.
2. Sprachwissenschaftstheoretische Denkansätze zum Anredepronominagebrauch: Kapitel 2 präsentiert verschiedene sprachwissenschaftliche Theorien, die den Anredepronominagebrauch erklären. Es werden sowohl soziolinguistische Ansätze wie das Modell von Brown/Gilman ("Power vs. Solidarity") als auch pragmatische und grammatische Perspektiven diskutiert. Die Arbeiten von Ammon, Kempf, Braun und Buchenau werden als wichtige Beiträge zur Diskussion um die soziale Funktion der Anrede und den Einfluss von Faktoren wie sozialer Distanz und Machtverhältnisse vorgestellt. Die Vielfältigkeit der Ansätze soll der Thematik gerecht werden.
3. Zur Pragmatik der Anredepronomina: Von der Theorie zur Praxis: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum aktuellen Anredegebrauch. Es werden drei Fallstudien vorgestellt, die sich mit dem Anredeverhalten von Personen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Hintergründe beschäftigen. Die Analysen konzentrieren sich auf die Faktoren, die die Wahl zwischen formeller und informeller Anrede beeinflussen. Insbesondere werden die Faktoren Alter, Geschlecht und Arbeitsplatzhierarchie untersucht. Die Fallstudien zeigen die komplexen Interaktionen zwischen theoretischen Modellen und realer Sprachverwendung und beleuchten den konnotierten Anredegebrauch im Gegensatz zur Standardanrede.
Schlüsselwörter
Anredepronomina, Deutsch, Sprachgeschichte, Soziolinguistik, Pragmatik, Brown/Gilman, Power, Solidarity, Höflichkeit, Distanz, Empirie, Interviewanalyse, Generationen, Arbeitsplatzhierarchie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Anredepronominagebrauch im Deutschen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Anredepronominagebrauchs im Deutschen. Sie verbindet sprachhistorische Analysen mit empirischen Daten, um ein umfassendes Bild des Anredeverhaltens zu zeichnen und den Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht und sozialer Hierarchie zu beleuchten.
Welche Aspekte der Anrede werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die diachrone Entwicklung der Anredepronomina im Deutschen, soziolinguistische und pragmatische Ansätze zur Erklärung des Anredegebrauchs, die Analyse des aktuellen Anredeverhaltens im deutschsprachigen Raum sowie generationsübergreifende Unterschiede im Anredegebrauch.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert sprachhistorische Analysen mit empirischen Daten aus Interviews. Es werden drei Fallstudien mit Personen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Hintergründe vorgestellt, um das aktuelle Anredeverhalten zu analysieren.
Welche theoretischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene sprachwissenschaftliche Theorien, darunter das Modell von Brown/Gilman ("Power vs. Solidarity"), sowie pragmatische und grammatische Perspektiven. Wichtige Beiträge von Ammon, Kempf, Braun und Buchenau zur sozialen Funktion der Anrede und dem Einfluss von sozialer Distanz und Machtverhältnissen werden vorgestellt.
Welche historischen Entwicklungen werden betrachtet?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung der Anredepronomina im Deutschen von der Entstehung der Pluralanrede im indogermanischen Raum bis zur heutigen Vierzahl (Du/Ihr/Er/Sie/Sie). Sie analysiert gesellschaftliche und sprachliche Veränderungen, die die Anredeformen beeinflusst haben, und beleuchtet exemplarisch den Anredegebrauch im Werk Lessings.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirische Untersuchung präsentiert drei Fallstudien, die den Einfluss von Alter, Geschlecht und Arbeitsplatzhierarchie auf die Anredewahl zeigen. Die Analysen konzentrieren sich auf die Faktoren, die die Wahl zwischen formeller und informeller Anrede beeinflussen und beleuchten den konnotierten Anredegebrauch im Gegensatz zur Standardanrede.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anredepronomina, Deutsch, Sprachgeschichte, Soziolinguistik, Pragmatik, Brown/Gilman, Power, Solidarity, Höflichkeit, Distanz, Empirie, Interviewanalyse, Generationen, Arbeitsplatzhierarchie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Hintergrund, ein Kapitel zu sprachwissenschaftlichen Theorien, ein Kapitel zur empirischen Untersuchung und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über die Inhalte jedes Kapitels. Das Inhaltsverzeichnis gibt einen strukturierten Überblick über die einzelnen Unterkapitel.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, einen umfassenden Überblick über die diachrone Entwicklung der Anredeformen zu geben und diesen mit aktuellen pragmatischen und soziolinguistischen Ansätzen zu verknüpfen, um ein aktuelles Bild des Anredeverhaltens im deutschsprachigen Raum zu zeichnen.
- Arbeit zitieren
- Martin Stepanek (Autor:in), 2005, Zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Anredepronomina - Diachrone und pragmatische Überlegungen zum Anredepronominagebrauch im Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41754