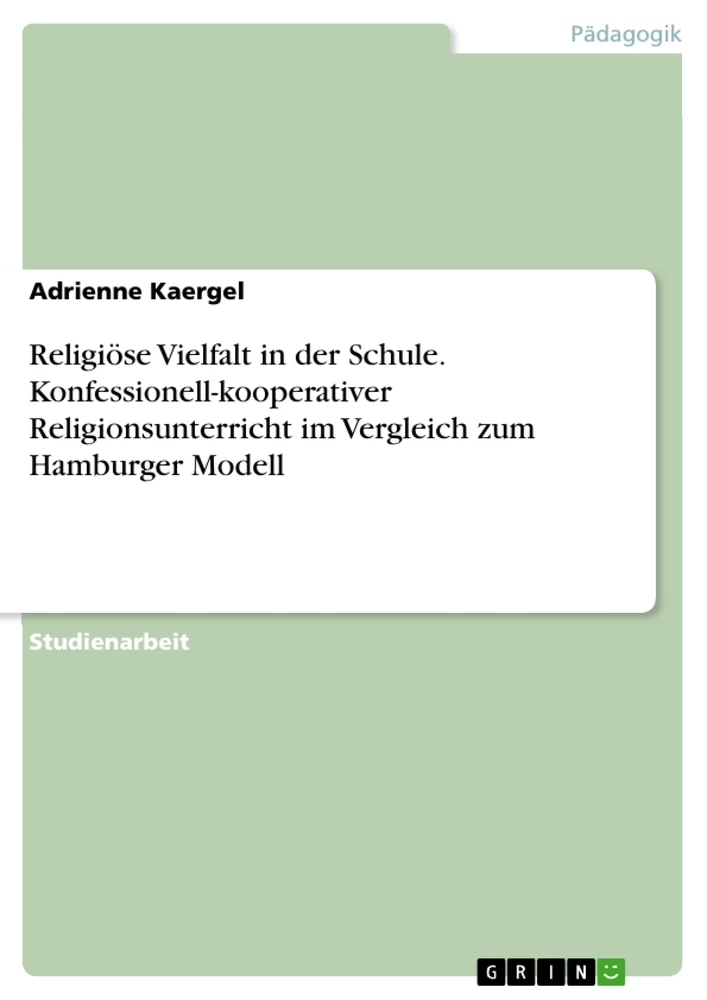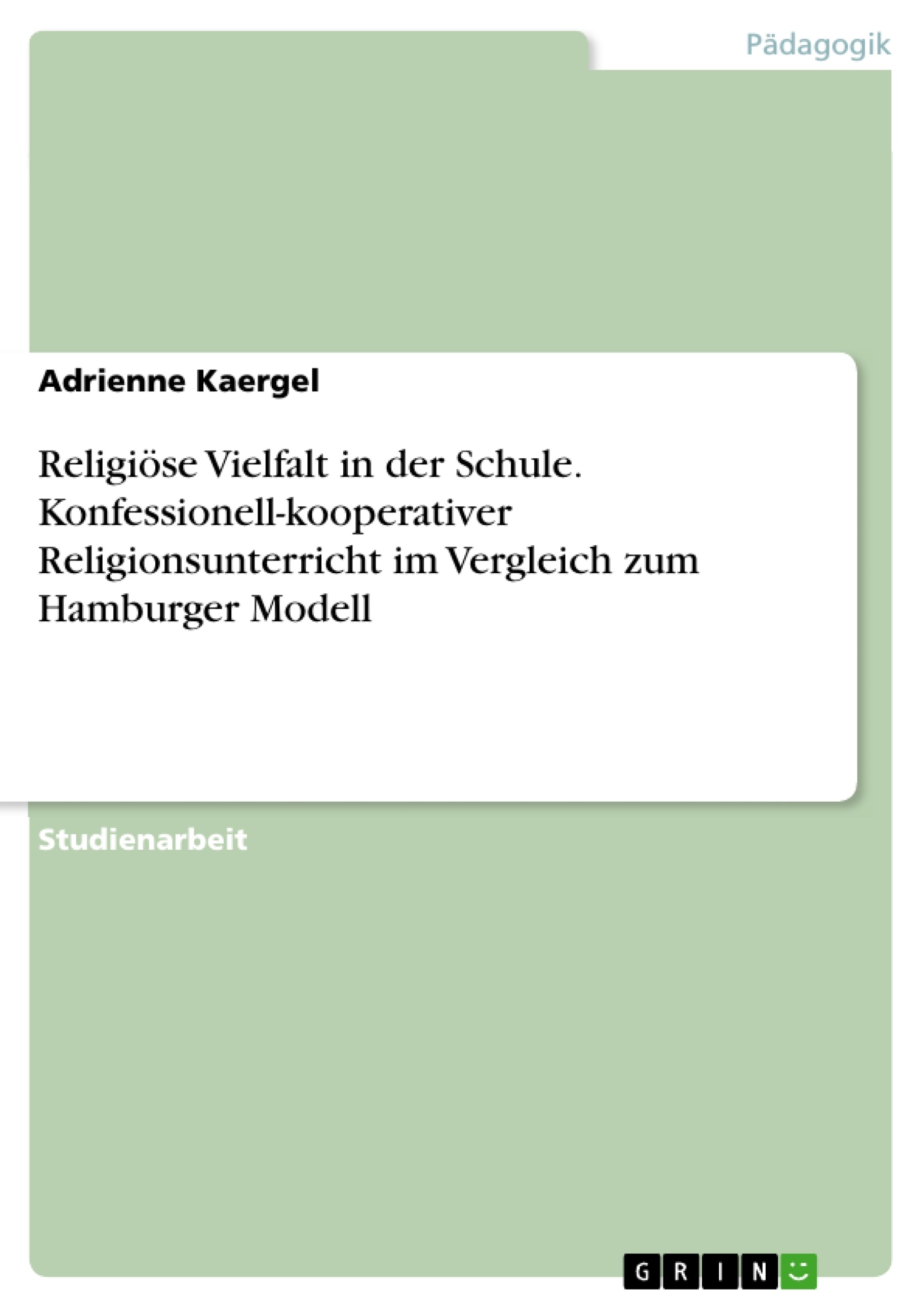Religionsunterricht zwischen Tradition und Aufbruch. Was bringen wir den Schüler(-innen) bei? Und vor allem wie?
Auf der einen Seite wird ein neues Bewusstsein, zur Förderung einer religiösen und interreligiösen Kompetenz, gefordert. Als Gründe werden unter anderem Konflikte aufgrund einer unreflektierten Religiosität genannt. Auf der anderen Seite jedoch wird eine Trennung der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Konfessionen – aufgrund der zunehmenden religiösen Vielfalt – als nicht mehr zukunftsfähiges Modell angesehen. Ein friedliches Miteinander sei nur in einem Religionsunterricht möglich, in dem alle partizipieren dürfen. Jedoch müssen auch hier Schwierigkeiten auf der schulorganisatorischen Ebene berücksichtigt werden. Aufgrund rückläufiger Geburtenraten und Taufen, kann rein konfessionell getrennter Religionsunterricht oft gar nicht mehr angeboten werden. Diese Erscheinungen betreffen ganz Deutschland, jedoch gibt es abhängig vom Bundesland, vom Stadtteil und von der Schulform große individuelle Unterschiede in der Art und Weise der Durchführung des Religionsunterrichtes. Als Folge dieser Herausforderungen gibt es daher inzwischen einige unterschiedliche Konzeptionen des Religionsunterrichtes, die versuchen sich den aktuellen Bedingungen anzupassen.
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll diese Problematik behandelt werden. Was bedeutet Religion heute noch in der Schule? Wie kann sich das Fach in einer säkularisierten, durch gesellschaftliche Veränderungen geprägten Gesellschaft durchsetzen? Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Modelle für den religiösen Lernprozess? Wo gibt es Vor- beziehungsweise Nachteile für die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, das Fach? Welche Zukunftsoptionen sind denkbar?
Diese wissenschaftliche Hausarbeit diente als Zulassungsarbeit für das erste Staatsexamen an Sekundarstufen in Baden-Württemberg und wurde mit der Note 1,5 bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung – Eine gemeinsame Herausforderung
- 2. Situationsanalyse – Eine Gesellschaft im Wandel
- 2.1 Gesellschaftliche und religiöse Entwicklung in Deutschland
- 2.2 Überzeugungswandel – Säkularisierung und Individualisierung
- 2.3 Länderspezifischer Umgang mit religiöser Pluralität
- 2.3.1 Geschichte des Religionsunterrichts in Deutschland
- 2.3.2 Rechtliche und organisatorische Grundlagen
- 3. Kirchliche Positionen
- 3.1 Katholische Perspektive
- 3.1.1 Unitatis redintegratio (1964)
- 3.1.2 Beschluss der Würzburger Synode (1974)
- 3.1.3 Die bildende Kraft des Religionsunterrichts (1996)
- 3.1.4 Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen (2005)
- 3.1.5 Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts (2016)
- 3.2 Evangelische Perspektive
- 3.2.1 Vorgeschichte
- 3.2.2 Identität und Verständigung (1994)
- 3.2.3 Zehn Thesen zum Religionsunterricht (2006)
- 3.2.4 Religiöse Orientierung gewinnen (2014)
- 3.2.5 Ökumene im 21. Jahrhundert (2015)
- 3.3 Fazit
- 3.1 Katholische Perspektive
- 4. Unterschiedliche Modelle von Religionsunterricht
- 4.1 Leitfragen und Ziele des Vergleichs
- 4.2 Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
- 4.2.1 Koko - was ist das?
- 4.2.2 Koko aus der Schülerperspektive
- 4.2.3 Koko aus der Lehrerperspektive
- 4.2.4 Weitere Perspektiven
- 4.3 Das Hamburger Modell
- 4.3.1 „Unterricht für alle“ - was ist das?
- 4.3.2 Hamburger Modell aus der Schülerperspektive
- 4.3.3 Hamburger Modell aus der Lehrerperspektive
- 4.3.4 Weitere Perspektiven
- 4.4 Vergleich beider Modelle
- 4.4.1 Konsequenzen des KoKo RU
- 4.4.2 Konsequenzen des Hamburger Modells
- 4.4.3 Diskussion
- 5. Entwicklung eines zukunftsweisenden Modells
- 5.1 Vom KoKo RU zum RKRU?
- 5.2 Neues Modell - neue Herausforderungen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie der Religionsunterricht im 21. Jahrhundert angesichts der zunehmenden religiösen Vielfalt gestaltet werden sollte. Im Fokus stehen dabei zwei unterschiedliche Modelle: der konfessionell-kooperative Religionsunterricht und der Religionsunterricht für alle. Die Arbeit analysiert die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung dieser Modelle geführt haben, untersucht die Positionen der Kirchen zum Religionsunterricht und vergleicht die beiden Modelle hinsichtlich ihrer Umsetzung und Auswirkungen.
- Die Entwicklung des Religionsunterrichts im Kontext der gesellschaftlichen und religiösen Veränderungen in Deutschland
- Die Rolle von Säkularisierung und Individualisierung für den Religionsunterricht
- Die Positionen der katholischen und evangelischen Kirche zum Religionsunterricht
- Der Vergleich des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts und des Hamburger Modells
- Die Herausforderungen und Chancen für ein zukunftsweisendes Modell des Religionsunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Kapitel 2 analysiert die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung alternativer Unterrichtsmodelle geführt haben. Kapitel 3 beleuchtet die Positionen der katholischen und evangelischen Kirche zum Religionsunterricht anhand wichtiger Dokumente. Kapitel 4 stellt den Hauptteil der Arbeit dar und vergleicht den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht und den Religionsunterricht für alle. Die beiden Modelle werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und hinsichtlich ihrer Umsetzung und Auswirkungen verglichen. Kapitel 5 entwickelt ein hypothetisches Modell, das sowohl die Vor- als auch die Nachteile der beiden Modelle berücksichtigt. Abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 6 zusammengefasst und kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht, Hamburger Modell, religiöse Vielfalt, Säkularisierung, Individualisierung, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Schülerperspektive, Lehrerperspektive.
- Citar trabajo
- Adrienne Kaergel (Autor), 2017, Religiöse Vielfalt in der Schule. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht im Vergleich zum Hamburger Modell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417873