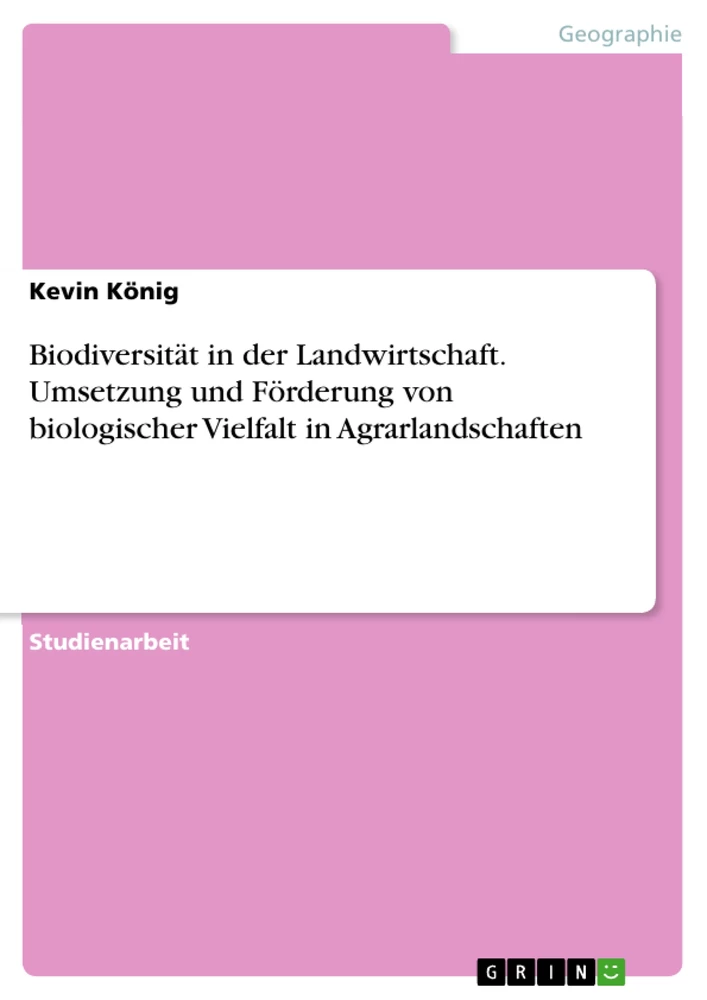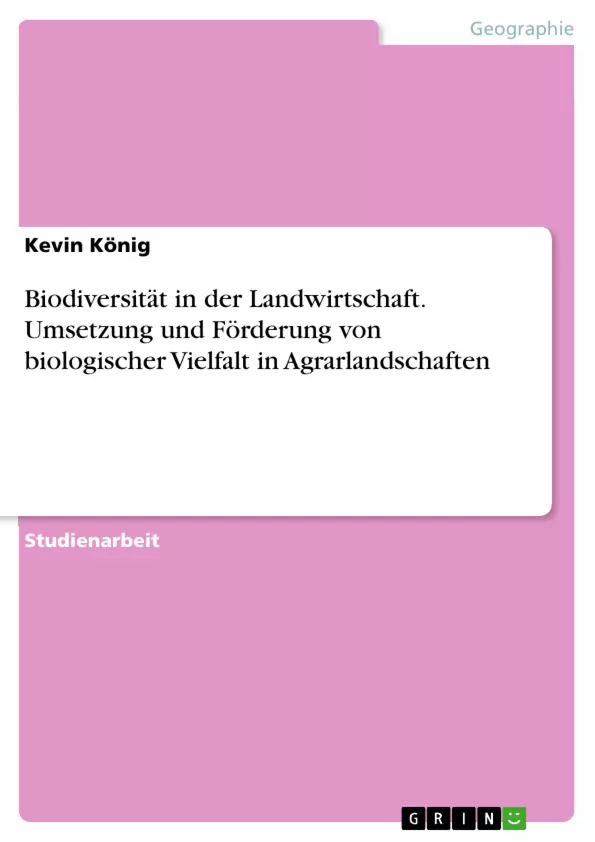In dieser Arbeit soll es darum gehen zu untersuchen, inwiefern die Biodiversität eine Rolle bei der bisherigen Ausrichtung der agrarwirtschaftlichen Strategien gespielt hat und diese weiterhin beeinflusst. Auf Basis der Klärung des Terminus "Biodiversität" soll es zu einer Darstellung der Korrelation zwischen Landwirtschaft und biologischer Vielfalt kommen. Dabei sollen neben theoretischen Konzepten der Gesellschaft-Umwelt-Forschung auch die (agrar-)politischen Rahmen der Implementierung von Biodiversität als relevanter Faktor der Agrarwirtschaft skizziert werden. Das erkenntnisleitende Interesse ist ferner eine komprimierte Untersuchung der Berücksichtigung und Förderung von Biodiversität durch verschiedene landwirtschaftliche Nutzformen. Daraus soll es anschließend zu einer normativen Beurteilung dieser Landnutzungsformen kommen, welche neben der Biodiversität auch die praktische Umsetzung berücksichtigen soll. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit mit Oberbegriffen wie "konventioneller-" und "ökologischer Landwirtschaft" gearbeitet wird und diese nicht in ihre spezifischeren Subformen aufgeteilt und erläutert werden.
Im gesellschaftlichen Diskurs steht gegenwärtig vor allem die Entscheidung des Konsumenten zwischen herkömmlichen oder biologisch nachhaltig angebauten Lebensmitteln. Dabei ist festzustellen, dass das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung in Deutschland ständig zunimmt. Der Konsens besteht ferner meist darin, dass es als sinnvoll und wichtig erachtet wird, dass die Umwelt geschont und Nutztiere eine artgerechte und ethisch vertretbare Haltung erfahren. Hierbei ist es jedoch auch von Interesse einen gleichzeitig spezifischeren und übergeordneten Blickwinkel auf die Legitimation verschiedener Agrarwirtschaftsformen anzunehmen: Biodiversität. Dieser Begriff ist gegenwärtig in sämtlichen interdisziplinären Forschungen zu den Themenbereichen "Mensch und Umwelt" oder "Nachhaltigkeit und Umweltschutz" aufzufinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Definition von „Biodiversität“
- Biodiversität in der Landwirtschaft
- Umsetzung von Biodiversitätsförderung in (post-)moderner Landwirtschaft.
- Berücksichtigung der Biodiversität in verschiedenen Landwirtschaftsformen.
- Fallbeispiel zum Vergleich von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Biodiversität in der Agrarwirtschaft und beleuchtet die Bedeutung dieser für die zukünftige Ausrichtung landwirtschaftlicher Strategien. Der Fokus liegt dabei auf der Klärung des Begriffs „Biodiversität“ und der Darstellung der Verbindung zwischen Landwirtschaft und biologischer Vielfalt.
- Definition und Bedeutung von Biodiversität im Kontext der Agrarwirtschaft
- Die Korrelation zwischen Landwirtschaft und biologischer Vielfalt
- Theoretische Konzepte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Implementierung von Biodiversität in der Agrarwirtschaft
- Die Berücksichtigung und Förderung von Biodiversität durch verschiedene Landnutzungsformen
- Normative Beurteilung der Landnutzungsformen unter Berücksichtigung von Biodiversität und praktischer Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die aktuelle Debatte um die Wahl zwischen konventionellen und biologisch nachhaltigen Lebensmitteln und hebt die zunehmende Bedeutung des Umweltbewusstseins hervor. Es führt den Begriff der Biodiversität als übergeordneten Aspekt der Legitimation von Agrarwirtschaftsformen ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
- Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel liefert eine kurze Sachanalyse zum Begriff „Biodiversität“ aus (bio-)geographischer Perspektive. Es definiert „Biodiversität“ als Akronym für „biologische Vielfalt“ und erläutert die verschiedenen Komplexitätsebenen von Biodiversität, nämlich genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt.
- Umsetzung von Biodiversitätsförderung in (post-)moderner Landwirtschaft: Dieses Kapitel untersucht die Berücksichtigung von Biodiversität in verschiedenen Landwirtschaftsformen. Es beleuchtet die Integration von Biodiversitätsaspekten in landwirtschaftliche Praktiken und veranschaulicht dies anhand eines Fallbeispiels zum Vergleich von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern Biodiversität, Agrarwirtschaft, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Gesellschaft-Umwelt-Forschung, ökologische Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft und Biodiversitätsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Biodiversität in der modernen Landwirtschaft?
Biodiversität ist ein zentraler Faktor für nachhaltige Agrarstrategien. Die Arbeit untersucht die Korrelation zwischen Landnutzung und dem Erhalt der biologischen Vielfalt.
Was sind die drei Ebenen der Biodiversität?
Dazu gehören die genetische Vielfalt innerhalb einer Art, die Artenvielfalt (Anzahl verschiedener Spezies) und die Ökosystemvielfalt (Vielfalt der Lebensräume).
Wie unterscheidet sich ökologische von konventioneller Landwirtschaft beim Artenschutz?
Ökologische Landwirtschaft fördert die Biodiversität meist stärker durch den Verzicht auf chemische Pestizide, während konventionelle Formen zunehmend neue Strategien zur Förderung der Vielfalt implementieren.
Warum nimmt das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung zu?
Immer mehr Konsumenten legen Wert auf Umweltschutz, artgerechte Tierhaltung und ethisch vertretbare Lebensmittelproduktion, was den Druck auf die Agrarwirtschaft erhöht.
Was ist das Ziel einer normativen Beurteilung von Landnutzungsformen?
Es geht darum, Landwirtschaftsformen nicht nur nach Ertrag, sondern auch nach ihrem Beitrag zum Erhalt der Ökosysteme und ihrer praktischen Umsetzbarkeit zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Kevin König (Autor:in), 2018, Biodiversität in der Landwirtschaft. Umsetzung und Förderung von biologischer Vielfalt in Agrarlandschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418102