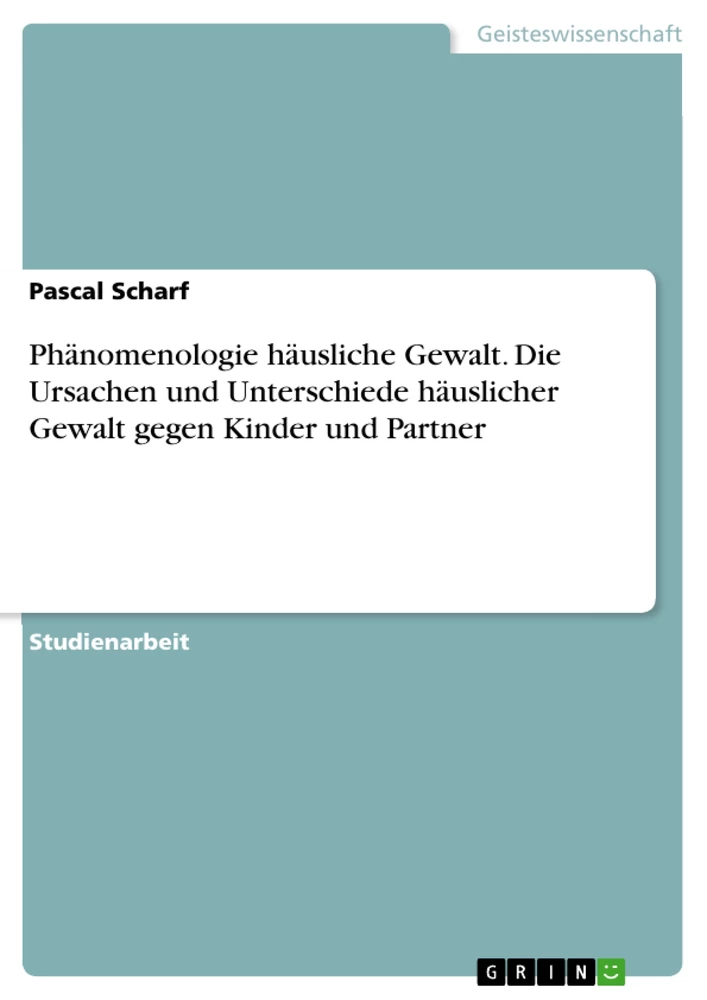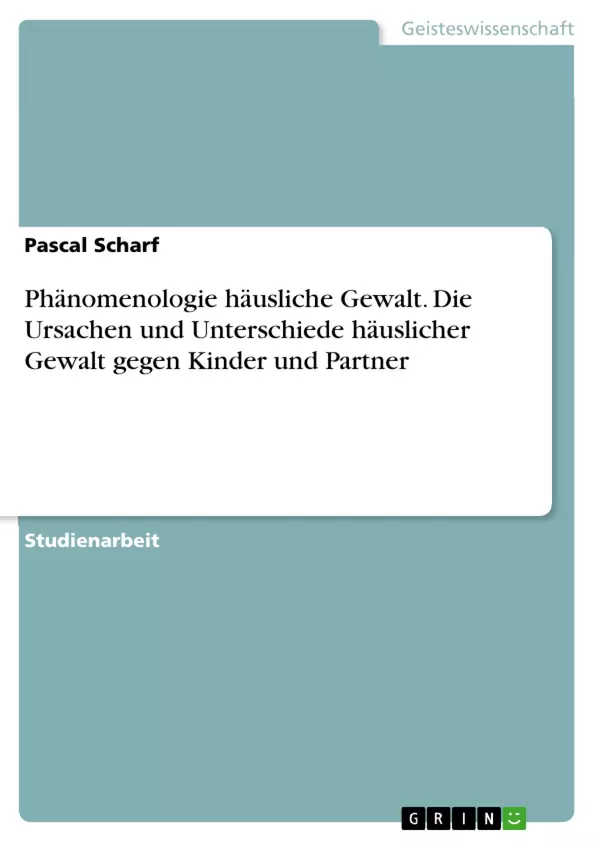In dieser Seminararbeit werden die verschiedenen Ursachen von häuslicher Gewalt gegen Partner und Kinder aufgezeigt und am verglichen. Dafür werden zunächst grundlegende Begriffe definiert und die einzelnen Erscheinungsformen der häuslichen Gewalt und deren Gewaltformen erläutert. Die Ursachen der Partnergewalt werden daraufhin herausgearbeitet, wobei der Schwerpunkt auf die Berufssituation, Machtposition und Alkoholsucht gelegt wird. Folgernd darauf werden die Ursachen der Kindesgewalt erwähnt, wo unter anderem die Frage aufkommt, inwiefern sich die Gewalt als Erziehungsmaßnahme äußert.
Alle darin gesammelten Ergebnisse werden mit Literatur belegt und teilweise mit Statistiken untermauert. Anschließend werden die gesammelten Ergebnisse gegenübergestellt und verglichen. Am Ende erfolgt eine Zusammenfassung der aufgezählten Aspekte. Die Gewalt an Kindern als Erziehungsmaßnahme wird kritisch beurteilt und Präventionsmaßnahmen hinsichtlich der Partnergewalt aufgezählt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgehensweise
- Begriffsbestimmungen
- Erscheinungsformen
- Gewaltformen
- Ursachen bei Partnergewalt
- Berufssituation und Alkohol
- Machtposition
- Ursachen bei Gewalt gegen Kinder
- Gewalt als körperliche Bestrafung
- Sexueller Missbrauch
- Vergleich der Ursachen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Hauptzweck dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Ursachen von häuslicher Gewalt gegen den Partner und gegen Kinder aufzuzeigen und anschließend zu vergleichen. Hierfür werden zunächst grundlegende Begriffe definiert. Es werden verschiedene Erscheinungsformen und Gewaltformen der häuslichen Gewalt beschrieben. Anschließend werden die Ursachen von Partnergewalt untersucht, mit einem Schwerpunkt auf Berufssituation, Machtposition und Alkoholsucht. Daraufhin werden die Ursachen von Gewalt gegen Kinder beleuchtet, mit besonderem Fokus auf die Frage, inwiefern Gewalt als Erziehungsmaßnahme in Erscheinung tritt. Alle Erkenntnisse werden mit Literatur belegt und teilweise durch Statistiken untermauert. Die Ergebnisse werden schließlich gegenübergestellt und verglichen. Zum Abschluss erfolgt eine Zusammenfassung der dargestellten Aspekte. Die Gewalt an Kindern als Erziehungsmaßnahme wird kritisch beurteilt und Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf die Partnergewalt aufgezählt.
- Definitionen von häuslicher Gewalt und deren Erscheinungsformen
- Unterscheidung der Ursachen von Gewalt gegen Partner und Kinder
- Analyse der Ursachen von Gewalt in Bezug auf Berufssituation, Machtposition und Alkoholsucht
- Bewertung von Gewalt als Erziehungsmaßnahme
- Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Partnergewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor, wobei zunächst grundlegende Begriffe wie häusliche Gewalt, Kind und Partner definiert werden. Das zweite Kapitel erläutert die vielseitigen Erscheinungsformen der häuslichen Gewalt, die von Partnergewalt über Eltern-Kind-Gewalt bis hin zu Geschwistergewalt reichen. Kapitel drei beleuchtet die verschiedenen Formen der Gewalt im häuslichen Kontext, während Kapitel vier sich mit den Ursachen von Partnergewalt auseinandersetzt, wobei der Fokus auf Berufssituation, Machtposition und Alkoholsucht liegt. Kapitel fünf befasst sich mit den Ursachen von Gewalt gegen Kinder, einschließlich der Frage, inwiefern Gewalt als Erziehungsmaßnahme angewendet wird. Kapitel sechs vergleicht die Ursachen von Partnergewalt und Gewalt gegen Kinder.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Partnergewalt, Kindesmisshandlung, Gewaltformen, Ursachen, Berufssituation, Machtposition, Alkoholsucht, Erziehungsmaßnahmen, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Partnergewalt?
Häufige Ursachen sind die berufliche Situation, Alkoholsucht und das Streben nach einer Machtposition innerhalb der Beziehung.
Wie unterscheidet sich Gewalt gegen Kinder von Partnergewalt?
Gewalt gegen Kinder wird oft fälschlicherweise als "Erziehungsmaßnahme" deklariert, während Partnergewalt meist aus Macht- und Kontrollmotiven entsteht.
Welche Rolle spielt Alkohol bei häuslicher Gewalt?
Alkohol wirkt enthemmend und kann bestehende Konflikte eskalieren lassen, ist jedoch oft nur ein verstärkender Faktor und nicht die alleinige Ursache.
Was ist unter "Gewalt als Erziehungsmaßnahme" zu verstehen?
Dies beschreibt die Anwendung körperlicher Bestrafung zur Disziplinierung von Kindern, was in der Arbeit kritisch beurteilt wird.
Welche Präventionsmaßnahmen gibt es gegen Partnergewalt?
Dazu gehören Beratungsstellen, Täterprogramme, Aufklärungskampagnen und rechtlicher Schutz durch das Gewaltschutzgesetz.
- Quote paper
- Pascal Scharf (Author), 2017, Phänomenologie häusliche Gewalt. Die Ursachen und Unterschiede häuslicher Gewalt gegen Kinder und Partner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418432