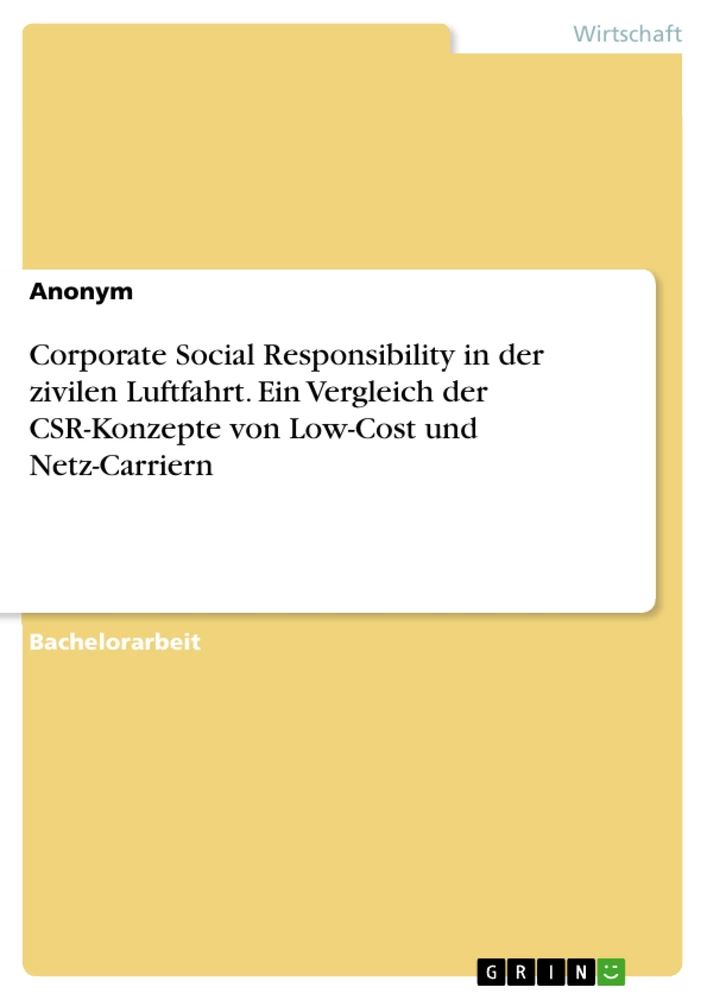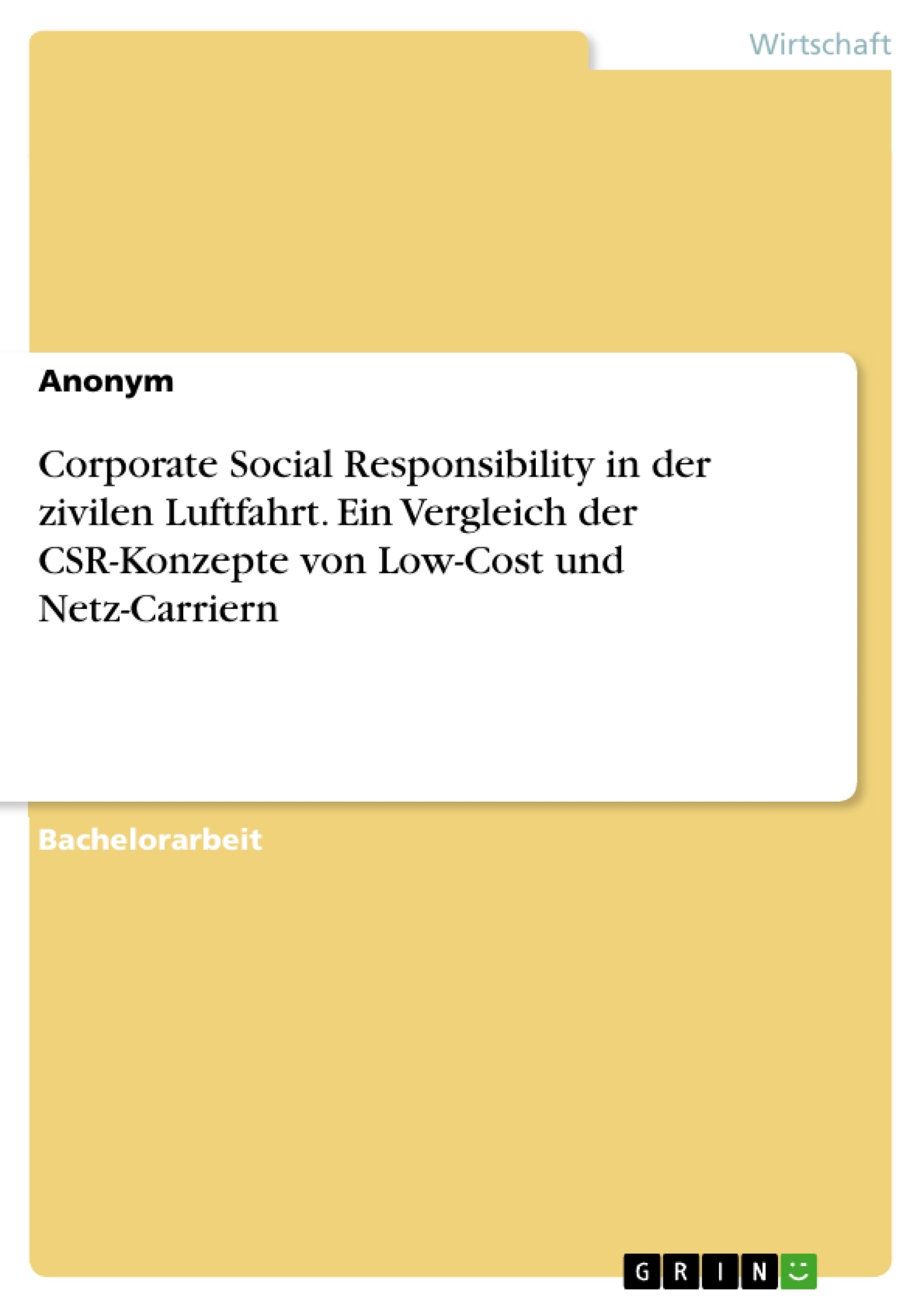Die Ausführungen in dieser Bachelorarbeit betrachten die Corporate Social Responsibility-Strategien in der zivilen Luftfahrt. Es wird hinterfragt, wie CSR-Strategien von vier Fluggesellschaften gestaltet werden und wie sie im Vergleich miteinander bestehen. Die Forschungsfragen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen, sind zum einen, welche Kriterien für einen Vergleich von Fluglinien mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen gewählt werden können, und zum anderen, wie sie dabei in einem Vergleich bestehen. Dabei wurden luftfahrtrelevante CSR-Aktivitäten der drei Dimensionen ökologisch, sozial und ökonomisch gewählt. In einer Analyse der Handlungsfelder wurden diese Bereiche gewichtet und mit Punkten bewertet. Als wichtigstes Ergebnis kann vorweggenommen werden, dass die CSR-Engagements von Low-Cost-Airlines nicht zwingend erheblich schlechter eingestuft werden müssen als die der Netzwerk-Airlines.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung und Ausgangssituation
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Motivation und Forschungsfrage
- 1.3 Perspektive und Methode
- 1.4 Quellenlage und Stand der Forschung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Corporate Social Responsibility
- 2.2 Abgrenzung zu verwandten Konzepten
- 2.2.1 Corporate Citizenship
- 2.2.2 Corporate Social Investment
- 2.2.3 Corporate Governance
- 2.2.4 Stakeholder-Theorie
- 2.3 Semantisches Netz
- 2.4 CSR in der zivilen Luftfahrt
- 2.4.1 Netzwerk-Airlines
- 2.4.2 Low-Cost-Carrier
- 3 Auswahl der Luftverkehrsgesellschaften
- 3.1 Netzwerk-Airlines
- 3.1.1 Air France-KLM
- 3.1.2 Lufthansa-Gruppe
- 3.2 Low-Cost-Carrier
- 3.2.1 Ryanair
- 3.2.2 EasyJet
- 3.3 Kennzahlen und Leistungsdaten im Vergleich
- 3.1 Netzwerk-Airlines
- 4 Kriterien und Gewichtung für den Vergleich von CSR-Konzepten
- 4.1 Kategorisierung und Auswertung mittels Punktwertanalyse
- 4.2 Checkliste einer CSR-Berichterstattung
- 4.3 Bewertung
- 4.3.1 Ökologische Verantwortung: Abfallvermeidung
- 4.3.2 Ökologische Verantwortung: Treibstoffverbrauch und Emissionen
- 4.3.3 Ökologische Verantwortung: Lärm
- 4.3.4 Ökonomische Verantwortung: Kundenorientierung
- 4.3.5 Ökonomische Verantwortung: Corporate Governance
- 4.3.6 Soziale Verantwortung: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 4.3.7 Soziale Verantwortung: Gesellschaftliches Engagement
- 4.3.8 Form, Umfang, Glaubwürdigkeit
- 4.4 Punktwertanalyse
- 4.5 Ergebnisse im Netzdiagramm
- 5 Fazit
- 5.1 Limitation der Untersuchung
- 5.2 Ergebnisse
- 5.3 Handlungsempfehlungen für Fluggesellschaften
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Corporate Social Responsibility (CSR)-Strategien in der zivilen Luftfahrt. Die Arbeit analysiert, wie CSR-Strategien von vier Fluggesellschaften gestaltet werden und wie sie im Vergleich zueinander bestehen. Dabei werden die CSR-Aktivitäten in den drei Dimensionen ökologisch, sozial und ökonomisch betrachtet.
- Vergleich von CSR-Konzepten verschiedener Fluggesellschaften
- Analyse der CSR-Aktivitäten in den Bereichen ökologisch, sozial und ökonomisch
- Bewertung der CSR-Strategien von Low-Cost-Carriern und Netzwerk-Airlines
- Entwicklung von Kriterien und Gewichtungsschemata für den Vergleich der CSR-Strategien
- Identifizierung von Handlungsempfehlungen für Fluggesellschaften zur Verbesserung ihrer CSR-Aktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der CSR in der zivilen Luftfahrt ein und erläutert die Motivation und Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen von CSR und grenzt dieses Konzept von verwandten Konzepten wie Corporate Citizenship, Corporate Social Investment, Corporate Governance und der Stakeholder-Theorie ab. Anschließend werden Netzwerk-Airlines und Low-Cost-Carrier im Kontext von CSR betrachtet. Kapitel 3 präsentiert die ausgewählten Luftverkehrsgesellschaften und stellt sie anhand relevanter Kennzahlen und Leistungsdaten vor. Kapitel 4 definiert die Kriterien und Gewichtungsschemata für den Vergleich der CSR-Konzepte. Es werden verschiedene Aspekte wie ökologische Verantwortung, ökonomische Verantwortung und soziale Verantwortung betrachtet. Die Ergebnisse der Punktwertanalyse werden in einem Netzdiagramm dargestellt.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility, Luftfahrt, Fluggesellschaften, Low-Cost-Carrier, Netzwerk-Airlines, CSR-Konzepte, ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung, ökonomische Verantwortung, Punktwertanalyse, Netzdiagramm, Handlungsempfehlungen
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet CSR in der zivilen Luftfahrt?
CSR steht für Corporate Social Responsibility und bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung von Fluggesellschaften in ökologischen, sozialen und ökonomischen Bereichen.
Welche Fluggesellschaften werden in dieser Arbeit verglichen?
Es werden Netzwerk-Airlines (Lufthansa, Air France-KLM) mit Low-Cost-Carriern (Ryanair, EasyJet) verglichen.
Welche ökologischen Kriterien sind für den Vergleich relevant?
Wichtige Kriterien sind die Abfallvermeidung, der Treibstoffverbrauch, Emissionen (CO2) und die Lärmbelastung durch den Flugbetrieb.
Haben Low-Cost-Airlines zwangsläufig schlechtere CSR-Konzepte?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass Low-Cost-Airlines in bestimmten Bereichen (z. B. Effizienz beim Treibstoffverbrauch) nicht zwingend schlechter abschneiden als Netzwerk-Airlines.
Was ist das Ziel der Stakeholder-Theorie im Kontext von CSR?
Sie zielt darauf ab, die Interessen aller betroffenen Gruppen (Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, Umwelt) in die Unternehmensstrategie einzubeziehen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Corporate Social Responsibility in der zivilen Luftfahrt. Ein Vergleich der CSR-Konzepte von Low-Cost und Netz-Carriern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418480