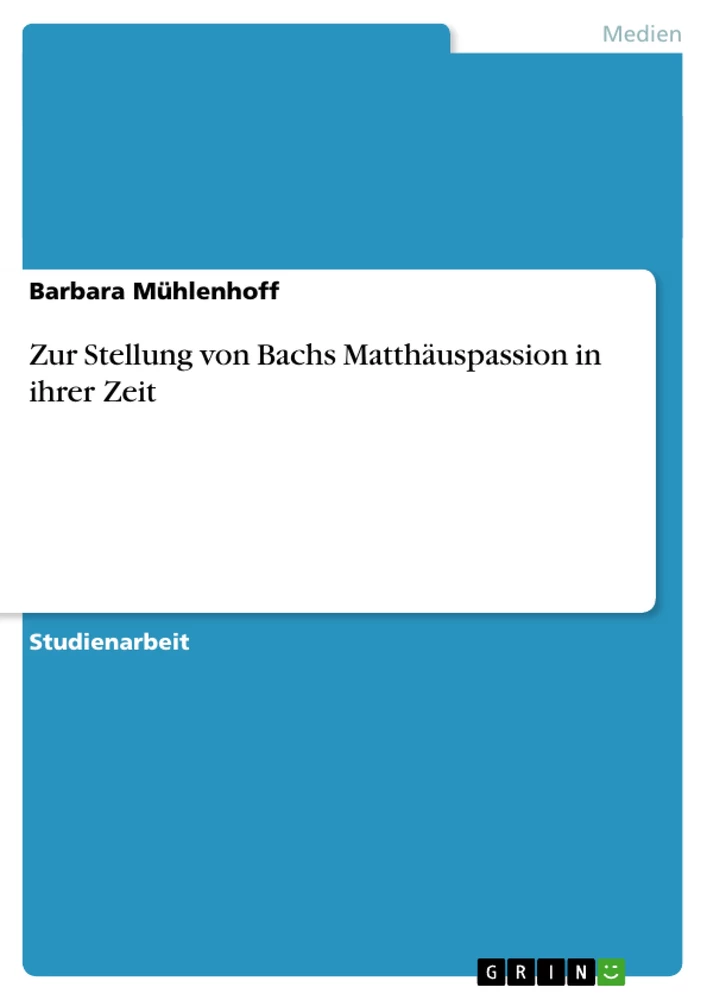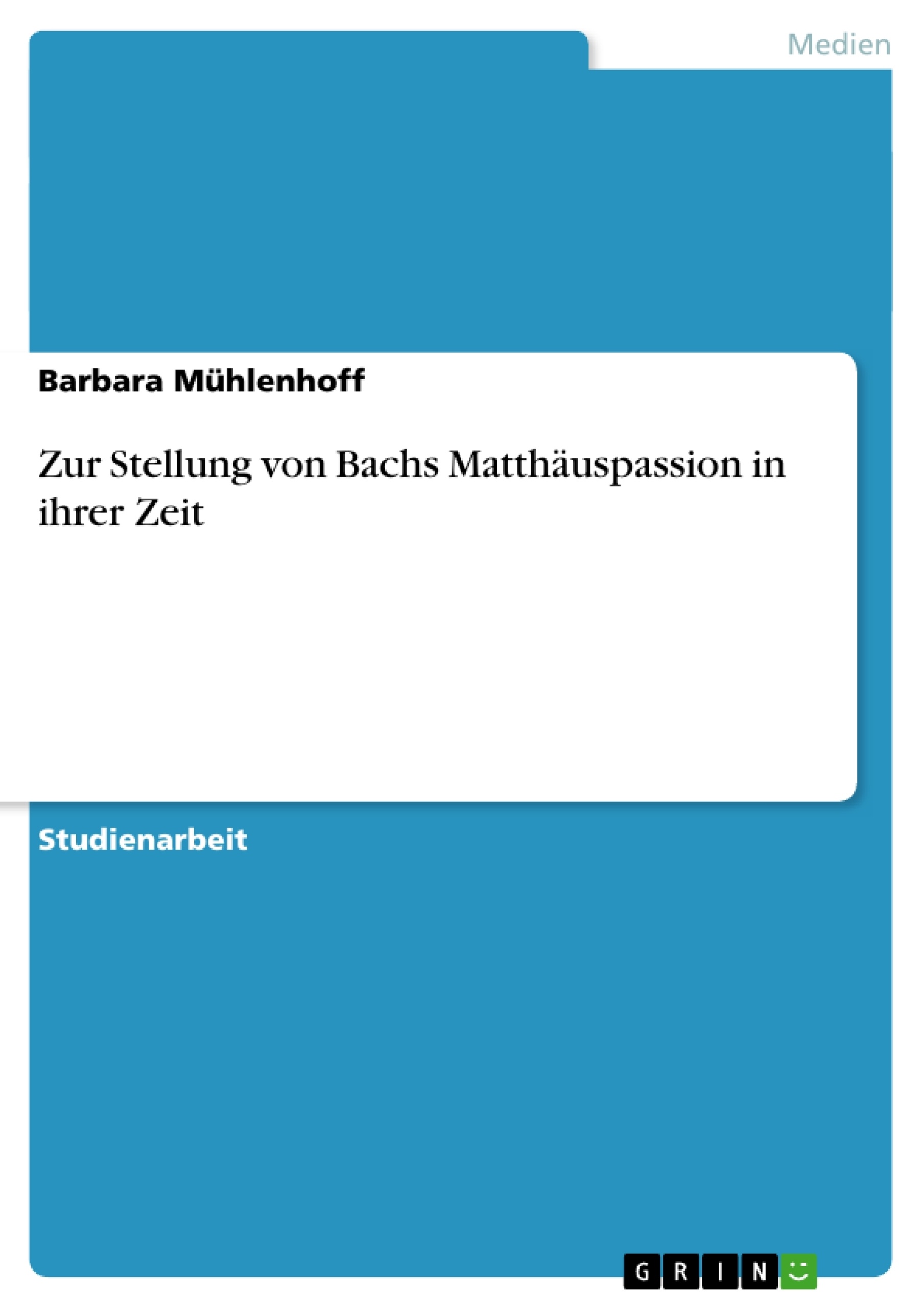J. S. Bach wird 1685 in den Schoß einer protestantischen Musikerfamilie geboren. Im April 1723 wählt ihn der Rat der Stadt Leipzig zum Thomaskantor, und Bach widmet sich hier nach einer weltlichen Stellung wieder der geistlichen Musik. Seine Aufgabe in Leipzig ist, in den beiden Hauptkirchen für die musikalische Verkündigung der heiligen Schrift zu sorgen.
Das Kirchenjahr strukturiert das Leben der Leipziger Gemeinde. Der Karfreitag bindet insofern eine gewisse Erwartenshaltung der Kirchengänger an den Gottesdienst an sich. Ab 1721 werden in der Thomaskirche oratorische Passionsmusiken in den Vespergottesdienst eingeführt, damals noch unter dem Thomaskantor Johannes Kuhnau. In diesem Zusammenhang erscheint die Matthäus-Passion Bachs als selbstverständliches liturgisches Auftragswerk. Der äußere Aufbau der Matthäus-Passion ist dem angepaßt: Sie ist zweigeteilt, zwischen den Teilen soll die Predigt gehalten werden. Jedoch steht die Matthäus-Passion Bachs insgesamt in einem besonderen Licht. Am Anfang des ersten Teils steht das Exordium, das die Gemeinde zur Sammlung aufruft und auf die Passion einstimmt. Dieser Teil nimmt einen großen Rahmen ein: Zwei Chöre stellen eine Gruppe von Gläubigen dar, die die Töchter der Stadt Jerusalem, die Töchter Zions, anrufen: „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“. In diese Bitte hinein erklingt von einem dritten, einstimmigen Chor der Passionschoral „O Lamm Gottes, unschuldig“. Die beiden Hauptchöre rufen sich Fragen und Antworten zu, die jeweils in einer Choralzeile enden. Im Anschluß beginnt die Vorgeschichte mit der Leidensankündigung. Nach dem Einsatz des Evangelisten erklingen die ersten Jesusworte: „Ihr wisset, daß nach zweien Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden.“ Die Gemeinde mischt sich hiernach fragend ein:“ Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen?“. Solch eine geradezu opernhafte Darstellung war in der Kirche nicht gerne gesehen und verunsicherte die Gemeinde. Der Dichter Christian Friedrich von Henrici hatte seine Textvorlage nicht auf Zweichörigkeit angelegt. Wieso gestaltet Bach seine Matthäus-Passion so elaboriert und läßt sie aus dem gewohnten Rahmen fallen? Anhaltspunkte, wieso die Matthäus-Passion aus dem damals Üblichen herauszuragen scheint, werden in der vorliegenden Arbeit anhand einer Beschreibung der Entstehungsgeschichte und des Aufbaus behandelt, um sie abschließend in Bezug auf andere Passionen ihrer Zeit einordnen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Passion
- Die Matthäus-Passion
- Entstehungsgeschichte und Wiederaufführung
- Aufbau
- Die Matthäus-Passion in ihrer Zeit
- Die Zeit des Barock
- Andere Passionen
- Zur Rezeptionsgeschichte
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Stellung von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion im Kontext ihrer Entstehung und Rezeption. Der Fokus liegt auf der Analyse des Werkes im Lichte der zeitgenössischen musikalischen Praxis, insbesondere im Vergleich zu anderen Passionen des Barock. Die Arbeit erörtert die Herausforderungen, die Bachs Matthäus-Passion in ihrer Zeit mit sich brachte, und ihre Bedeutung für die musikalische Geschichte.
- Die Rolle der Matthäus-Passion in der protestantischen Liturgie
- Die Bedeutung der Zweichörigkeit und des dramatischen Aufbaus
- Der Vergleich mit anderen Passionen der Zeit
- Die Reaktion der Gemeinde auf Bachs Werk
- Die Bedeutung der Matthäus-Passion für die musikalische Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Leben und Wirken Johann Sebastian Bachs ein und beschreibt den Hintergrund seiner Komposition der Matthäus-Passion. Es beleuchtet die Rolle der Passion in der protestantischen Liturgie und die Tradition der musikalischen Passionen. Das zweite Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in die Passion als literarisches und musikalisches Genre. Es beschreibt die Geschichte der Passion und ihre literarischen und musikalischen Elemente. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Matthäus-Passion von Bach. Es diskutiert die Entstehungsgeschichte des Werkes, seinen Aufbau und seine Besonderheiten. Das vierte Kapitel untersucht die Matthäus-Passion im Kontext ihrer Zeit. Es vergleicht das Werk mit anderen Passionen der Zeit und beleuchtet die Herausforderungen, die Bachs Komposition in der damaligen Zeit mit sich brachte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Musikgeschichte, darunter die protestantische Liturgie, die musikalische Passion, Johann Sebastian Bach, die Matthäus-Passion, Barockmusik, Zweichörigkeit, Dramaturgie und Rezeption. Der Text befasst sich zudem mit den Herausforderungen, die Bachs Werk in seiner Zeit mit sich brachte, und mit der Bedeutung seiner Komposition für die Entwicklung der Musikgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde Johann Sebastian Bach Thomaskantor in Leipzig?
Bach wurde im April 1723 vom Rat der Stadt Leipzig zum Thomaskantor gewählt.
Wie ist die Matthäus-Passion strukturell aufgebaut?
Die Passion ist zweigeteilt, wobei zwischen den beiden Teilen traditionell die Predigt im Gottesdienst gehalten wurde.
Was war das Besondere an der musikalischen Gestaltung der Matthäus-Passion?
Bach gestaltete sie sehr elaboriert und zweichörig, was eine fast opernhafte Darstellung ergab, die in der damaligen Kirche teils kritisch gesehen wurde.
Wer schrieb die Textvorlage für Bachs Matthäus-Passion?
Die Textvorlage stammt von dem Dichter Christian Friedrich von Henrici, auch bekannt unter dem Pseudonym Picander.
Was ist das "Exordium" in diesem Werk?
Das Exordium ist der Eröffnungschor ("Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen"), der die Gemeinde zur Sammlung aufruft und auf die Passion einstimmt.
- Citation du texte
- M.A. Barbara Mühlenhoff (Auteur), 2000, Zur Stellung von Bachs Matthäuspassion in ihrer Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41859