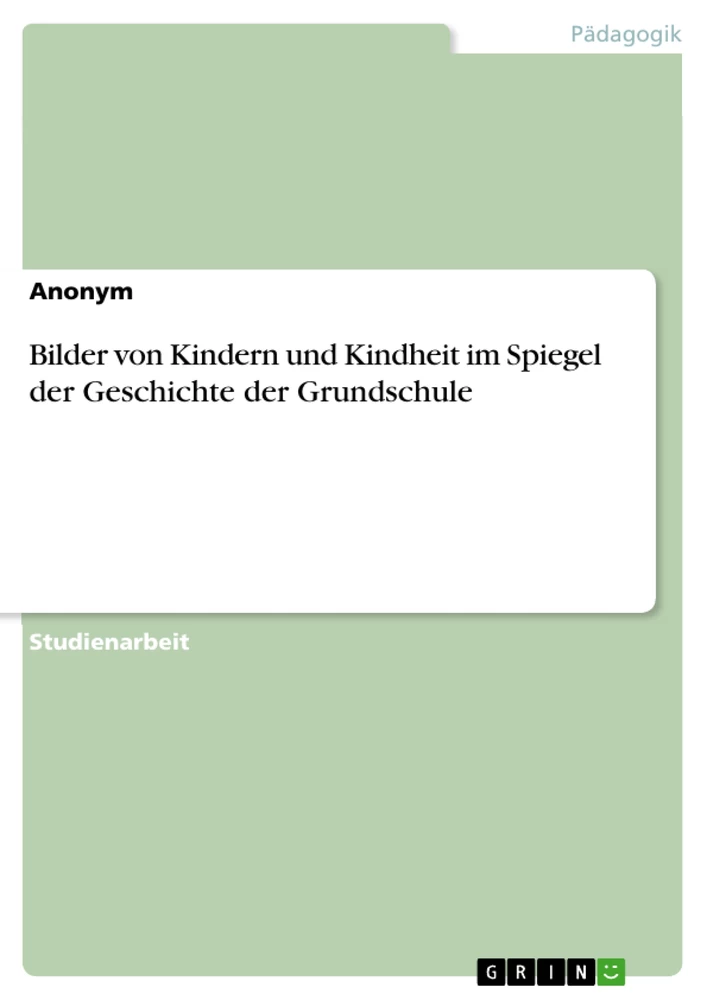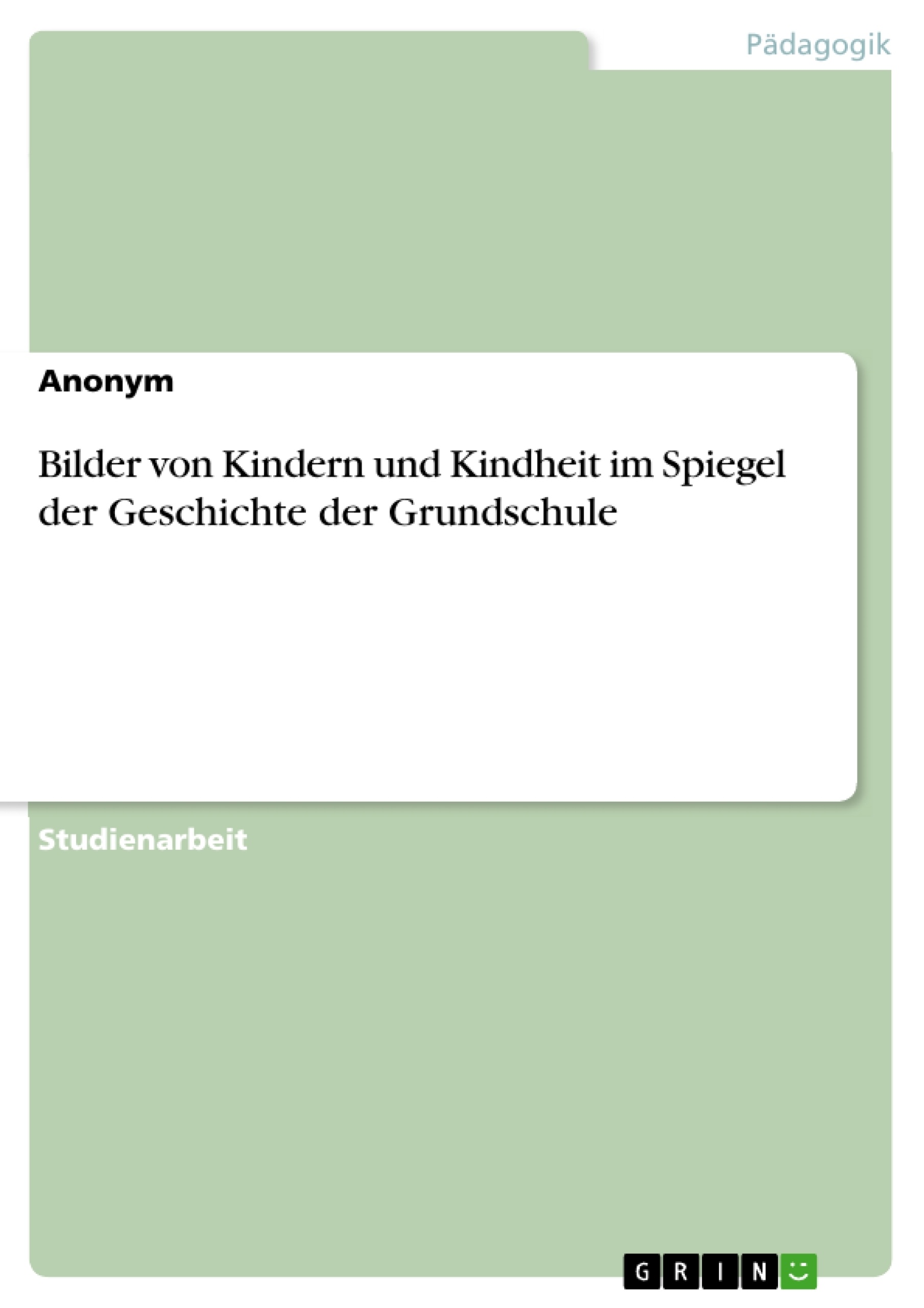Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Kind- und Kindheitsbilder anhand der Geschichte der Grundschule ablesbar sind. Diesem Vorhaben liegen drei zusammenhängende Thesen zu Grunde. Erstens, anhand einer historischen Betrachtung der Grundschulentwicklung in Deutschland, werden Kindheitsbilder widergespiegelt. Hiermit zusammenhängend zweitens die Annahme, dass diese Kindheitsbilder wiederum für die Entwicklung der (Grund-)Schule bedeutsam waren und diese beeinflussten. Der Blick auf die Geschichte der Grundschule steht somit in einem engen Verhältnis zu Bildern von Kindern und Kindheit. Drittens, Kindheitsbilder unterliegen generell den gesellschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen und Bedingungen.
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Geschichte der Grundschule im Zeitraum von ca. 1850 bis 1965. Als Basis dient der Text von Götz & Sandfuchs (2014). Auf Grund fehlenden Platzes und dem geringen Rahmen dieser Arbeit, wird auf eine Bestandsaufnahme früherer und späterer Geschichte(n) der Grundschule verzichtet. Es wird darauf verwiesen, dass nur Aspekte der historischen Entwicklung angesprochen werden und die Darstellungen vereinfacht sind.
Obwohl ein historischer Blick auf die Geschichte der Grundschule geworfen wird, gilt es nicht, eine historische Betrachtung der Kindheitsbilder anzufertigen. Vielmehr ist es die These, dass „...Bilder von Kindern und Begriffe von Kindheit [...] in starkem Maße von der Konstruktionsleistung Erwachsener abhängig“ (Deckert-Peaceman et al. 2010: 29) sind und einem dauernden „historischen Wandel“ (Deckert-Peaceman et al. 2010: 29) unterliegen. Diese Konstruktionen von Kindheit im historischen Wandel möchte diese Arbeit in Aspekten ableiten, zusammentragen und benennen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HISTORIE DER GRUNDSCHULE UND IHRE KINDHEITSBILDER
- DIE VORGESCHICHTE DER GRUNDSCHULE (BIS 1919)
- BILDER VON KINDHEIT - KINDHEITSBILDER I
- DIE GRUNDSCHULE WÄHREND DER WEIMARER REPUBLIK (1920 - 1933)
- BILDER VON KINDHEIT - KINDHEITSBILDER II
- DIE GRUNDSCHULE WÄHREND DES NATIONALSOZIALISMUS (1933-1945)
- BILDER VON KINDHEIT - KINDHEITSBILDER III
- DIE GRUNDSCHULE WÄHREND DER REKONSTRUKTION (1945-1965)
- BILDER VON KINDHEIT - KINDHEITSBILDER IV
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Kind- und Kindheitsbilder anhand der Geschichte der Grundschule erkennbar sind. Die Arbeit basiert auf drei zentralen Thesen: Erstens spiegelt die historische Entwicklung der Grundschule in Deutschland Kindheitsbilder wider. Zweitens beeinflussen diese Kindheitsbilder die Entwicklung der Grundschule. Drittens unterliegen Kindheitsbilder gesellschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen.
- Historische Entwicklung der Grundschule und ihre Auswirkungen auf Kindheitsbilder
- Bedeutung von Kindheitsbildern für die Entwicklung der Grundschule
- Einfluss gesellschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Faktoren auf Kindheitsbilder
- Die Rolle von Bildung und Erziehung in der Konstruktion von Kindheitsbildern
- Die Bedeutung von Kindgemäßheit im Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die Vorgeschichte der Grundschule bis 1919 und analysiert die vorherrschenden Kindheitsbilder in dieser Zeit. Es zeigt auf, wie die unterschiedlichen Schulformen die gesellschaftlichen Strukturen und Erwartungen an Kinder widerspiegelten. Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundschule während der Weimarer Republik und ihre Rolle in der Gestaltung der Kindheitsbilder in dieser Epoche. Es wird analysiert, wie die Einführung der allgemeinen Grundschule zu einer Veränderung der Bildungsideale und der Wahrnehmung von Kindheit führte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Bereiche Kindheitsbilder, Grundschule, Geschichte der Grundschule, Schulsystem, Bildungsideale, Gesellschaftliche Entwicklung, Reformpädagogik, Einheitsschule, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Rekonstruktion, Kindgemäßheit, Bildung und Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Grundschulgeschichte und Kindheitsbilder zusammen?
Die Arbeit zeigt auf, dass die historische Entwicklung der Grundschule in Deutschland stets die damals vorherrschenden Bilder von Kindern und Kindheit widerspiegelt.
Welchen Zeitraum deckt die historische Untersuchung ab?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Geschichte der Grundschule zwischen etwa 1850 und 1965.
Wie veränderten sich Kindheitsbilder während des Nationalsozialismus?
Die Arbeit analysiert im dritten Kapitel spezifisch die Konstruktion von Kindheitsbildern unter den ideologischen Bedingungen des Nationalsozialismus (1933-1945).
Was bedeutet „Kindgemäßheit“ in der Grundschulreform?
Es ist ein zentraler Begriff, der beschreibt, wie Bildungsprozesse an die (jeweils zeitgenössisch konstruierte) Natur des Kindes angepasst werden sollen.
Werden Kindheitsbilder als objektive Fakten betrachtet?
Nein, die Arbeit geht davon aus, dass Kindheitsbilder Konstruktionsleistungen von Erwachsenen sind, die einem stetigen historischen Wandel unterliegen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Bilder von Kindern und Kindheit im Spiegel der Geschichte der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418606