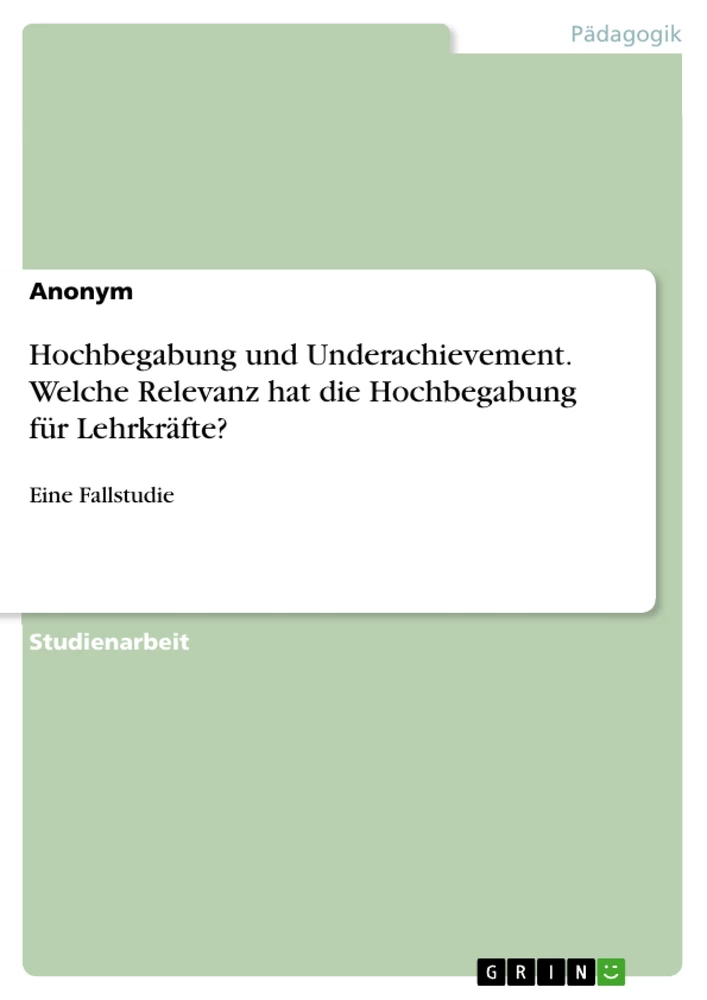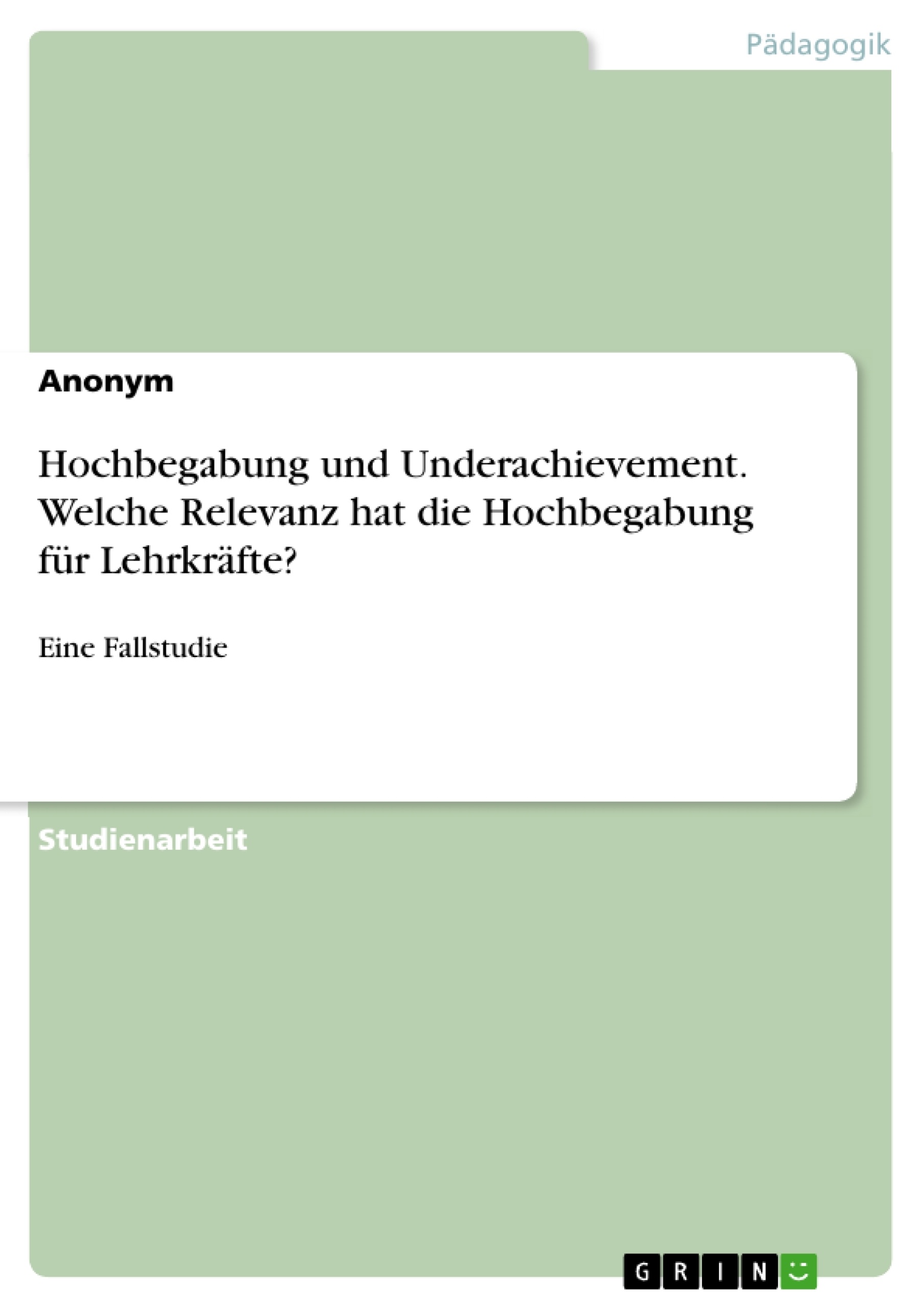Diese Arbeit stellt sich die Frage, welche Maßnahmen Lehrkräfte zur Förderung und Unterstützung hochbegabter Schüler und Schülerinnen (SuS) ergreifen können. Die Erarbeitung des Begriffs Hochbegabung und die damit verbundenen Ideen und Theorien werden am Fallbeispiel des 12-jährigen P.s veranschaulicht.
Auf Grund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit, können nur fragmentarische und punktuelle Themenkomplexe der Hochbegabung und des Hochbegabungsbegriffs dargestellt werden, die sich auf die intellektuelle Hochbegabung beschränken. Konstrukte, wie Kreativität werden nur benannt. Teil 3 beginnt mit der Definition von Hochbegabung, Modellen und der Darstellung von Merkmalen der Hochbegabung und möglicher Diagnostikinstrumente. In Teil 4 wird das Phänomen des Underachievements in der Hochbegabung betrachtet. Über die Beschreibung allgemeiner Faktoren, die zum Underachievement führen können, werden am Fallbeispiel Philipps musterhaft diese Faktoren dargestellt und aufgeführt. Um die Ausgangsfrage zu beantworten, werden unter Teil 5 Präventions- und Interventionsmaßnahmen im schulischen und außerschulischen Kontext dargestellt, die in einem weiteren Schritt beispielhaft an Philipp angewandt werden können. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion in Teil 6.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER FALL P.
- DIE HOCHBEGABUNG
- WAS IST HOCHBEGABUNG?
- MERKMALE DER HOCHBEGABUNG
- DIAGNOSTIK DER HOCHBEGABUNG
- „UNDERACHIEVEMENT“
- ALLGEMEINE FAKTOREN DES „UNDERACHIEVEMENTS“
- „UNDERACHIEVEMENT“ IM FALLE P.S
- PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSMAßNAHMEN
- INNER- UND AUBERSCHULISCHE MAẞNAHMEN
- INTERVENTIONSPLAN FÜR P.
- DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Hochbegabung im schulischen Kontext und erörtert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Die Zielsetzung ist es, ein besseres Verständnis für die besonderen Bedürfnisse hochbegabter Kinder zu entwickeln und konkrete Maßnahmen für deren Unterstützung aufzuzeigen.
- Definition von Hochbegabung und ihre Bedeutung für den schulischen Kontext
- Das Phänomen des Underachievements bei Hochbegabten
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler
- Die Rolle von Lehrkräften in der Identifizierung und Unterstützung von hochbegabten Kindern
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Schule, Eltern und Fachleuten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Thematik der Hochbegabung in der Sonderpädagogik vor und stellt den Schwerpunkt der Arbeit dar, welcher die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler beleuchtet.
- Kapitel 2 präsentiert den Fall des 12-jährigen P.s, der als Beispiel für ein hochbegabtes Kind dient. Es wird die intellektuelle Entwicklung, die schulische Situation und die Herausforderungen, mit denen P. konfrontiert ist, beschrieben.
- In Kapitel 3 wird der Begriff der Hochbegabung beleuchtet. Die Definition und die verschiedenen Modelle der Hochbegabung werden vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Außerdem werden Merkmale der Hochbegabung und gängige Diagnostikinstrumente beschrieben.
- Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Phänomen des Underachievements bei Hochbegabten. Es werden allgemeine Faktoren, die zum Underachievement führen können, sowie der Fall P.s im Hinblick auf diese Faktoren betrachtet.
- Kapitel 5 befasst sich mit möglichen Präventions- und Interventionsmaßnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler im schulischen und außerschulischen Kontext. Im Anschluss werden diese Maßnahmen beispielhaft auf P. angewandt.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Underachievement, Förderung, Präventionsmaßnahmen, Interventionsmaßnahmen, Sonderpädagogik, Schule, Lehrkräfte, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Underachievement“ bei Hochbegabten?
Underachievement bezeichnet eine Situation, in der die schulischen Leistungen eines Schülers deutlich hinter seinem tatsächlichen intellektuellen Potenzial zurückbleiben.
Wie kann Hochbegabung diagnostiziert werden?
Die Diagnose erfolgt meist durch Intelligenztests, Beobachtungsbögen der Lehrkräfte und Gespräche mit den Eltern, um ein umfassendes Bild der Fähigkeiten zu erhalten.
Welche Merkmale deuten auf eine Hochbegabung hin?
Typische Merkmale sind schnelles Lernen, ein großer Wortschatz, ausgeprägtes logisches Denken, hohe Neugier und oft auch eine unkonventionelle Problemlösungsfähigkeit.
Was können Lehrkräfte tun, um hochbegabte Schüler zu fördern?
Lehrkräfte können Maßnahmen wie Differenzierung im Unterricht, das Überspringen von Klassenstufen (Akzeleration) oder zusätzliche anspruchsvolle Projekte (Enrichment) anbieten.
Warum ist die Zusammenarbeit mit den Eltern so wichtig?
Eltern kennen die außerschulischen Interessen und Verhaltensweisen ihres Kindes oft am besten. Eine enge Kooperation hilft dabei, Frustrationen und Underachievement frühzeitig zu erkennen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Hochbegabung und Underachievement. Welche Relevanz hat die Hochbegabung für Lehrkräfte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418614