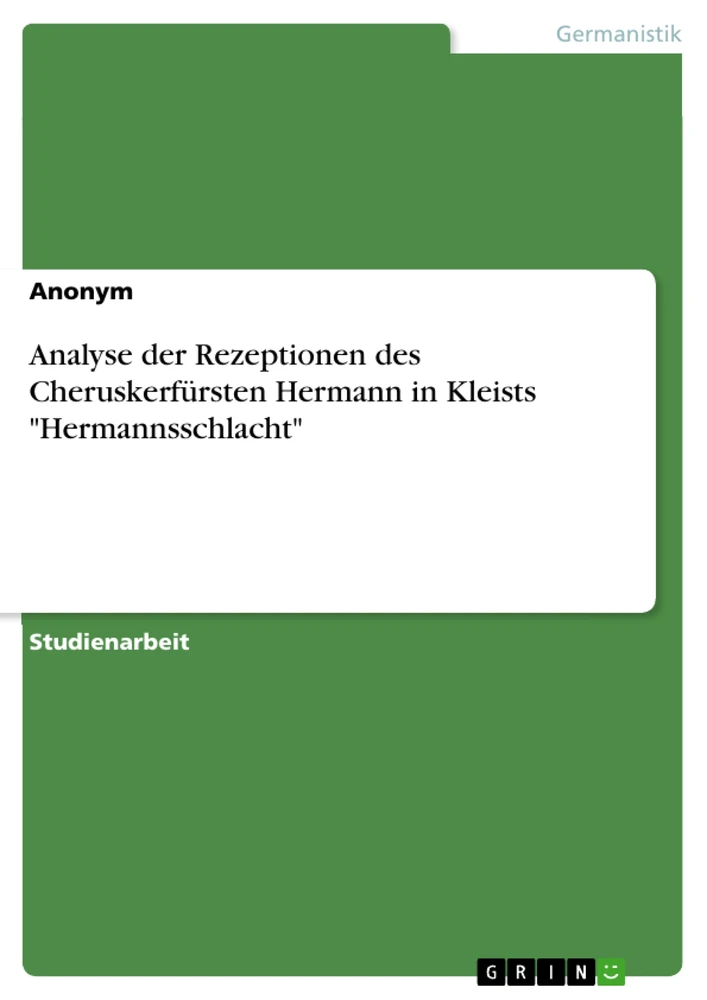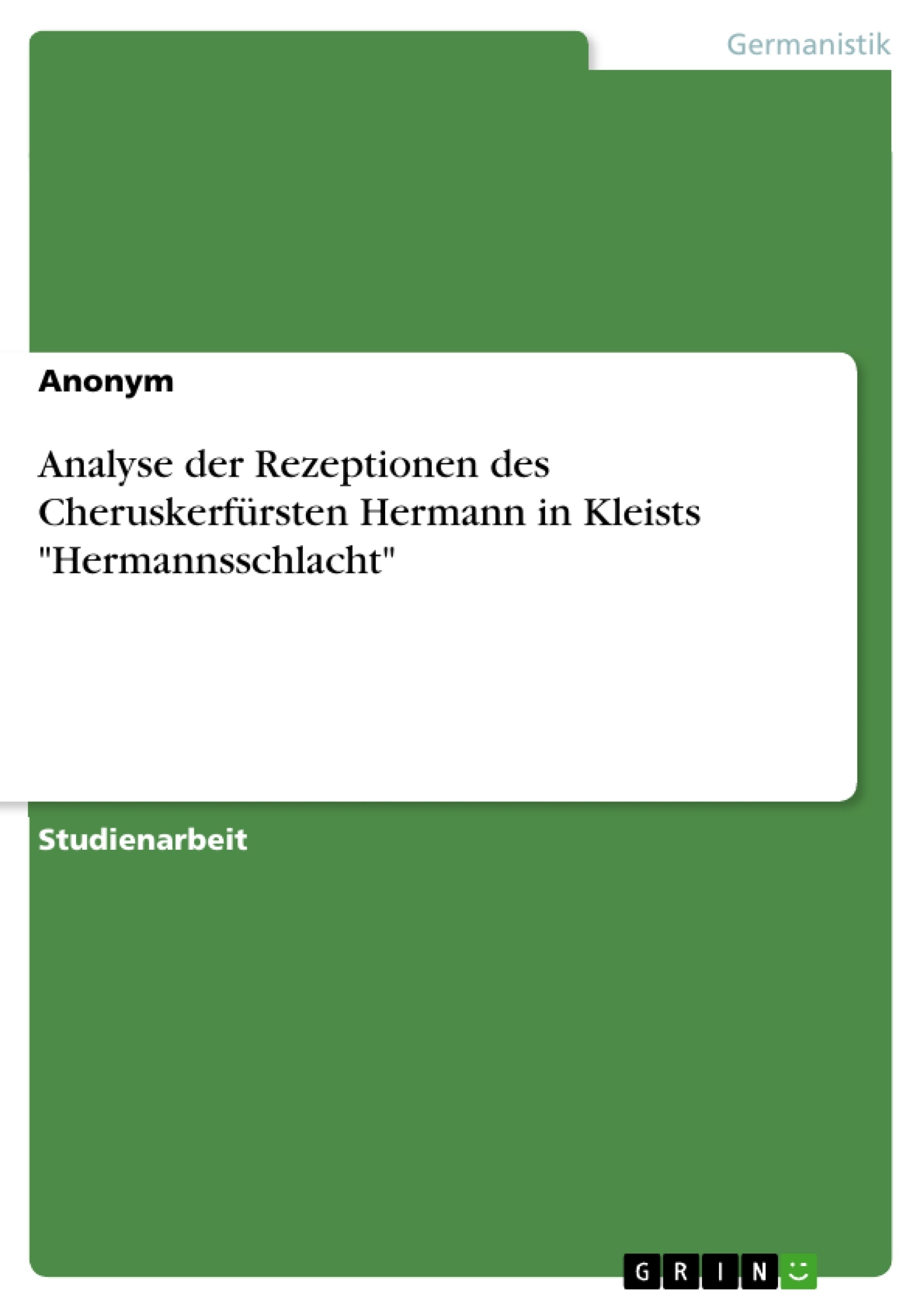Das dramatische Werk Heinrich von Kleists weist anerkanntermaßen eine sehr hohe ästhetische Qualität auf, besitzt jedoch einigen Kritikern zufolge ein „unwürdiges Erzeugnis“ – Die Hermannschlacht. Sehr häufig kontrovers diskutiert und größtenteils den Erwartungen der Zuschauer bei den ersten Aufführungen nicht entsprechend spaltete dieses Stück seit jeher die Meinungen von Forschern, Kritikern und Lesern. So kann man heutzutage beispielsweise Aussagen lesen, wie: „Das Drama ‚Die Hermannsschlacht’ ist in seiner dichterischen Bedeutung begrenzt. Niemand wird das leugnen.“ Der amerikanische Literaturwissenschaftler Lawrence Ryan versuchte dahingegen dieses Stück in das Gesamtwerk Kleists zu integrieren und kam zu folgender Schlussfolgerung: „Die auf Tagespolitik berechnete Wirkungsabsicht bestimmt das Werk nur oberflächlich. Im Kontext des Gesamtwerks hat dieses Stück vielmehr seine Bedeutung als Fortsetzung wie als Abwandlung einer sich bei Kleist durchgehend ausprägenden Thematik.“ Diese sehr kontrastreichen Sichtweisen stehen und fallen mit der Sichtweise auf die Titelfigur des Dramas: dem Cheruskerfürsten Hermann. Aus diesem Grund widmet sich diese Arbeit insbesondere der Rezeption dieser Figur. Da es wie bei der Hermannschlacht im Allgemeinen auch hier verschiedene Ansichten gibt ist es außerordentlich interessant diese zu analysieren, zu vergleichen und eine Schlussfolgerung zu ziehen. Die Vorgehensweise dieser Arbeit soll nun im Folgenden weiter erläutert werden. Zu Beginn werden zwei sehr verbreitete, jedoch vollkommen gegensätzliche Hermann-Rezeptionen vorgestellt und analysiert. Die eine zeichnet Hermann insbesondere als einen demagogischen Tyrannen wohingegen die andere dargestellte Rezeption in ihm eine sehr positive Erscheinung sieht, die den anderen Figuren als aufklärerischer Erzieher dient. Diese beiden Rezeptionen dienen als Hinführung zur zentralen These, die besagt, dass Hermann ein sehr gut intentionierter Machthaber ist, der aus menschlich nachvollziehbaren Gründen handelt und das Wohl seines Volkes und seiner Familie an die erste Stelle setzt. Jedoch wird die Art und Weise wie er seine Ziele zu erreichen gedenkt kritisch betrachtet und festgestellt, dass er auch dadurch in seinem Vorhaben scheitert beziehungsweise daran scheitern musste.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Darstellung verschiedener Hermanns-Rezeptionen
- Hermann von „Hass und Rache" getriebener Tyrann
- Menschenbild
- Freiheitsbild
- Hermann als aufklärerischer Erzieher
- Hermann von „Hass und Rache" getriebener Tyrann
- Analyse und These zur Hermanns-Figur
- Erklärungsansätze für die Vielzahl der Interpretationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Figur des Cheruskerfürsten Hermann in Heinrich von Kleists Drama „Die Hermannsschlacht“. Ziel ist es, verschiedene Interpretationen zu analysieren und zu vergleichen, um eine Schlussfolgerung über Hermanns Charakter und Motivationen zu ziehen.
- Rezeptionen des Hermanns-Bildes: Tyrann vs. aufklärerischer Erzieher
- Analyse von Hermanns Menschenbild und seinen Handlungen
- Kritische Betrachtung von Hermanns Methoden zur Erreichung seiner Ziele
- Untersuchung des Einflusses von Hermanns Demagogie und Manipulation
- Bedeutung des „Hass und Rache"-Motivs für Hermanns Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung beleuchtet die kontroversen Diskussionen um Kleists „Die Hermannsschlacht" und führt in die Vielfältigkeit der Interpretationen ein. Insbesondere die Figur des Hermanns steht im Zentrum der Debatten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse verschiedener Rezeptionen des Cheruskerfürsten.
- Darstellung verschiedener Hermanns-Rezeptionen: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Bilder von Hermann: Einerseits als „Hass und Rache" getriebener Tyrann, der seine Ziele mit Manipulation und Gewalt verfolgt, und andererseits als aufklärerischer Erzieher, der für das Wohl seines Volkes kämpft. Beide Perspektiven werden anhand von Textstellen aus Kleists Werk beleuchtet.
- Hermann von „Hass und Rache" getriebener Tyrann: Dieser Abschnitt untersucht die Rezeption des Hermanns als Tyrann. Er präsentiert ein Bild von Hermann als demagogischen Führer, der ein Feindbild der Römer konstruiert und seine Frau Thusnelda als politisches Werkzeug einsetzt. Das Kapitel beleuchtet Hermanns Menschenbild, seine Demagogie, sein Verständnis von Freiheit und seinen Einsatz von Brutalität.
- Menschenbild: Dieses Unterkapitel analysiert Hermanns Umgang mit seiner Frau Thusnelda und seinem Volk. Es argumentiert, dass Hermann seine Frau für seine politischen Pläne ausnutzt und die Abhängigkeit von Thusnelda gegenüber ihm für seine Ziele nutzt.
- Freiheitsbild: Dieses Unterkapitel widmet sich Hermanns Vorstellung von Freiheit und seinem Verständnis von „Hass und Rache". Es untersucht die Kontroversen um die Darstellung von Gewalt und die Darstellung der Römer in Kleists Werk.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte des Dramas „Die Hermannsschlacht" und insbesondere der Figur des Hermanns lassen sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen zusammenfassen: Rezeption, Hermanns-Bild, Tyrann, aufklärerischer Erzieher, Demagogie, Manipulation, Menschenbild, Freiheit, Hass, Rache, Gewalt, Brutalität, Feindbild, politische Ziele, Familie, Volk, Thusnelda.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kleists Drama „Die Hermannsschlacht“?
Das Stück behandelt den Sieg der Germanen unter dem Cheruskerfürsten Hermann über die römischen Legionen in der Varusschlacht.
Warum wird die Figur des Hermann kontrovers diskutiert?
Die Figur wird entweder als demagogischer, von Hass getriebener Tyrann oder als aufklärerischer Erzieher und Befreier seines Volkes interpretiert.
Welche Rolle spielt Thusnelda in Hermanns Strategie?
Kritiker werfen Hermann vor, seine eigene Frau als politisches Werkzeug zu missbrauchen und sie zu manipulieren, um seine Ziele gegen die Römer zu erreichen.
Was ist das zentrale Motiv für Hermanns Handeln?
Hermann nutzt gezielt „Hass und Rache“ als Instrumente, um die zerstrittenen germanischen Stämme zu einen und gegen den gemeinsamen Feind zu mobilisieren.
Wie wird Kleists Werk ästhetisch bewertet?
Während einige Kritiker es aufgrund seiner Brutalität und politischen Ausrichtung als „unwürdiges Erzeugnis“ bezeichnen, sehen andere darin eine konsequente Fortführung von Kleists komplexer Thematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Analyse der Rezeptionen des Cheruskerfürsten Hermann in Kleists "Hermannsschlacht", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418691