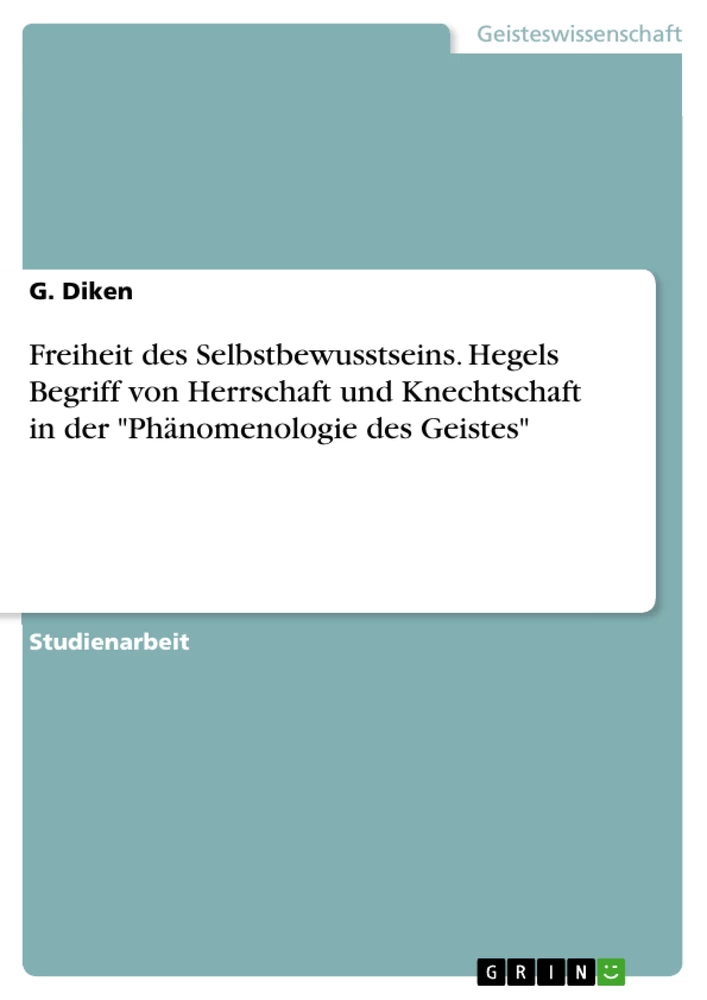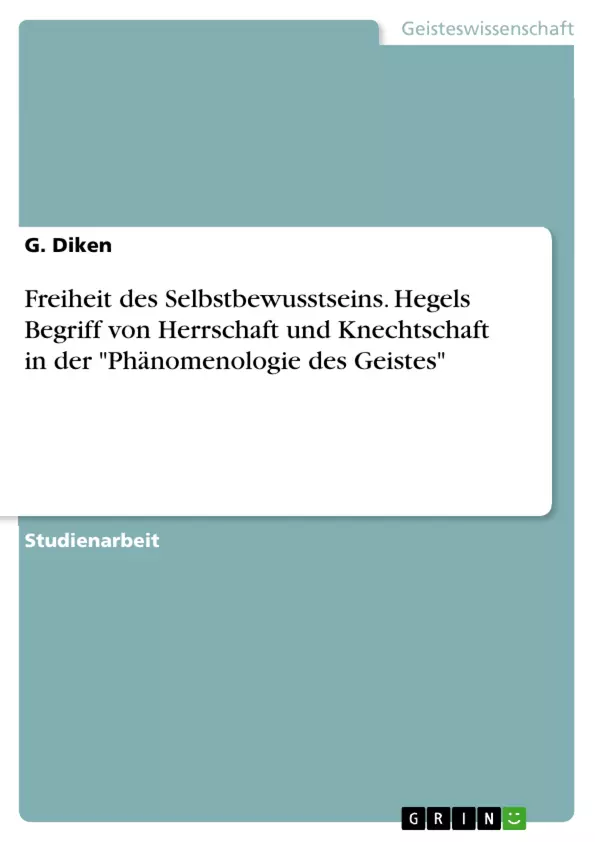Das Wort Phänomenologie leitet sich aus den griechischen Wörtern phainomenon (Erscheinung) und logos (Wort/Lehre) ab. Bei Hegels „Phänomenologie des Geistes“ handelt es sich also um einen Versuch, die Erscheinungsweisen des Geistes systematisch zu beschreiben. Der Aufbau der Phänomenologie folgt in insgesamt acht Kapiteln in den verschiedenen Erscheinungsformen des Geistes. Hegel untersucht dabei wie das Subjekt zur Erkenntnis gelangt, in dem den Weg von der sinnlichen Gewissheit bis hin zum absoluten Wissen beschreibt. Zu den bekanntesten Stellen in der Phänomenologie des Geistes gehört der Abschnitt über das in Herr und Knecht gespaltene Selbstbewusstsein. Hegel weist den beiden Teilen die Eigenschaften zweier antiker Ideologien zu: der Stoiker (Herr) und der Skeptiker (Knecht). Diese Schlüsselstelle zeigt, dass Hegel die Entwicklung des Geistes nicht nur individualpsychologisch, sondern immer auch menschheitsgeschichtlich betrachtet.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich den Abschnitt Herrschaft und Knechtschaft untersuchen. Hierfür werde ich zunächst die Methode Hegels und die Entwicklung des Bewusstseins zum Selbstbewusstsein darstellen. In anschließenden Kapitel Herr und Knecht möchte ich das Verhältnis der dargestellten Selbstbewusstseine erläutern und die Entwicklung bis hin zur Selbstständigkeit des Knechts aufzeigen. Im Zentrum dieser Arbeit steht hierbei die Frage, durch welche Komponenten die Befreiung des Knechts herbeigeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hegelsche Methode
- Die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst: Der Weg des Bewusstseins durch die Bewegung der Erfahrung
- Die Verdoppelung des Selbstbewusstseins
- Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins: Herrschaft und Knechtschaft
- Beidseitige Anerkennung
- Der Kampf um Leben und Tod
- Die Abhängigkeit zwischen Herr und Knecht: Der Weg zur Freiheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Abschnitt "Herrschaft und Knechtschaft" in Hegels "Phänomenologie des Geistes". Ziel ist es, das Verhältnis von Herr und Knecht, insbesondere die Entwicklung zur Selbstständigkeit des Knechts, zu analysieren und zu erklären, welche Komponenten zur Befreiung des Knechts führen.
- Die Hegelsche Methode der dialektischen Aufhebung
- Die Entwicklung des Bewusstseins zum Selbstbewusstsein
- Das Verhältnis von Herr und Knecht als Ausdruck von Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit
- Die Rolle der gegenseitigen Anerkennung in der Entstehung von Herrschaft und Knechtschaft
- Die Befreiung des Knechts durch die Überwindung seiner Abhängigkeit vom Herrn
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit erläutert den Begriff der "Phänomenologie des Geistes" und Hegels Versuch, die Erscheinungsformen des Geistes systematisch zu beschreiben. Es wird die Bedeutung des Abschnitts über Herrschaft und Knechtschaft hervorgehoben und die Vorgehensweise der Arbeit skizziert.
Die Hegelsche Methode
Dieses Kapitel stellt die dialektische Aufhebung als zentrales Prinzip der Hegelschen Methode vor. Die dialektische Bewegung beinhaltet die Aufhebung des An-sich-seins und des Für-sich-seins in ein An-und-für-sich-sein. Die Dialektik ist für Hegel sowohl Denkmethode als auch das Prinzip, das die Natur und die historische Entwicklung der Menschheit prägt.
Die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst: Der Weg des Bewusstseins durch die Bewegung der Erfahrung
Hegel beschreibt das Bewusstsein als ursprünglich absolut, aber noch nicht selbstbewusst. Durch die Erfahrung gelangt das Bewusstsein zum Selbstbewusstsein. Die Erfahrung vollzieht sich durch einen dialektischen Prozess, bei dem sich sowohl das Wissen als auch der Gegenstand verändern. Der Erfahrungsprozess beinhaltet die Auflösung von Widersprüchen, die durch die Diskrepanz zwischen dem erkannten und dem wirklichen Gegenstand entstehen.
Die Verdoppelung des Selbstbewusstseins
Das Kapitel betrachtet die Rolle des Verstandes bei der Erkenntnis der Kraft, die hinter den Eigenschaften der Gegenstände liegt. Die Kraft ist doppelt vorhanden als Kraft und Gegenkraft. Das Selbstbewusstsein als für-sich-seiendes Wesen wird von der Begierde angetrieben, die sich auf einen unmittelbaren Gegenstand der sinnlichen Gewissheit bezieht. Der Prozess der Befriedigung der Begierde führt zur Erfahrung der Selbstständigkeit des Gegenstands, der ein eigenes Selbstbewusstsein besitzt. Daraus entstehen zwei Extreme im Selbstbewusstsein: das Selbstbewusstsein selbst als Mitte dieser Extreme.
Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins: Herrschaft und Knechtschaft
Beidseitige Anerkennung
Das Selbstbewusstsein realisiert sich als Begierde, aber seine wahre Befriedigung findet es nur in seiner Realisierung als Selbstbewusstsein, die es in einem anderen Selbstbewusstsein findet. Die gegenseitige Anerkennung der beiden Selbstbewusstseine ist Voraussetzung für ihre Einheit und die Entstehung des Geistes. Das Selbstbewusstsein wird sich der Gewissheit des anderen seiner selbst bewusst. Die Konfrontation mit einem für-sich-Seienden Selbstständigem führt zur Erkenntnis der eigenen Selbstständigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Selbstbewusstsein, dialektische Aufhebung, Erfahrung, Herrschaft und Knechtschaft, Anerkennung und Befreiung im Kontext von Hegels "Phänomenologie des Geistes".
Häufig gestellte Fragen
Was beschreibt Hegel im Abschnitt 'Herrschaft und Knechtschaft'?
Er beschreibt den Kampf zweier Selbstbewusstseine um Anerkennung, der in einem Abhängigkeitsverhältnis endet, in dem einer der Herr und der andere der Knecht wird.
Warum führt die Arbeit des Knechts zu seiner Befreiung?
Durch die formgebende Arbeit an den Dingen erkennt der Knecht seine eigene Selbstständigkeit und Schöpferkraft, während der Herr durch seinen reinen Genuss abhängig bleibt.
Was ist die 'dialektische Aufhebung' bei Hegel?
Es ist ein Prozess, bei dem ein Widerspruch aufgelöst wird, indem die Gegensätze bewahrt, aber auf einer höheren Ebene der Erkenntnis vereint werden.
Welche Rolle spielt die Angst vor dem Tod im Kampf um Anerkennung?
Die Angst vor dem Tod zwingt das eine Selbstbewusstsein zur Unterwerfung (Knecht), während das andere bereit ist, sein Leben für die Freiheit zu riskieren (Herr).
Warum ist gegenseitige Anerkennung für den 'Geist' wichtig?
Erst durch die Anerkennung durch ein anderes freies Selbstbewusstsein kann sich der Geist als soziale und geschichtliche Realität voll entfalten.
- Quote paper
- G. Diken (Author), 2016, Freiheit des Selbstbewusstseins. Hegels Begriff von Herrschaft und Knechtschaft in der "Phänomenologie des Geistes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419310