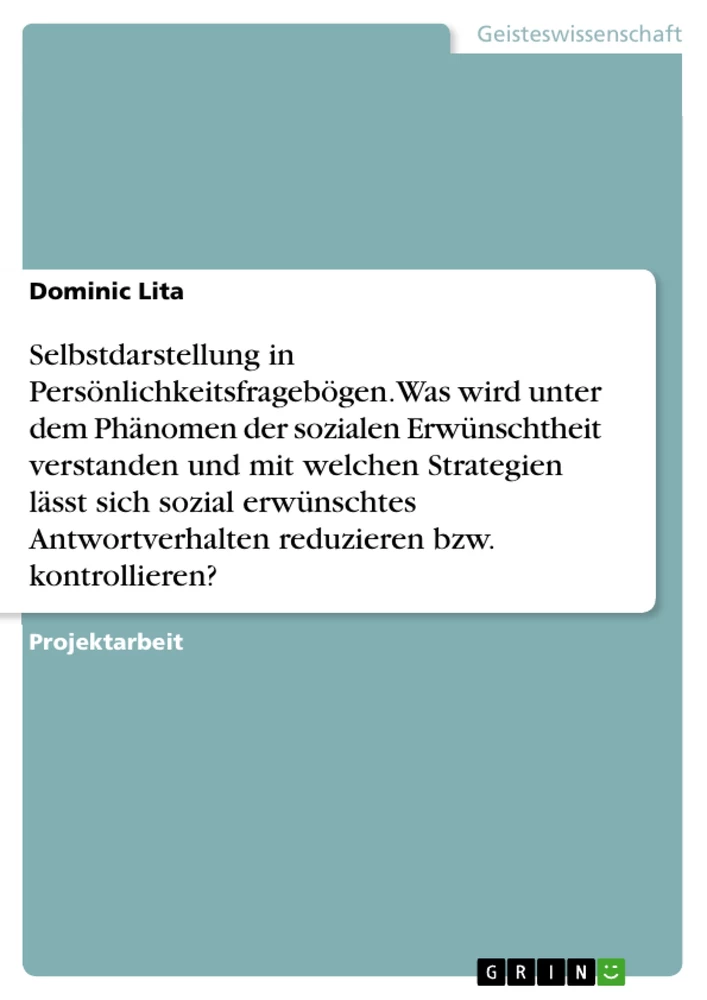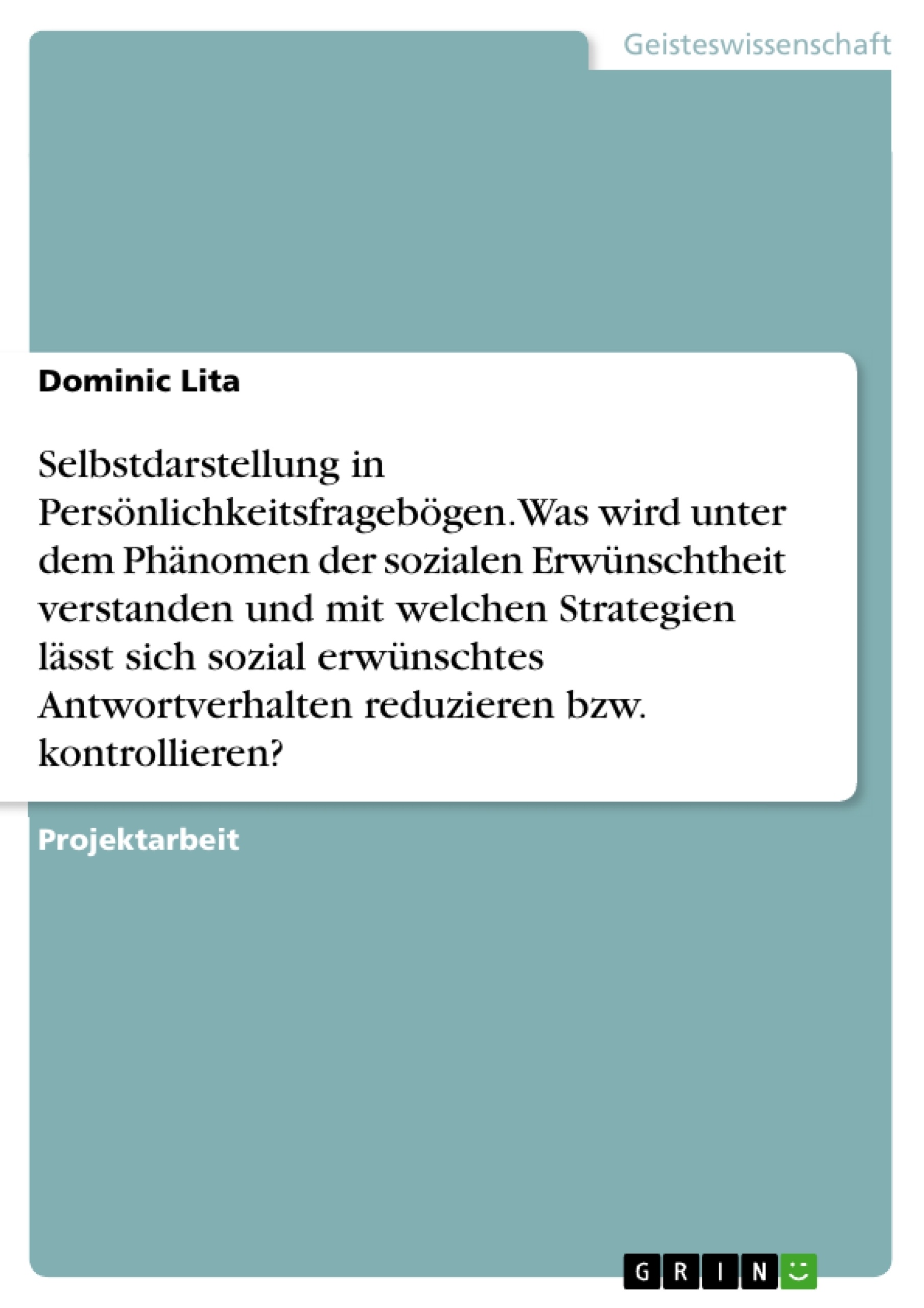Sozial erwünschtes Antworten wird oft als Sonderform der Selbstdarstellung aufgefasst. Meist aus Furcht vor sozialer Verurteilung, neigen Befragte zu konformen Verhalten und orientieren sich in ihren Verhaltensäußerungen strikt an verbreiteten Normen und Erwartungen. Doch was macht das psychologische Konzept sozial erwünschter Reaktionen tatsächlich aus? Gibt es eine einheitliche Herangehensweise für Testungen? Diese Arbeit soll einen Überblick über die Problematik der sozialen Erwünschtheit verschaffen und diese anhand von Konstrukten aus der Forschung verdeutlichen. Es sollen Strategien vorgestellt werden, um das sozial erwünschte Antworten in Personalfragebögen zu reduzieren, bzw. um Kontrollmechanismen für bessere Gütekriterien anzuwenden zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORIE
- 2.1 PERSÖNLICHKEITSFRAGEBÖGEN UND DAS PROBLEM DER SELBSTDARSTELLUNG
- 2.2 ANTWORTTENDENZEN IN DER PERSÖNLICHKEITSTESTUNG
- 2.2.1 FORMALE ANTWORTTENDENZEN
- 2.2.2 INHALTLICHE ANTWORTTENDENZEN
- 2.3 DAS KONSTRUKT DER SOZIALEN ERWÜNSCHTHEIT
- 2.4 DIE SOZIALE ERWÜNSCHTHEIT ALS SUPPRESSORVARIABLE
- 2.5 FORSCHUNGSFRAGE
- 3. METHODEN
- 3.1 LITERATURRECHERCHE
- 3.2 VERWENDETE SCHLÜSSELWORTE, SUCHSTRATEGIEN & EINTRÄGE IN DEN DATENBANKEN
- 3.2.1 LITERATURRECHERCHE ÜBER GOOGLE SCHOLAR
- 3.2.2 LITERATURRECHERCHE ÜBER JOST
- 3.2.3 LITERATURRECHERCHE IN FERNLEHRBRIEFEN
- 3.2.4 LITERATURRECHERCHE IN LEHRBÜCHERN
- 4. ERGEBNISSE
- 4.1 STRATEGIEN IM UMGANG MIT SOZIALER ERWÜNSCHTHEIT
- 4.2 DIE KONTROLLMECHANISMEN DES SOZIAL ERWÜNSCHTEN ANTWORTENS
- 4.2.1 KONTROLLMAßNAHMEN IN DER TESTKONSTRUKTION
- 4.2.2 KONTROLLMAßNAHMEN IN DER TESTADMINISTRATION
- 4.2.3 KONTROLLMAßNAHMEN IN DER TESTAUSWERTUNG
- 5. DISKUSSION UND FAZIT
- 5.1 DIE DEFINITION DER SOZIALEN ErwünsCHTHEIT UND IHRE SCHWÄCHEN
- 5.2 FORSCHUNG IM FELD DER SOZIALEN ERWÜNSCHTHEIT
- 5.3 KONTROLLMECHANISMEN UND DEREN WIRKUNG
- 5.4 FAZIT
- 6. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der sozialen Erwünschtheit in Persönlichkeitsfragebögen. Sie soll einen Überblick über das Konzept der sozialen Erwünschtheit, seine Bedeutung in der Persönlichkeitsforschung und Strategien zur Reduzierung bzw. Kontrolle sozial erwünschten Antwortverhaltens liefern.
- Die Definition und die Problematik sozial erwünschten Antwortverhaltens in Persönlichkeitsfragebögen
- Verschiedene Formen und Einflussfaktoren von Antworttendenzen in der Persönlichkeitstestung
- Die Rolle der sozialen Erwünschtheit als Suppressorvariable und ihre Auswirkungen auf die Validität von Testdaten
- Strategien zur Reduzierung sozial erwünschten Antwortverhaltens in der Testkonstruktion, -administration und -auswertung
- Die Bedeutung der Forschung im Bereich der sozialen Erwünschtheit für die Entwicklung genauerer und validerer Persönlichkeitsfragebögen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der sozialen Erwünschtheit in Persönlichkeitsfragebögen einführt und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der sozialen Erwünschtheit behandelt. Es wird die Problematik der Selbstdarstellung in Persönlichkeitsfragebögen beleuchtet, die verschiedenen Arten von Antworttendenzen in der Persönlichkeitstestung beschrieben und das Konstrukt der sozialen Erwünschtheit erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Methodik der Arbeit. Hier werden die verschiedenen Suchstrategien und Datenbanken vorgestellt, die für die Literaturrecherche genutzt wurden.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche. Es werden verschiedene Strategien im Umgang mit sozialer Erwünschtheit vorgestellt und die Kontrollmechanismen des sozial erwünschten Antwortverhaltens diskutiert.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, diskutiert die Bedeutung der sozialen Erwünschtheit für die Forschung und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: soziale Erwünschtheit, Persönlichkeitsfragebogen, Antworttendenzen, Selbstdarstellung, Testkonstruktion, Testadministration, Testvalidität, Kontrollmechanismen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter sozialer Erwünschtheit?
Es handelt sich um eine Form der Selbstdarstellung, bei der Befragte aus Furcht vor Verurteilung konform zu sozialen Normen antworten.
Warum ist soziale Erwünschtheit ein Problem für Persönlichkeitstests?
Sie wirkt als Suppressorvariable und kann die Validität der Testergebnisse erheblich beeinträchtigen.
Welche Kontrollmechanismen gibt es in der Testkonstruktion?
Es können Strategien angewandt werden, um sozial erwünschtes Antworten bereits beim Entwurf der Fragen zu reduzieren.
Wie kann man bei der Testauswertung auf Antworttendenzen reagieren?
Es gibt spezifische Kontrollmaßnahmen in der Auswertung, um die Gütekriterien der Daten zu verbessern.
Welche Arten von Antworttendenzen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formalen und inhaltlichen Antworttendenzen in der Persönlichkeitstestung.
- Quote paper
- Dominic Lita (Author), 2018, Selbstdarstellung in Persönlichkeitsfragebögen. Was wird unter dem Phänomen der sozialen Erwünschtheit verstanden und mit welchen Strategien lässt sich sozial erwünschtes Antwortverhalten reduzieren bzw. kontrollieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419370