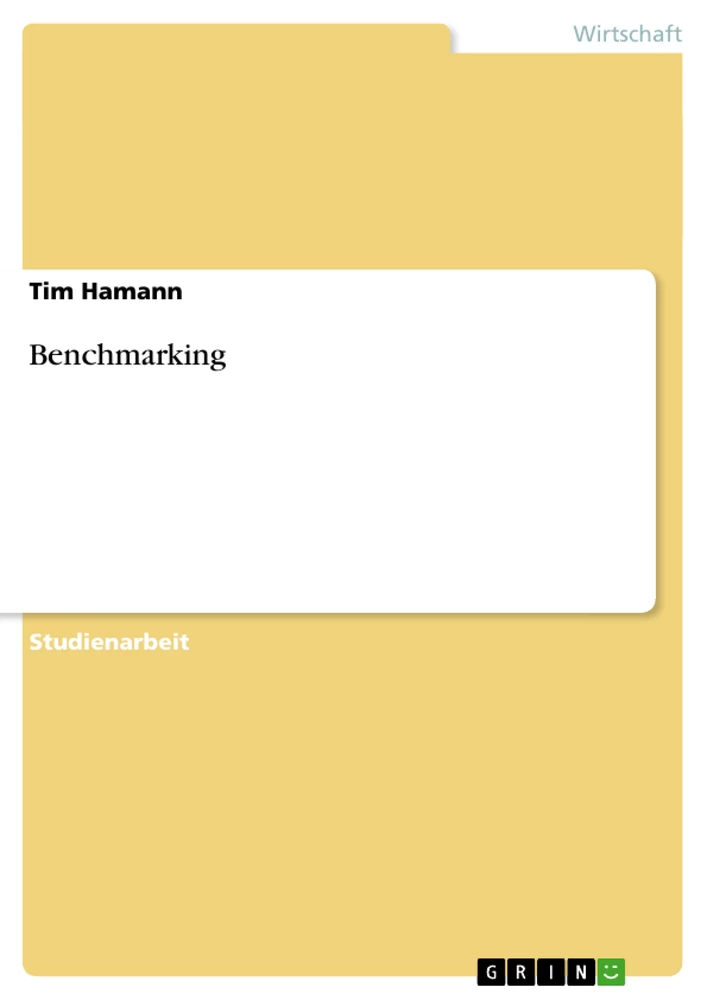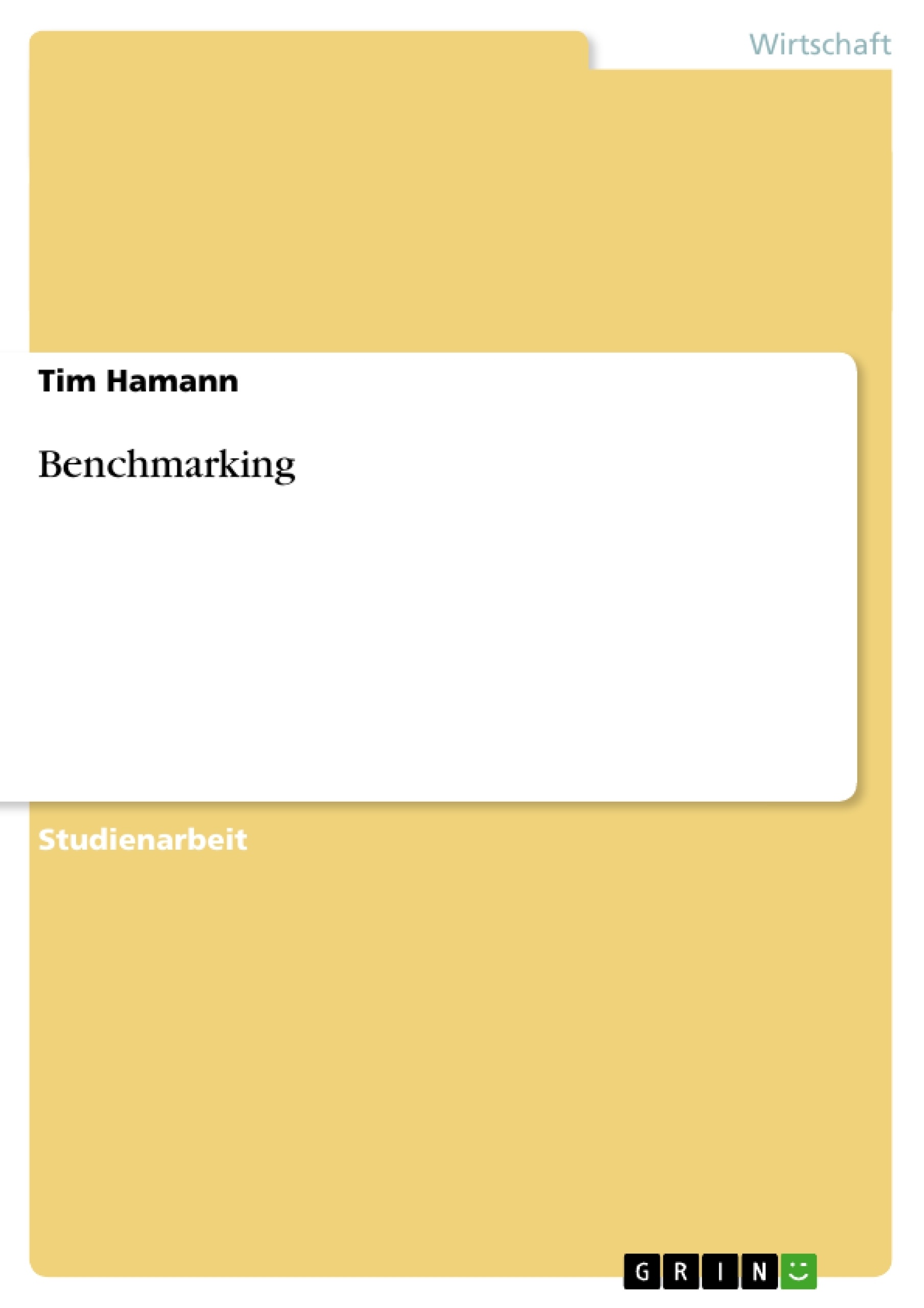1. Einleitung
Beim Benchmarking handelt es sich um ein Managementinstrument, mit dessen Hilfe durch Vergleiche mit anderen internen Unternehmensbereichen oder externen Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielt werden sollen.1 Der eigentliche Wettbewerbsvorteil entsteht durch einen Lern- und Anpassungseffekt, der insbesondere vor einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont, die Erfolgssituation im Unternehmen verbessern soll.2 Quantitativ gesehen wird die Benchmark als Ausgangswert für den Vergleich gesehen. Deshalb ist es auch üblich besonders leistungsfähige Unternehmen zum Vergleich heranzuziehen. 3
-----
1 Vgl. Götze (1998) S. 279.
2 Ebenda.
3 Vgl. Hoffjan (1997) S. 345.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Charakteristika und Voraussetzungen des Benchmarking
- 3. Unterschiede zu verwandten Verfahren
- 4. Unterschiedliche Formen des Benchmarkings
- 4.1 Internes Benchmarking
- 4.2 Wettbewerbsorientiertes Benchmarking
- 5. Ablauf Benchmarking
- 5.1 Planungsphase
- 5.1.1 Identifikation des Objektes
- 5.1.2 Das Benchmarking Team
- 5.1.3 Leistungsbeurteilungsgrößen
- 5.1.4 Auswahl der Vergleichsunternehmen
- 5.1.5 Informationsquellen
- 5.2 Analysephase
- 5.2.1 Datenermittlung und Aufbereitung
- 5.2.2 Bestimmung von Leistungslücken
- 5.2.3 Identifikation von Leistungslücken
- 5.3 Aktionsphase
- 5.3.1 Berichterstattung
- 5.3.2 Anpassung der Ziele und der Strategie
- 5.3.3 Ausarbeitung von Aktionsplänen
- 5.3.4 Kontrolle
- 6. Kritik am Benchmarking
- 7. Erfolgsfaktoren beim Benchmarking
- 8. Potentiale des Benchmarking
- Charakteristika und Voraussetzungen von Benchmarking
- Unterschiede zu verwandten Verfahren wie Konkurrenzanalyse, Reverse Engineering und Betriebsvergleich
- Unterschiedliche Formen des Benchmarking (intern, wettbewerbsorientiert)
- Die einzelnen Phasen eines Benchmarking-Projekts (Planung, Analyse, Aktion)
- Kritikpunkte und Erfolgsfaktoren von Benchmarking
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit "Benchmarking" befasst sich mit der Anwendung und den Vorteilen von Benchmarking als Managementinstrument. Ziel ist es, die Funktionsweise und den Ablauf von Benchmarking-Projekten zu erläutern und die Bedeutung des Vergleichens mit anderen Unternehmen für die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Benchmarking ein und erläutert seine grundlegende Funktionsweise als Managementinstrument zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch den Vergleich mit anderen Unternehmen. Kapitel 2 beleuchtet die wichtigsten Charakteristika und Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung von Benchmarking. Hierbei werden unter anderem die Notwendigkeit von Vergleichsgrößen, die Relevanz des Informationsaustauschs und die Bedeutung der Adaptionsfähigkeit hervorgehoben. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Unterschieden von Benchmarking zu verwandten Verfahren wie der Konkurrenzanalyse, dem Reverse Engineering und der Kennzahlenanalyse. Im Anschluss werden in Kapitel 4 verschiedene Formen des Benchmarkings, wie internes und wettbewerbsorientiertes Benchmarking, vorgestellt. Kapitel 5 widmet sich ausführlich dem Ablauf eines Benchmarking-Projekts, wobei die einzelnen Phasen der Planung, Analyse und Aktion detailliert dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das Managementinstrument Benchmarking, wobei die zentralen Themenbereiche Vergleich, Wettbewerbsvorteile, Informationsaustausch, Adaptionsfähigkeit, Planung, Analyse und Aktion im Vordergrund stehen. Weitere wichtige Aspekte sind die Unterschiede zu verwandten Verfahren wie der Konkurrenzanalyse und dem Reverse Engineering, sowie die Erfolgsfaktoren und kritischen Punkte bei der Anwendung von Benchmarking.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Benchmarking?
Ein Managementinstrument zum Vergleich der eigenen Leistungen mit den „Besten der Branche“, um durch Lernen und Anpassen Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Welche Formen des Benchmarking gibt es?
Es wird zwischen internem Benchmarking (Vergleich innerhalb eines Unternehmens) und wettbewerbsorientiertem Benchmarking (Vergleich mit Konkurrenten) unterschieden.
Wie läuft ein Benchmarking-Projekt ab?
Der Prozess gliedert sich in drei Phasen: Planungsphase (Objektidentifikation), Analysephase (Datenermittlung) und Aktionsphase (Umsetzung der Ziele).
Was ist der Unterschied zur Konkurrenzanalyse?
Während die Konkurrenzanalyse nur Daten sammelt, zielt Benchmarking auf das Verständnis der Prozesse ab, die zu überlegener Leistung führen.
Was sind kritische Erfolgsfaktoren beim Benchmarking?
Wichtig sind die Auswahl der richtigen Vergleichsunternehmen, die Qualität der Datenquellen und die Bereitschaft des Managements zur Veränderung.
- Arbeit zitieren
- Tim Hamann (Autor:in), 2005, Benchmarking, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41940