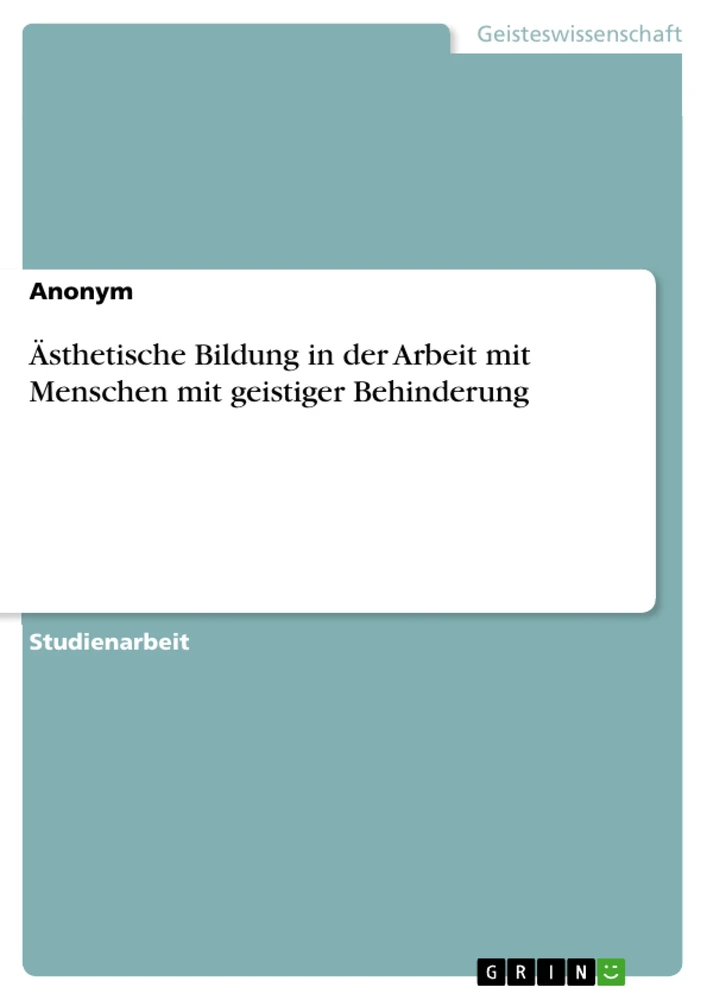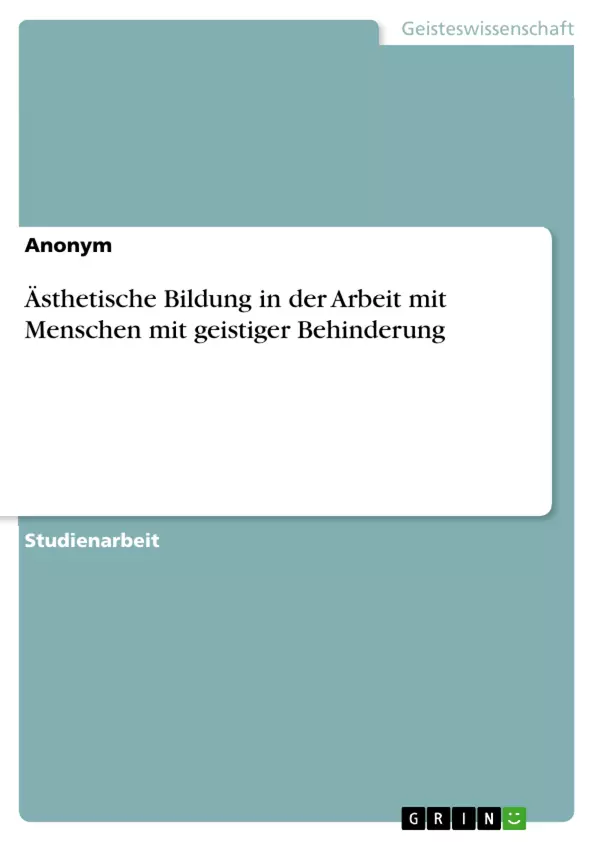Ästhetische Bildung ein sehr diskutierter Begriff, der vor allem als Oberbegriff für alle pädagogischen Handlungsbereiche beschrieben wird, die die ästhetische Arbeit mit einbeziehen, beispielsweise Kunst, Theater, Musik und Literatur. Schon lange orientiert sie sich also nicht mehr nur an den Themen der Kunst und der Kultur, sondern setzt ihren Schwerpunkt auf allgemeinere Aspekte eines ästhetischen Ich-Weltverhältnisses und der Persönlichkeitsbildung durch ästhetische Erfahrung. Darunter fällt vor allem die Frage nach der Bedeutung von Wahrnehmung und Sinnlichkeit. Der Begriff der Ästhetischen Bildung wächst und wird immer bedeutender. Ästhetik, ästhetische Erfahrungen, ästhetisches Verständnis und ästhetisches Wissen gilt heute als wesentlicher Bestandteil des Lernens und der Bildung.
Aus der Sicht des Begriffs ästhetische Bildung wird sich die Aufgabe gestellt, wie die Arbeit mit einer geistigen behinderten Person durch ästhetische Bildung in einer Wohngruppenform gefördert werden kann. Ein Mensch mit geistiger Behinderung lebt in einer betreuten Wohngruppe. Hier bekommt er/sie Unterstützung bei alltags- und lebensnotwendigen Maßnahmen von pädagogischen Fachkräften. Damit der Mensch mit einer geistigen Behinderung individuelle Entwicklungsförderungen erhält, werden Konzepte und Ideen einer Fördermaßnahme durch die pädagogischen Mitarbeiter*Innen erarbeitet.
Viele Konzepte und Maßnahmen, die in einer Wohngruppenform angeboten werden, stammen aus ästhetischen Handlungsfeldern. Die ästhetischen Handlungsfelder beschreiben vielfältige Methoden und Techniken, die in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen angewendet werden. Ein Konzept einer betreuten Wohngruppe in H. wird hier als ein Beispiel für die ästhetische Gestaltung im Kontext von Wohngruppenarbeit erläutert. Das Projekt nennt sich „TAT“ (Treff am Turm) und wurde als Freizeitgestaltung für die Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung entwickelt. Die Konzeptidee beruht auf dem Grundgedanken, dass ästhetische Gestalten als Teilnahme in der Gesellschaft dienen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Mensch mit geistiger Behinderung
- Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Wohngruppenform
- Institution Wohngruppe
- Ziele
- Pädagogische Fördermaßnahmen
- Begriffsbestimmung
- Ästhetische Bildung
- Ästhetische Bildung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Möglichkeiten der Förderung für Menschen mit geistiger Behinderung
- Methoden & Techniken
- Theorien
- Qualifikation der Mitarbeiter
- Projekt „TAT“
- Beschreibung des Projekts
- Teilnehmer
- Verwendete Materialien & Techniken
- Durchführung/ Ablauf
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die Rolle der ästhetischen Bildung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, insbesondere im Kontext von betreuten Wohngruppen. Die Arbeit befasst sich mit dem Ziel, die Möglichkeiten der Förderung und Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung durch ästhetische Bildung aufzuzeigen.
- Definition und Verständnis von geistiger Behinderung
- Sozialpädagogische Arbeit in Wohngruppen
- Begriff und Bedeutung der ästhetischen Bildung
- Methoden und Techniken der ästhetischen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Das Projekt "TAT" als Beispiel für die Umsetzung von ästhetischer Bildung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ästhetischen Bildung im Kontext der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung ein und stellt die Bedeutung der ästhetischen Erfahrungen für die Persönlichkeitsbildung heraus.
- Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der geistigen Behinderung und zeigt die verschiedenen Perspektiven und Modelle auf, die in der Fachdiskussion verwendet werden.
- Sozialpädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Wohngruppenform: Hier werden die Strukturen und Ziele der Arbeit in betreuten Wohngruppen beschrieben, wobei die Förderung der Selbstständigkeit und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Vordergrund stehen.
- Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Ästhetischer Bildung und analysiert verschiedene Ansätze und Perspektiven.
- Ästhetische Bildung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel zeigt die Möglichkeiten der Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung durch die ästhetische Bildung auf. Es werden die vier Grunddimensionen der ästhetischen Bildung erläutert: Fingerfertigkeit, Alphabetisierung, Selbstaufmerksamkeit und Sprache. Außerdem werden verschiedene Methoden und Techniken der ästhetischen Arbeit, wie beispielsweise das bildnerische Gestalten, vorgestellt.
- Projekt "TAT": Hier wird das Projekt "TAT" als ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung von ästhetischer Bildung in der Praxis vorgestellt. Das Projekt bietet Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zur Begegnung und gemeinsamen Gestaltung.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Sozialpädagogische Arbeit, Wohngruppen, Ästhetische Bildung, Wahrnehmung, Gestaltung, Kommunikation, Inklusion, Projekt "TAT".
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Ästhetische Bildung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419419