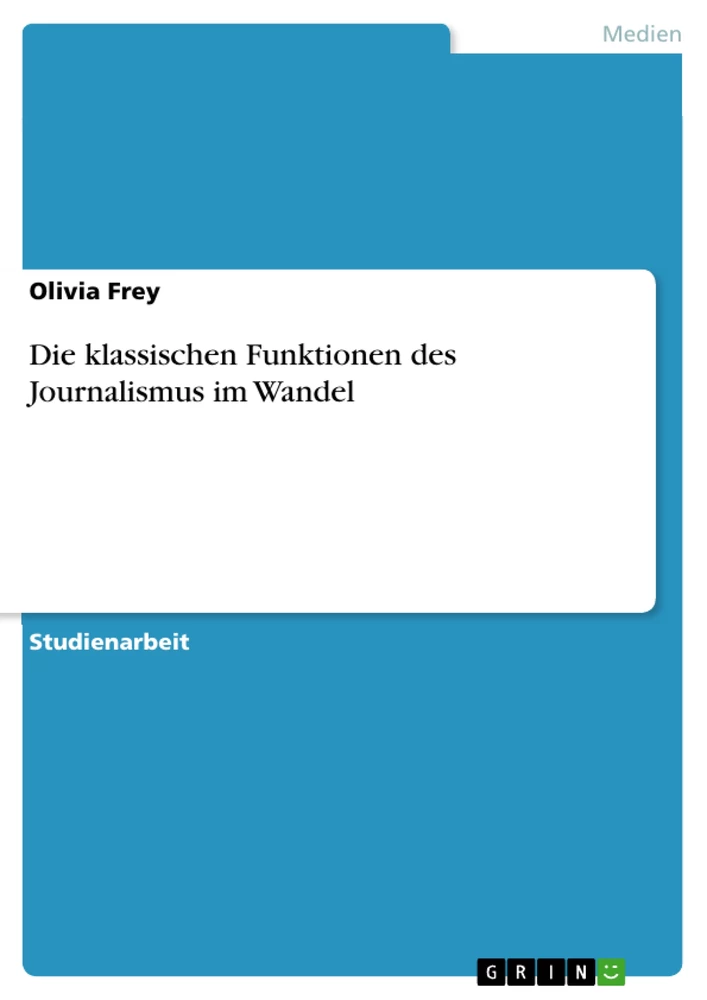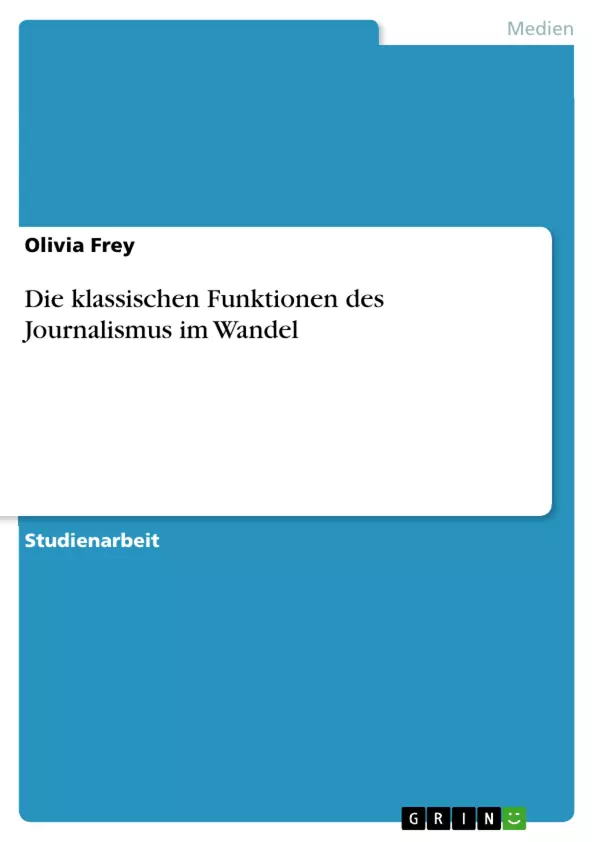Journalismus "[…] soll zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse Nachrichten beschaffen und verbreiten, dazu Stellung nehmen und Kritik üben und damit an der Meinungsbildung mitwirken." Somit ist klar: Journalismus soll vor allem dem Gemeinwohl dienen. Doch so simpel diese Vorgaben auch formuliert sein mögen, die praktische Umsetzung gestaltet sich in der heutigen Gesellschaft als weitaus komplexer. So wie sich Öffentlichkeit und Gesellschaft stets entwickeln, befinden sich auch Medien und Mediensysteme in einem konstanten Wandel.
Die räumliche und soziale Reichweite der Massenmedien scheint im Gegensatz zu der anderer gesellschaftlicher Institutionen ein stetiges Wachstum zu durchleben. Faktoren hierfür können beispielsweise die Vielfalt neuer technischer Möglichkeiten und der Bedeutungszuwachs elektronischer Medien sein, ebenso Veränderungen der medieninstitutionsinternen Strukturen und Parameter, der zunehmende Autonomiegewinn sowie das Nachlassen staatlicher und gesellschaftlicher Aufsicht im Publizistikbereich. Daher gilt zu prüfen: Durchleben die klassischen Funktionen des Journalismus einen Wandel? Ist deren gänzliche Erfüllung überhaupt noch möglich oder verbleibt die Vorstellung einer sachgerechten, verständlichen, fairen und ausgewogenen Berichterstattung als bloßes Wunschdenken?
Um diese Fragestellung zu bearbeiten, sollen zunächst die klassischen Funktionen des Journalismus bzw. der Massenmedien erörtert werden. Anschließend werden diese in Bezug auf aktuelle Entwicklungen geprüft und beurteilt. In einem abschließenden Fazit sollen die wichtigsten Ergebnisse festgehalten und die Frage hinsichtlich dieser reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Funktionen des Journalismus
- Funktionen für Staat und Gesellschaft
- Funktionen für die Rezipienten
- Diskussion: Die klassischen Funktionen im Wandel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die klassischen Funktionen des Journalismus im Wandel sind. Es wird untersucht, inwieweit die traditionellen Aufgaben des Journalismus in der heutigen Gesellschaft noch erfüllt werden können. Die Arbeit konzentriert sich auf die Funktionen des Journalismus im Dienste von Staat und Gesellschaft, insbesondere auf Information, Meinungsbildung und Kritik und Kontrolle.
- Funktionen des Journalismus in einer sich verändernden Gesellschaft
- Analyse der klassischen Funktionen des Journalismus
- Bedeutung des Journalismus für die öffentliche Meinungsbildung
- Die Rolle des Journalismus als Kontrollinstanz
- Herausforderungen für die Funktionsfähigkeit des Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Journalismus für das Gemeinwohl und die öffentliche Meinungsbildung erläutert. Es wird auf die Herausforderungen für den Journalismus im Wandel der Gesellschaft hingewiesen, die durch die rasante Entwicklung von Medien und Mediensystemen entstehen. Im zweiten Kapitel werden die klassischen Funktionen des Journalismus, wie Information, Meinungsbildung und Kritik und Kontrolle, näher beleuchtet. Die Bedeutung dieser Funktionen für Staat und Gesellschaft wird diskutiert. Dabei wird auf die Rolle des Journalismus als "Gatekeeper" und die Herausforderungen einer objektiven und ausgewogenen Berichterstattung eingegangen. Im dritten Kapitel wird die Diskussion fortgesetzt, ob die klassischen Funktionen des Journalismus im Wandel sind. Die Arbeit betrachtet aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft und analysiert, inwieweit die traditionellen Aufgaben des Journalismus noch erfüllt werden können.
Schlüsselwörter
Journalismus, Funktionen, Staat, Gesellschaft, Information, Meinungsbildung, Kritik, Kontrolle, Wandel, Medien, Mediensysteme, Gatekeeper, Objektivität, Ausgewogenheit, Pluralismus.
- Citar trabajo
- Olivia Frey (Autor), 2016, Die klassischen Funktionen des Journalismus im Wandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419452