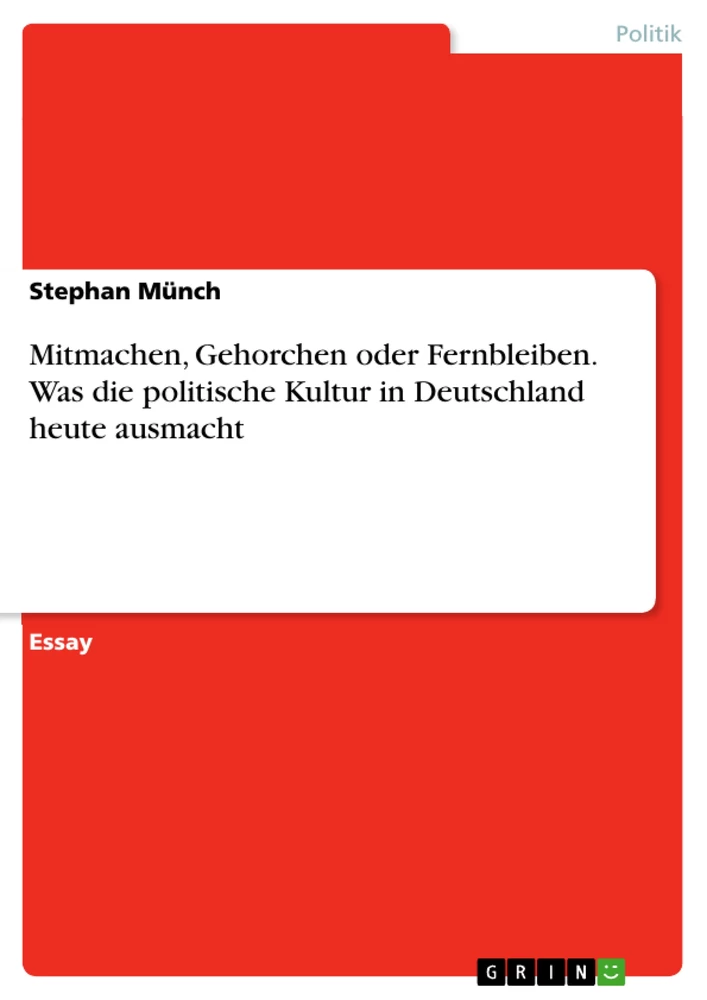Dieser Essay beschäftigt sich mit der politischen Kultur Deutschlands in Hinblick auf die Einstellungen und die politische Kultur vor der „Wende“, die allgemeine Einstellung der Bürger zur Politik im Ost-West Vergleich und dem politischen Handeln im sozialen Umfeld in Bezug auf Milieus, sozialen Netzwerken und „Klassen“.
Die politische Kultur Deutschlands hat im Laufe der letzten Jahrzehnte und vor allem seit der Wiedervereinigung einen Wandel erlebt. Der Begriff politische Kultur bedeutet in der Politikwissenschaft, Geschichte und Sozialwissenschaft die Verteilung aller kognitiven, emotionalen und beurteilenden Einstellungen in Bezug auf politische Fragestellungen, speziell zur generellen Ordnung, Organisation des politischen Systems in einer Gesellschaft und zur eigenen Rolle im System.
Inhaltsverzeichnis
- Mitmachen, Gehorchen oder Fernbleiben - Was die politische Kultur in Deutschland heute ausmacht
- Die politische Kultur Deutschlands im Wandel
- Politische Kultur im Ost-West Vergleich
- Politische Partizipation und soziale Schichten
- Fazit: Bildung und Partizipation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Entwicklung der politischen Kultur in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Er untersucht die Einstellungen der Bürger gegenüber der Politik, die Unterschiede zwischen Ost und West sowie den Einfluss sozialer Schichten auf die politische Partizipation.
- Der Wandel der politischen Kultur in Deutschland
- Der Vergleich der politischen Kultur in Ost- und Westdeutschland
- Die Rolle sozialer Schichten in der politischen Partizipation
- Die Bedeutung von Bildung für die politische Partizipation
- Die Ursachen und Folgen der Politikverdrossenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Definition des Begriffs „politische Kultur“ und erläutert die historische Entwicklung der politischen Kultur in Deutschland. Im Anschluss werden die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen Ost- und Westdeutschland beleuchtet. Es wird aufgezeigt, dass sich die Ostdeutschen stärker durch nicht-institutionalisierte Beteiligung und Protestverhalten auszeichnen, während die Westdeutschen eher an der formalen, institutionellen Politik teilhaben. Im nächsten Abschnitt untersucht der Essay den Einfluss sozialer Schichten auf die politische Partizipation. Es wird festgestellt, dass die politische Beteiligung mit zunehmender Bildung steigt, während sozial benachteiligte Menschen oder bildungsfernere Schichten weniger mit dem politischen Geschehen zu tun haben. Der Essay schließt mit einem Fazit, das die Bedeutung von Bildung für die politische Partizipation betont. Es wird festgestellt, dass die politische Kultur in Deutschland von den vielen gesellschaftlichen Schichten ausgemacht wird, die wiederum verschiedene Perspektiven vertreten. Die bildungsstarken Bevölkerungsgruppen machen bei der Politik mit, die weniger gebildeten Bürger gehorchen und die Bildungsschwachen aus der Unterschicht bleiben dem ganzen politischen Spektakel eher fern.
Schlüsselwörter
Politische Kultur, Deutschland, Wiedervereinigung, Ost-West Vergleich, Partizipation, soziale Schichten, Bildung, Politikverdrossenheit, Protestverhalten, nicht-institutionalisierte Beteiligung.
- Quote paper
- Stephan Münch (Author), 2016, Mitmachen, Gehorchen oder Fernbleiben. Was die politische Kultur in Deutschland heute ausmacht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419562