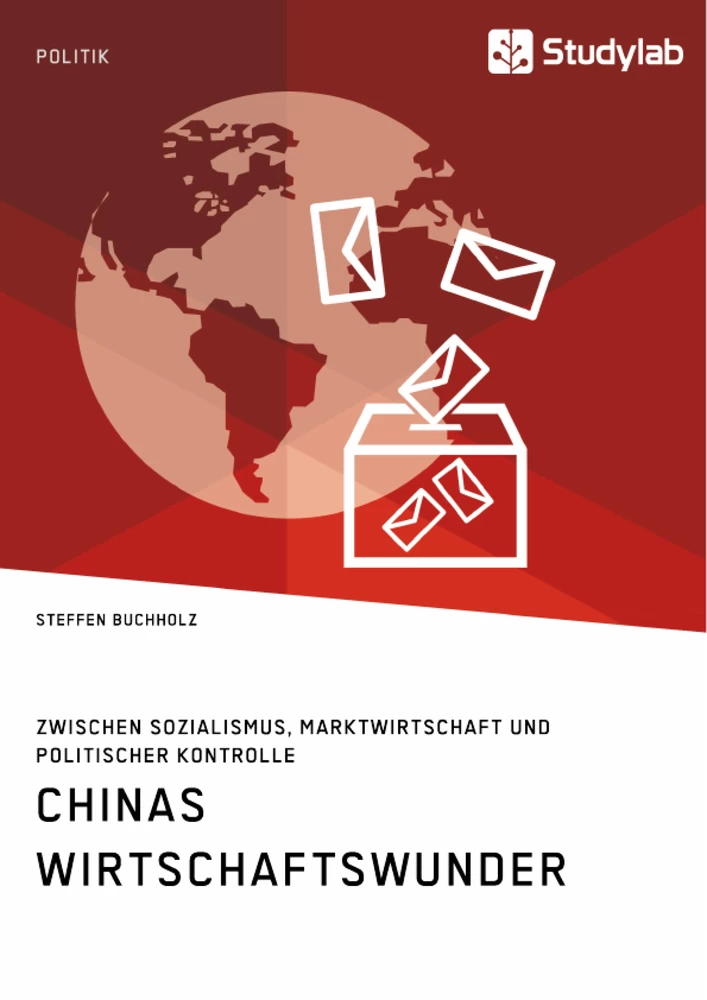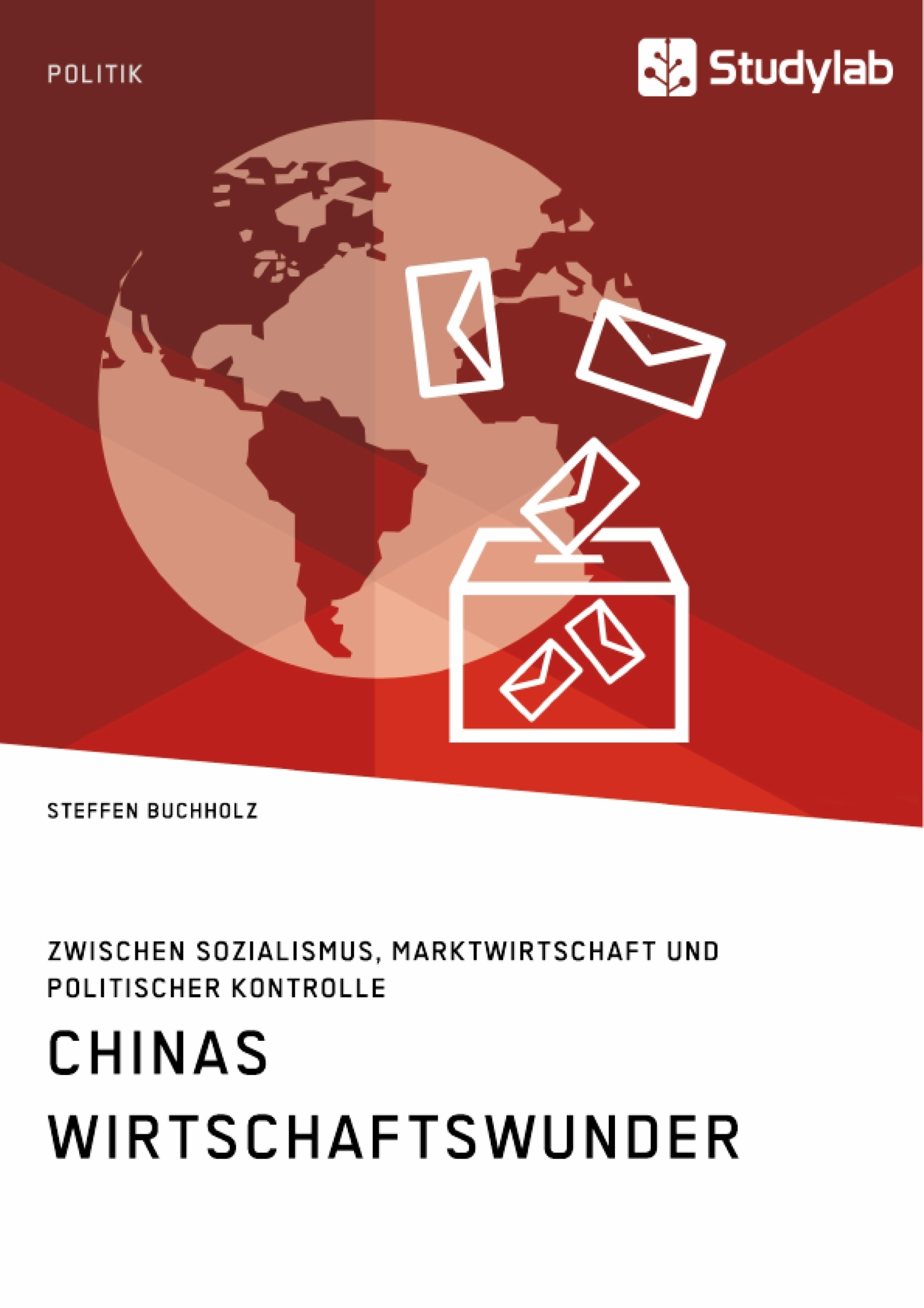Die Volksrepublik China hat in den letzten Jahrzehnten einen explosionsartigen wirtschaftlichen Aufschwung geschafft. Nach wie vor sorgt das anhaltende Wirtschaftswachstum weltweit für Bewunderung.
Doch welche Rolle spielt die politische Kontrolle durch die Kommunistische Partei Chinas bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes? Steffen Buchholz geht dieser Frage im Rahmen seiner Publikation nach.
Dafür stellt er zunächst den Aufbau des chinesischen Staates und das Verhältnis der Kommunistischen Partei zu Staat und Wirtschaft vor. Darauf aufbauend untersucht er, welchen Anteil die staatliche Kontrolle am Wirtschaftserfolg hat und was die Grenzen des staatlichen Einflusses sind.
Aus dem Inhalt:
- Volksrepublik China;
- Wirtschaftspolitik;
- Xi Jinping;
- politische Kontrolle;
- Wirtschaftswachstum
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau des chinesischen Staates
- Die Rolle der Partei
- Das Verhältnis von Partei und Staat
- Der Aufbau der Partei
- Das Verhältnis von Partei und Wirtschaft
- Reformverlauf und heutiges Wirtschaftssystem
- Reformverlauf seit dem Ende der Mao-Ära
- Das Wirtschaftssystem Chinas heute
- Einfluss der Reformen auf die staatliche Kontrolle
- Unternehmensformen in China
- Überblick
- Kommunale Wirtschaftsunternehmen (TVEs)
- Methoden der staatlichen Kontrolle
- Kategorien staatlichen Einflusses
- Besonderheiten und Methoden des staatlichen Eingriffs in China
- Das Verhältnis von staatlichem Einfluss und Wirtschaftswachstum
- Anteil der Kontrolle am wirtschaftlichen Erfolg
- Grenzen der Kontrolle
- Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten
- Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen
- Die Stärkung der politischen Kontrolle durch Xi
- Die Herausforderung durch die digitale Entwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch analysiert das Wirtschaftswunder Chinas, das durch die Einführung von Marktwirtschaftsmechanismen in ein sozialistisches System erreicht wurde. Es untersucht die komplexe Beziehung zwischen staatlicher Kontrolle, wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Stabilität im Kontext des chinesischen Modells.
- Die Rolle der Kommunistischen Partei Chinas in der Wirtschaft
- Die Entwicklung des chinesischen Wirtschaftssystems
- Die Methoden der staatlichen Kontrolle
- Der Einfluss des staatlichen Einflusses auf das Wirtschaftswachstum
- Aktuelle Herausforderungen und Zukunftsaussichten der chinesischen Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Einleitung dar und gibt einen Überblick über die Thematik. Kapitel zwei analysiert den Aufbau des chinesischen Staates und seinen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung. Kapitel drei behandelt die Rolle der Partei und ihr Verhältnis zum Staat und der Wirtschaft. Die Kapitel vier und fünf befassen sich mit dem Reformverlauf und der Entwicklung des heutigen Wirtschaftssystems sowie den verschiedenen Unternehmensformen in China. Kapitel sechs widmet sich den Methoden der staatlichen Kontrolle und deren Einfluss auf die Wirtschaft. In Kapitel sieben wird das Verhältnis von staatlichem Einfluss und Wirtschaftswachstum untersucht. Kapitel acht beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten, einschließlich der wirtschaftlichen Herausforderungen, der Stärkung der politischen Kontrolle und der digitalen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Chinas Wirtschaftswunder, Sozialismus, Marktwirtschaft, politische Kontrolle, Kommunistische Partei Chinas, staatliche Kontrolle, Wirtschaftswachstum, Reformverlauf, Unternehmensformen, digitale Entwicklung.
- Quote paper
- Steffen Buchholz (Author), 2018, Chinas Wirtschaftswunder. Zwischen Sozialismus, Marktwirtschaft und politischer Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419686