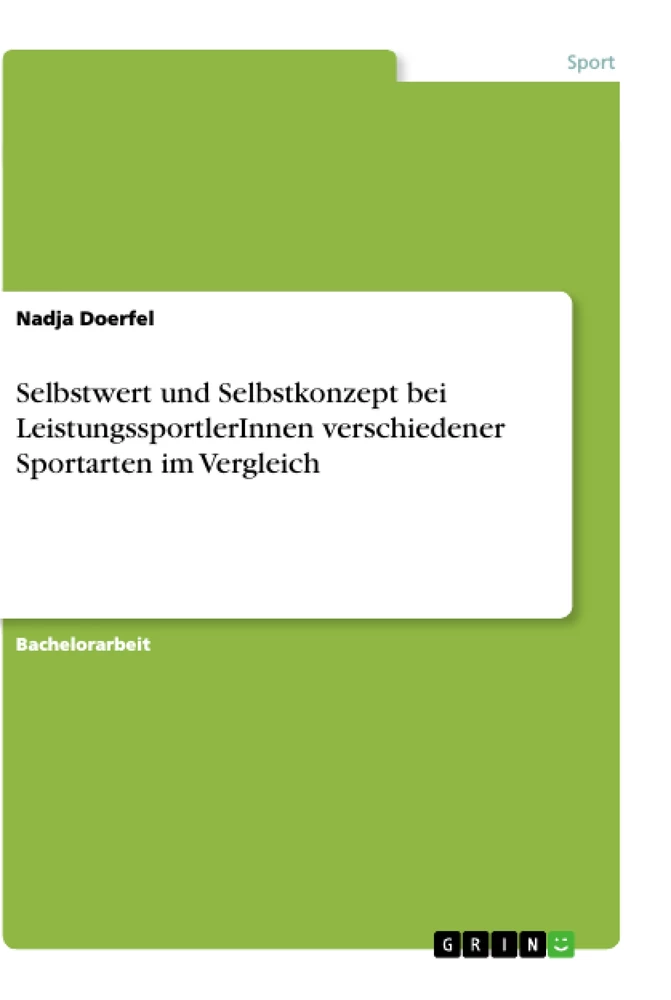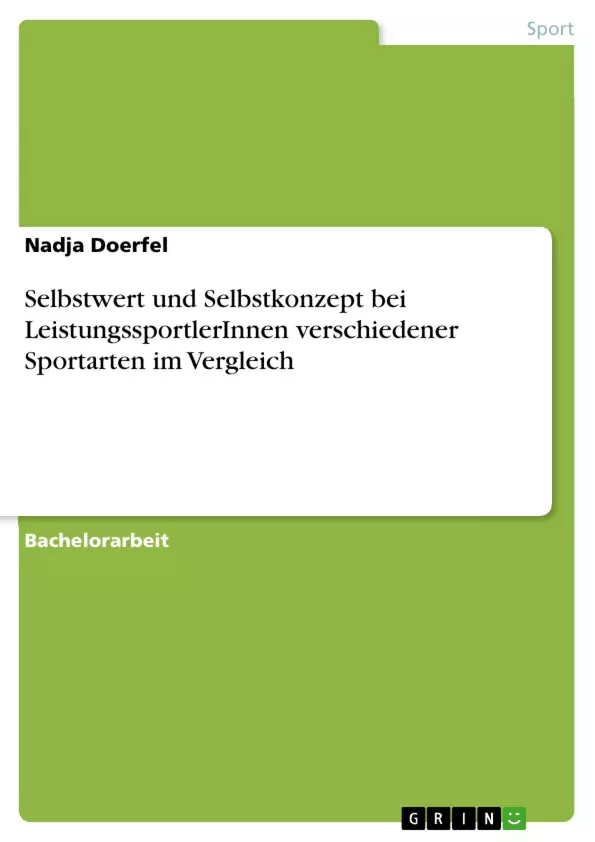Im Rahmen dieser Arbeit wird auf den Selbstwert und das Selbstkonzept von LeistungssportlerInnen verschiedener Sportarten im Vergleich eingegangen. Hierbei wird das physische Selbstkonzept zum einen, als auch der Selbstwert, zum anderen betrachtet. In weiterer Analyse werden Zusammenhänge verschiedener Aspekte von Verhaltensgewohnheiten erschlossen, wie z.B. Streben nach Perfektionismus, bzw. interozeptive Wahrnehmung und Selbstwertschätzung von LeistungssportlerInnen zusammenhängen. Da die Begrifflichkeiten im Rahmen der Sportpsychologie von Bedeutung sind, soll veranschaulicht werden, wie Selbstwert und Selbstbild von SportlerInnen entstehen und welche verschiedenen Ressourcen und Schwierigkeiten dies mit sich bringen kann.
Leitfragen dieser Bachelorarbeit: Führen ästhetische Sportarten zu einem höheren Selbstwert? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Anspruch der SportlerInnen perfekt sein zu wollen und deren Selbstwert? Wie äußert sich Selbstwertgefühl bei TeamsportlerInnen, bzw. SportlerInnen in nichtästhetischen Sportarten, im Vergleich zu SportlerInnen in Einzelsportarten bzw. SportlerInnen ästhetischer Sportarten? Ist die interozeptive Wahrnehmnung ein Indikator für fehlenden Selbstwert von LeistungssportlerInnen?
Das methodische Vorgehen wird detailliert beschrieben, wobei zunächst die Stichprobe, die soziodemographischen und sportbezogenen Variablen erwähnt werden. Anschließend werden verschiedene Fragebögen, welche die Selbstwertschätzung, Selbstkonzept, Perfektionismus und interozeptive Wahrnehmung der SportlerInnen messen, dargestellt. Danach werden angewandte statistische Verfahren und die Untersuchungsdurchführung veranschaulicht. Im fünften Kapitel werden konkrete Ergebnisse der zuvor genannten Hypothesen dargestellt. Die Voraussetzungen der statistischen Testverfahren werden zunächst überprüft, um daran anschließend zu analysieren, welche Rückschlüsse die Gruppenzugehörigkeit von SportlerInnen bzgl. ihres Selbstkonzeptes oder Selbstwertgefühls zulässt. In der Diskussion werden die Kernaussagen der Arbeit noch einmal zusammengefasst. Es wird ein Ausblick in die Zukunft der LeistungsportlerInnen gewagt, im Hinblick auf die Förderung von Ressourcen und selbstwertdienlichen Strategien. Schlussfolgernd wird angenommen, dass jede/r LeistungssportlerIn unabhängig von der Sportart, erlernen kann selbstwertdienliche Strategien anzuwenden und belastbar zu sein. Hierbei nimmt die Förderung von Ressourcen & Resilienz einen wichtigen Platz ein.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Begriffsklärung
- 1.2 Theoretischer und empirischer Forschungsstand
- 1.2.1 Die Entwicklung des Selbstwertes
- 1.2.2 Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson, Hubner & Stanton
- 1.2.3 Entwicklungspsychologische Zusammenhänge von Selbstkonzept und sozialen Attributen
- 2 Ableitung der Fragestellung
- 3 Hypothesen
- 3.1 Gerichtete Haupthypothesen zur Unterscheidung des Selbstwertes bei SportlerInnen in Einzel- und Teamsportarten
- 3.2 Gerichtete Haupthypothesen zur Unterscheidung des Selbstwertes bei SportlerInnen in ästhetischen und nichtästhetischen Sportarten
- 3.3 Gerichtete Haupthypothese zur Unterscheidung des physischen Selbstkonzeptes bei SportlerInnen in Einzel- und Teamsportarten
- 3.4 Gerichtete Haupthypothesen zur Unterscheidung des physischen Selbstkonzeptes bei SportlerInnen in ästhetischen und nichtästhetischen Sportarten
- 3.5 Gerichtete Unterhypothesen zur Unterscheidung des Selbstwertes bei SportlerInnen in spezifischen ästhetischen und nichtästhetischen Sportarten
- 3.6 Gerichtete Zusammenhangshypothesen
- 4 Methoden
- 4.1 Experimentelles Forschungsdesign
- 4.2 Stichprobenbeschreibung
- 4.2.1 Soziodemographische Merkmale der Gesamtstichprobe
- 4.2.2 Sportbezogene Merkmale der Gesamtstichprobe
- 4.3 Versuchsmaterialien
- 4.3.1 Physical Self-Description Questionnaire
- 4.3.2 Multidimensionale Selbstwertskala
- 4.3.3 Eating Disorder Inventory-2
- 4.4 Generierung der Stichproben und Datenerhebung
- 4.5 Statistische Auswertung und angewandte statistische Verfahren
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Voraussetzungen der angewandten statistischen Verfahren
- 5.2 Testung der Hypothesen
- 6 Diskussion
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.2 Interpretationen und Implikationen
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Untersuchung des Selbstwertes und des Selbstkonzepts bei LeistungssportlerInnen unterschiedlicher Sportarten. Die Arbeit zielt darauf ab, potenzielle Unterschiede im Selbstwert und im Selbstkonzept von SportlerInnen in Einzel- und Teamsportarten sowie in ästhetischen und nichtästhetischen Sportarten aufzudecken.
- Untersuchung des Selbstwertes und des Selbstkonzepts bei LeistungssportlerInnen
- Analyse von Unterschieden zwischen SportlerInnen in Einzel- und Teamsportarten
- Betrachtung von Unterschieden zwischen SportlerInnen in ästhetischen und nichtästhetischen Sportarten
- Erforschung des Einflusses von Sportarten auf das physische Selbstkonzept
- Beziehung zwischen Selbstwert, Selbstkonzept und sportlichen Aktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die relevanten Konzepte wie Selbstwert und Selbstkonzept. Es bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, wobei besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Selbstwertes, das hierarchische Selbstkonzeptmodell und die Zusammenhänge zwischen Selbstkonzept und sozialen Attributen gelegt wird.
Kapitel 2 leitet aus den theoretischen Grundlagen die Forschungsfrage ab, die im Fokus dieser Arbeit steht.
Kapitel 3 präsentiert die formulierten Hypothesen, die sich auf die Unterschiede im Selbstwert und Selbstkonzept von SportlerInnen in verschiedenen Sportarten beziehen.
Kapitel 4 beschreibt die eingesetzten Methoden und das experimentelle Forschungsdesign. Es werden die Stichproben, die verwendeten Messinstrumente und die statistischen Verfahren detailliert erläutert.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der durchgeführten statistischen Analysen zusammen.
Kapitel 6 interpretiert die Ergebnisse und diskutiert deren Implikationen für die Forschung und die Praxis. Es werden mögliche Limitationen der Studie sowie weitere Forschungsbedarfe aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Selbstwert, Selbstkonzept, Leistungssport, Sportarten, Einzel- und Teamsport, ästhetische und nichtästhetische Sportarten, physisches Selbstkonzept, psychologische Merkmale von SportlerInnen, empirische Forschung, statistische Analysen.
- Citation du texte
- Nadja Doerfel (Auteur), 2016, Selbstwert und Selbstkonzept bei LeistungssportlerInnen verschiedener Sportarten im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419819