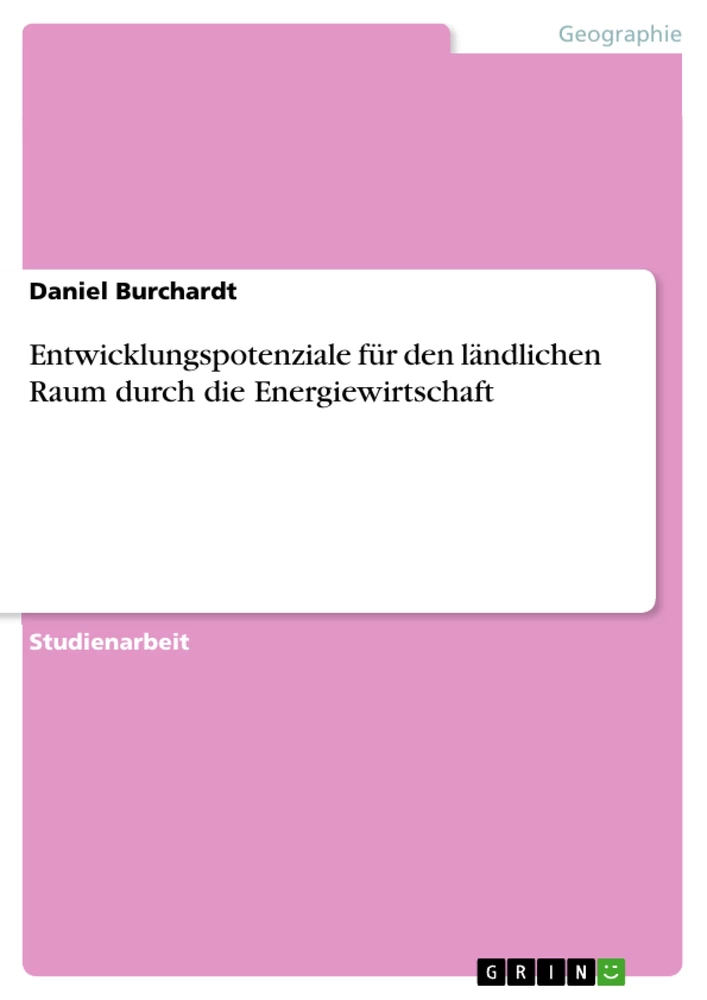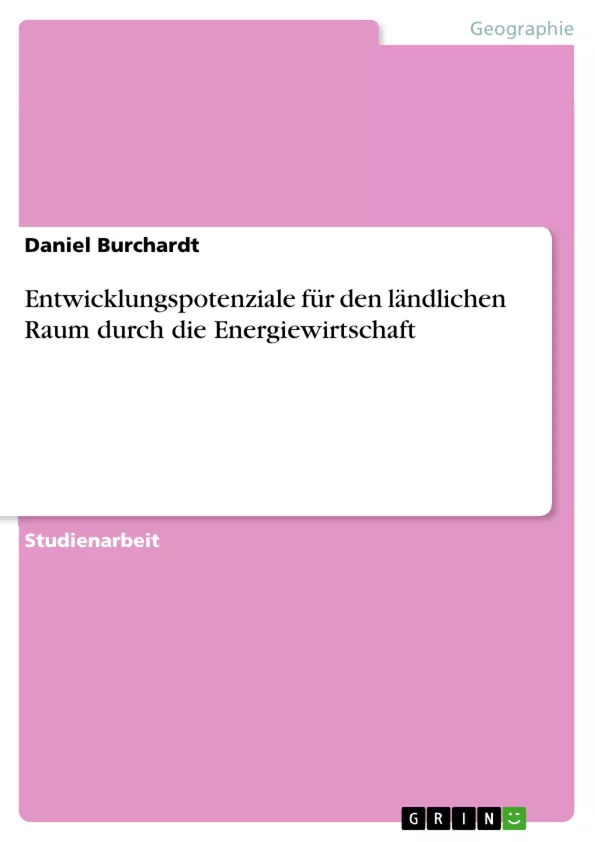Zu Zeiten der Energiewende, welche einen kontinuierlich wachsenden Wechsel von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energieträgern anstrebt, betrifft es auch den ländlichen Raum. Grund dafür ist, dass es in urbanen Räumen kaum ausreichende Platzangebote für den Aus- und Aufbau von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien existieren. Bisweilen konnte man sich unter dem ländlichen Raum eine oft-mals sehr natürliche belassene Fläche mit einzelnen Dörfern, die zueinander in teils weiter Entfernung liegen und geringe Einwohnerzahlen aufweisen, vorstellen.
Durch die Energiewende kann sich dieser Tatbestand jedoch ändern, da der ländliche Raum mit seinem großzügigen Platzangebot ideal geeignet sein kann um Anlagen für erneuerbare Energien zu errichten. Aus diesem Sachverhalt können sich daher für die Energiewirtschaft, ländlichen Raum und der Bundesrepublik Deutschland große Poten-ziale ergeben. Allerdings sind diese immer auch an verschiedene Herausforderungen gekoppelt, die es gilt im Vorfeld zu meistern. Nur dann, wenn also alle Instanzen sich in der Lage fühlen miteinander zu kooperieren und Ihre gegenseitigen Interessen be-rücksichtigen, können für alle befriedigende Lösungen gefunden werden.
Aus den aktuellen Gegebenheiten ergibt sich die zentrale Frage, welche Entwicklungspotenziale für den ländlichen Raum durch die Energiewirtschaft vorhanden sind.
Inhaltsverzeichnis
-Einleitung
-Energiewirtschaft
1.1 Energiewirtschaft und deren Anlass zum Wandel
1.2 Inhaltliche und statistische Abgrenzung der Energiewirtschaft
2 Der ländliche Raum
2.1 Merkmale des ländlichen Raumes
2.2 Aufgaben du Funktionen des ländlichen Raumes
2.3 Geschichtliche Nutzung des ländlichen Raumes
2.4 Bedeutung der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum
3 Aktuelle Herausforderungen und Potenziale
3.1 Teilbereich der Landschaftsästhetik
3.2 Teilbereich der Raumverträglichkeit
3.3 Teilbereich des Infrastrukturausbaus
3.4 Teilbereich des Fachkräftemangels
4 Aktuelle Fallbeispiele
4.1 Windenergie
4.2 Biogas
Schluss
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Systematik der statistischen Abgrenzung der Energiewirtschaft
Abb. 2 Funktionen des ländlichen Raumes in der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft
Abb. 3 Darstellung der Umfassungswirkung durch Windenergieanlagen der Gemeinde Iven
Tabellenvverzeichnis
Tab. 1: Überblick über Auseinandersetzung mit einem Kriterium zur Verhinderung einer „Umzingelungswirkung“ von Windenergieanlagen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Energiewirtschaft
- Energiewirtschaft und deren Anlass zum Wandel
- Inhaltliche und statistische Abgrenzung der Energiewirtschaft
- Der ländliche Raum
- Merkmale des ländlichen Raumes
- Aufgaben und Funktionen des ländlichen Raumes
- Geschichtliche Nutzung des ländlichen Raumes
- Bedeutung der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum
- Aktuelle Herausforderungen und Potenziale
- Teilbereich der Landschaftsästhetik
- Teilbereich der Raumverträglichkeit
- Teilbereich des Infrastrukturausbaus
- Teilbereich des Fachkräftemangels
- Aktuelle Fallbeispiele
- Windenergie
- Biogas
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklungspotenziale der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Energiewende für ländliche Regionen ergeben. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wechselwirkungen zwischen der Energiewirtschaft und den spezifischen Gegebenheiten des ländlichen Raumes.
- Definition und Wandel der Energiewirtschaft
- Charakteristika und Funktionen des ländlichen Raumes
- Potenziale erneuerbarer Energien im ländlichen Raum
- Herausforderungen wie Landschaftsästhetik, Raumverträglichkeit und Infrastrukturausbau
- Fallbeispiele aus der Wind- und Bioenergiebranche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Entwicklungspotenziale der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum ein. Sie betont die Bedeutung der Energiewende und die Notwendigkeit, die Chancen und Herausforderungen für ländliche Regionen zu analysieren. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die zentralen Fragestellungen.
Energiewirtschaft: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Energiewirtschaft und analysiert den Wandel, der durch die Energiewende ausgelöst wurde. Es beschreibt den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien und die damit verbundenen politischen Ziele und Maßnahmen. Die Bedeutung der Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit wird hervorgehoben.
Der ländliche Raum: Dieses Kapitel charakterisiert den ländlichen Raum, seine Funktionen und seine historische Entwicklung. Es beschreibt die Merkmale ländlicher Gebiete und analysiert deren Bedeutung im Kontext der Energiewende. Das Kapitel beleuchtet das Potenzial des ländlichen Raumes für den Ausbau erneuerbarer Energien.
Aktuelle Herausforderungen und Potenziale: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen und Potenziale, die sich aus dem Ausbau erneuerbarer Energien im ländlichen Raum ergeben. Es analysiert verschiedene Teilbereiche, wie Landschaftsästhetik, Raumverträglichkeit, Infrastrukturausbau und Fachkräftemangel und diskutiert ihre Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende im ländlichen Raum. Die Interdependenzen dieser Teilbereiche werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Energiewende, ländlicher Raum, erneuerbare Energien, Windenergie, Bioenergie, Raumordnung, Landschaftsästhetik, Infrastruktur, Fachkräftemangel, Entwicklungspotenziale, Herausforderungen, Potenziale.
FAQ: Entwicklungspotenziale der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklungspotenziale der Energiewirtschaft für den ländlichen Raum. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Energiewende für ländliche Regionen und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Energiewirtschaft und den Gegebenheiten des ländlichen Raumes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Wandel der Energiewirtschaft, Charakteristika und Funktionen des ländlichen Raumes, Potenziale erneuerbarer Energien im ländlichen Raum, Herausforderungen wie Landschaftsästhetik, Raumverträglichkeit und Infrastrukturausbau, sowie Fallbeispiele aus der Wind- und Bioenergiebranche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Energiewirtschaft und zum ländlichen Raum, ein Kapitel zu aktuellen Herausforderungen und Potenzialen, Kapitel mit Fallbeispielen (Wind- und Bioenergie) und einen Schluss. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was sind die zentralen Herausforderungen für den Ausbau erneuerbarer Energien im ländlichen Raum?
Die Arbeit identifiziert Herausforderungen wie die Landschaftsästhetik, die Raumverträglichkeit, den Infrastrukturausbau und den Fachkräftemangel. Die Interdependenzen dieser Teilbereiche werden analysiert.
Welche Potenziale bietet der ländliche Raum für die Energiewirtschaft?
Die Arbeit beleuchtet das Potenzial des ländlichen Raumes für den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere im Bereich der Wind- und Bioenergie. Konkrete Fallbeispiele illustrieren diese Potenziale.
Was wird unter "Energiewende" im Kontext dieser Arbeit verstanden?
Die "Energiewende" bezieht sich auf den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien und die damit verbundenen politischen Ziele und Maßnahmen. Die Bedeutung der Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Energiewende, ländlicher Raum, erneuerbare Energien, Windenergie, Bioenergie, Raumordnung, Landschaftsästhetik, Infrastruktur, Fachkräftemangel, Entwicklungspotenziale, Herausforderungen, Potenziale.
Wie wird der ländliche Raum in der Arbeit definiert und charakterisiert?
Die Arbeit charakterisiert den ländlichen Raum anhand seiner Merkmale, Funktionen und historischen Entwicklung. Die Bedeutung des ländlichen Raumes im Kontext der Energiewende wird analysiert.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Fallbeispiele aus der Windenergie- und Bioenergiebranche, um die konkreten Potenziale und Herausforderungen zu illustrieren.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich für die Entwicklungspotenziale der Energiewirtschaft im ländlichen Raum interessieren, insbesondere im akademischen Kontext.
- Quote paper
- Daniel Burchardt (Author), 2017, Entwicklungspotenziale für den ländlichen Raum durch die Energiewirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420426