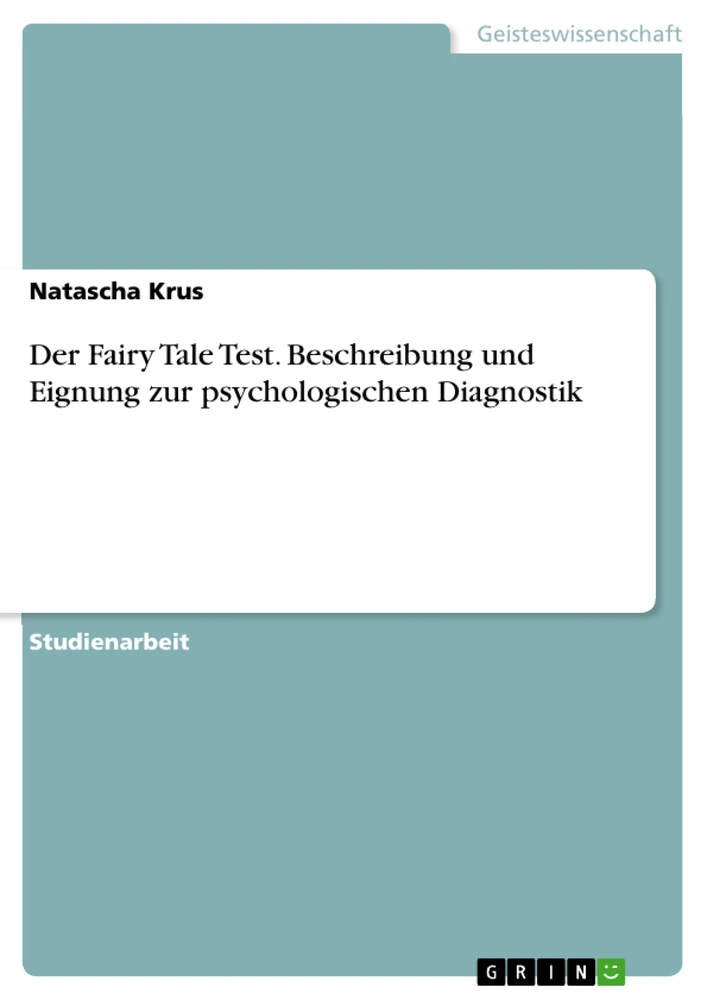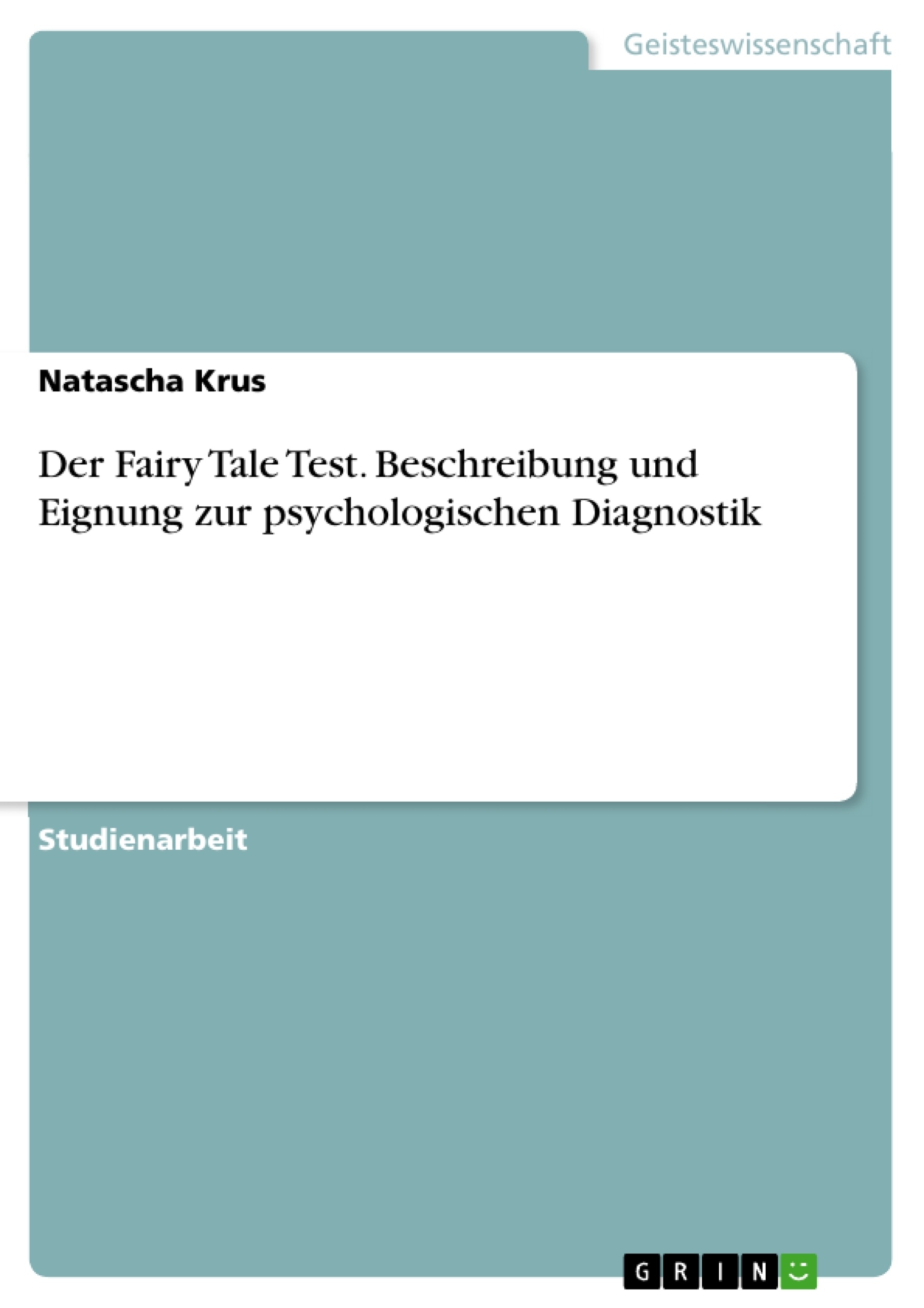Der Fairy Tale Test macht sich die Vertrautheit von Kindern zur Märchenwelt zu nutze. Er wurde so konzipiert, dass sich die Testsituation wie ein Spiel für die Kinder anfühlt und so Hemmungen beseitigt und eventueller Frustration vorbeugt. Mittels Testkarten, die überwiegend Szenen aus „Rotkäppchen“ und „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zeigen, werden „[…] eine große Anzahl an Persönlichkeitsvariablen, von denen die meisten testtheoretisch gut zu berechnen sind“, (Coulacoglou, 1996, S.12) untersucht.
Der FTT stellt den Anspruch, ein „[…] psychometrisch zufriedenstellendes Testinstrument […]“ (Coulacoglou, 1996, S.13) zu sein, das die Psychodynamik des Kindes erfassen kann. Betrachtet werden neben einzelnen Persönlichkeitszügen auch ihre Interrelationen. Der Test kann laut Coulacoglou auf verschiedene Weise eingesetzt werden, beispielsweise als Grundlagentechnik, Verfahren aber auch als Hilfsmittel. So eignet er sich im klinisch-diagnostischen Bereich, wie auch für die Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Überblick
- Projektive Testverfahren
- Märchen
- Fairy Tale Test (FTT)
- Entwicklung und Verwendungszweck
- Testkarten
- Durchführung
- Testpersonen
- Testleiter/in
- Testzeit
- Vorgehensweise
- Variablenskalierung
- Beschreibung der Ratingskalen
- Auswertung
- Gütekriterien
- Fazit
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Semesterarbeit befasst sich mit dem Fairy Tale Test (FTT), einem projektiven Testverfahren, das in der psychologischen Diagnostik von Kindern eingesetzt wird. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Entwicklung, des Verwendungszwecks und der Gütekriterien des FTT. Die Arbeit analysiert die Anwendung des Verfahrens und beleuchtet dessen Bedeutung und Relevanz im Kontext der diagnostischen Arbeit mit Kindern.
- Entwicklung und Anwendung des Fairy Tale Tests (FTT)
- Projektive Testverfahren in der Kinderdiagnostik
- Gütekriterien des FTT
- Einsatz des FTT in der psychologischen Diagnostik
- Bedeutung des FTT im Kontext der diagnostischen Arbeit mit Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Theoretischer Überblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Bedeutung der Sorgfältigkeit in der psychologischen Diagnostik von Kindern. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung von Kindern ergeben, und die Notwendigkeit, diagnostische Verfahren an den jeweiligen Entwicklungsstand anzupassen. Außerdem wird die Bedeutung projektiver Testverfahren in der Kinderdiagnostik diskutiert, wobei ihre Vor- und Nachteile sowie ihre Anwendung in verschiedenen Testformaten beleuchtet werden. Die Kapitel behandelt auch die Definition von „Projektion“ im Sinne von Freud und die Rolle dieses Abwehrmechanismus in der Psychodiagnostik.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Fairy Tale Test (FTT), projektive Testverfahren, Kinderdiagnostik, Gütekriterien, Entwicklung, Anwendung, Diagnostik, Projektion, Abwehrmechanismus.
- Quote paper
- Natascha Krus (Author), 2018, Der Fairy Tale Test. Beschreibung und Eignung zur psychologischen Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420575