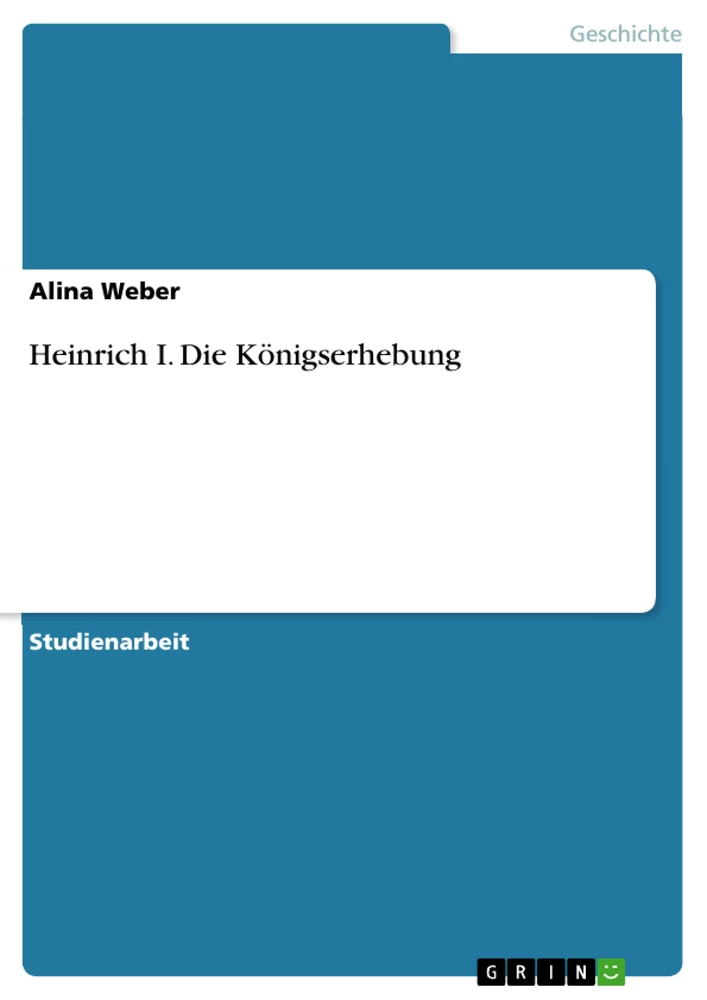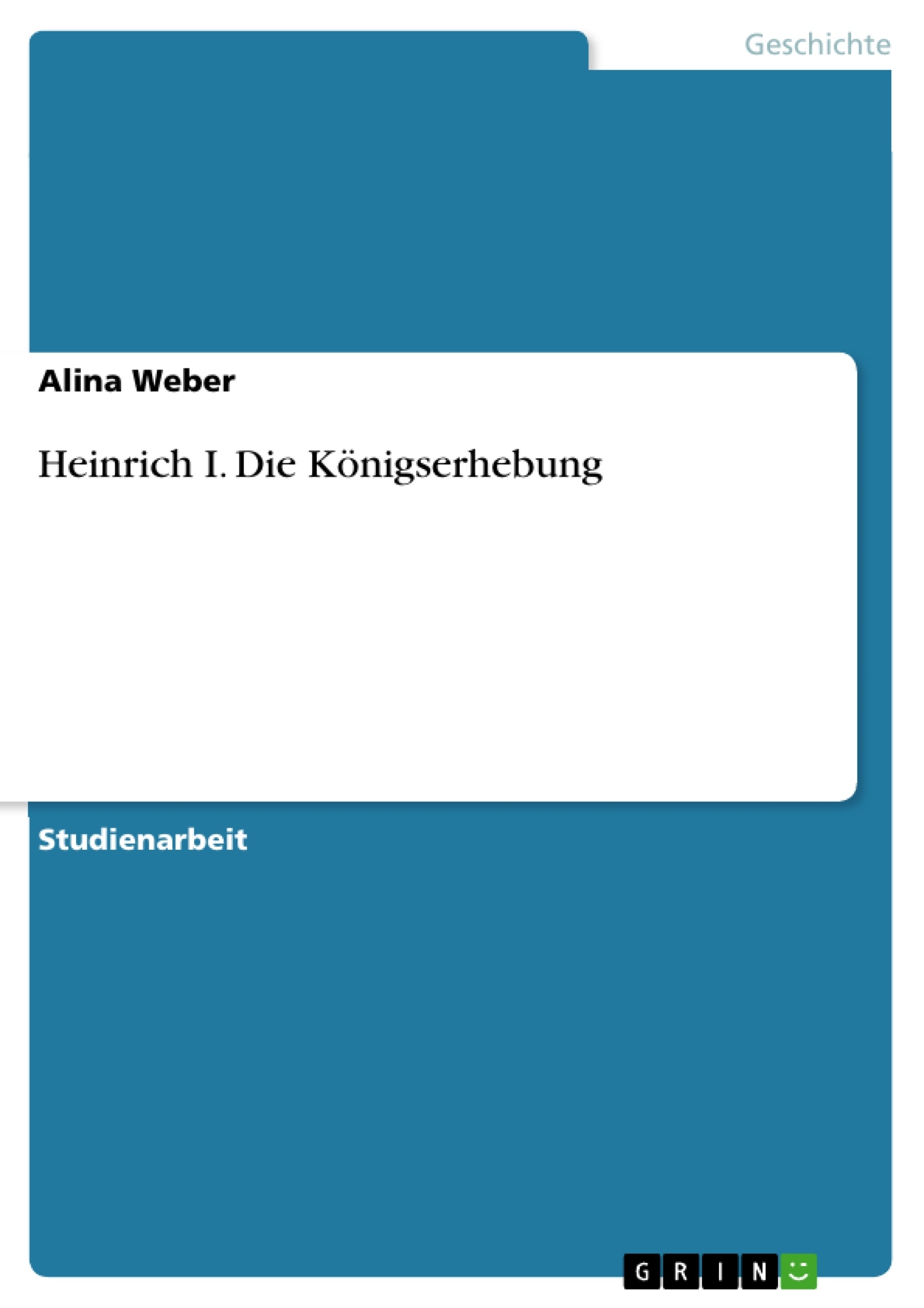Heinrich wurde als dritter Sohn Ottos des Erlauchten um 876 geboren. Vermutlich etwas früher als im Frühjahr 906 vertraute ihm sein Vater ein militärisches Kommando gegen das slawische Volk der Daleminzier in der Gegend von Meißen an. Um dieselbe Zeit heiratete Heinrich, wobei sein Vater Otto als Familienoberhaupt gewiss das letzte Wort der Entscheidung bei der Auswahl der zukünftigen Gattin und dem Zustandekommen der Ehe hatte. Hatheburg, die Tochter Erwins, wurde auserwählt. Der Adelige Erwin besaß den größten Teil der Merseburger Burg. Erwin hatte keinen Sohn, weshalb er sein reiches Erbe seiner Tochter Hatheburg und ihrer Schwester überließ. Der erste Mann von Hatheburg war verstorben, sodass sie bereits den Witwenschleier und eine Wohnung in einem Kloster genommen hatte. Dem kirchlichen Verständnis zufolge war somit eine erneute Heirat ausgeschlossen. Heinrich warb jedoch so hartnäckig um Hatheburg, bis sie schließlich der Ehe einwilligte. So nahm Heinrich Merseburg in Besitz. Bischof Siegmund von Halberstadt untersagte Heinrich die eheliche Gemeinschaft mit Hatheburg. Vermutlich sei es nur der Intervention des Königs zu verdanken gewesen, dass der Bischof diese Sanktion zurückzog. Heinrich weg schien somit festgelegt: Als regionaler Machthaber in und um Merseburg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heinrich als alleiniger Erbe seines Vaters
- Die Heirat mit Mathilde
- Die Königserhebung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Königserhebung Heinrichs I. und analysiert die politischen und familiären Umstände, die zu diesem historischen Ereignis führten. Sie beleuchtet die Rolle Heinrichs als Sohn Ottos des Erlauchten und seine Entwicklung vom nachgeordneten Anwärter zum alleinigen Erben. Dabei stehen die strategischen Entscheidungen Heinrichs bezüglich der Ehe und die bedeutenden politischen Ereignisse in den Jahren vor seiner Krönung im Fokus.
- Die Bedeutung der Ehe Heinrichs I. für seine politische Entwicklung
- Die Rolle der Familie und des Erbes in der frühmittelalterlichen Herrschaftsübernahme
- Die politischen Konstellationen und Machtkämpfe vor der Königserhebung
- Die Bedeutung der Königswahld für die Herausbildung des Ostfränkischen Reiches
- Die Quellenlage und die Schwierigkeiten der Rekonstruktion der Ottonischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das erste Kapitel führt den Leser in die Familiengeschichte Heinrichs I. ein und stellt seinen Werdegang als dritter Sohn Ottos des Erlauchten dar. Es beleuchtet Heinrichs frühe militärische Erfahrungen sowie seine erste Ehe mit Hatheburg, die strategische Bedeutung für seinen Besitz in Merseburg hatte.
Heinrich als alleiniger Erbe seines Vaters
Das zweite Kapitel behandelt die bedeutsame Wendung in Heinrichs Leben, die durch den frühen Tod seiner älteren Brüder eingeleitet wurde. Es beschreibt die Rolle der Ehe mit Hatheburg als Mittel zur Entschädigung für den Verlust des Erbes seiner Familie und die strategische Bedeutung der Ehe für Heinrichs Position.
Die Heirat mit Mathilde
In diesem Abschnitt wird die Auflösung der ersten Ehe Heinrichs und die Gründe für die Heirat mit Mathilde beleuchtet. Es werden die familiären Verbindungen Mathilde sowie ihre Bedeutung für Heinrichs politische Ambitionen im Rahmen der Nachfolge Ottos des Erlauchten erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Königserhebung, Heinrich I., Familie, Ehe, Machtpolitik, Frühmittelalter, Ottonen, Sachsen, Franken, Quellenkritik, Geschichte, Herrschaftsübernahme und politische Konstellationen. Insbesondere werden die strategischen Entscheidungen Heinrichs im Kontext der Erbschaftsregelungen, der Ehe und der politischen Machtkämpfe der Zeit analysiert.
- Arbeit zitieren
- Alina Weber (Autor:in), 2017, Heinrich I. Die Königserhebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420602