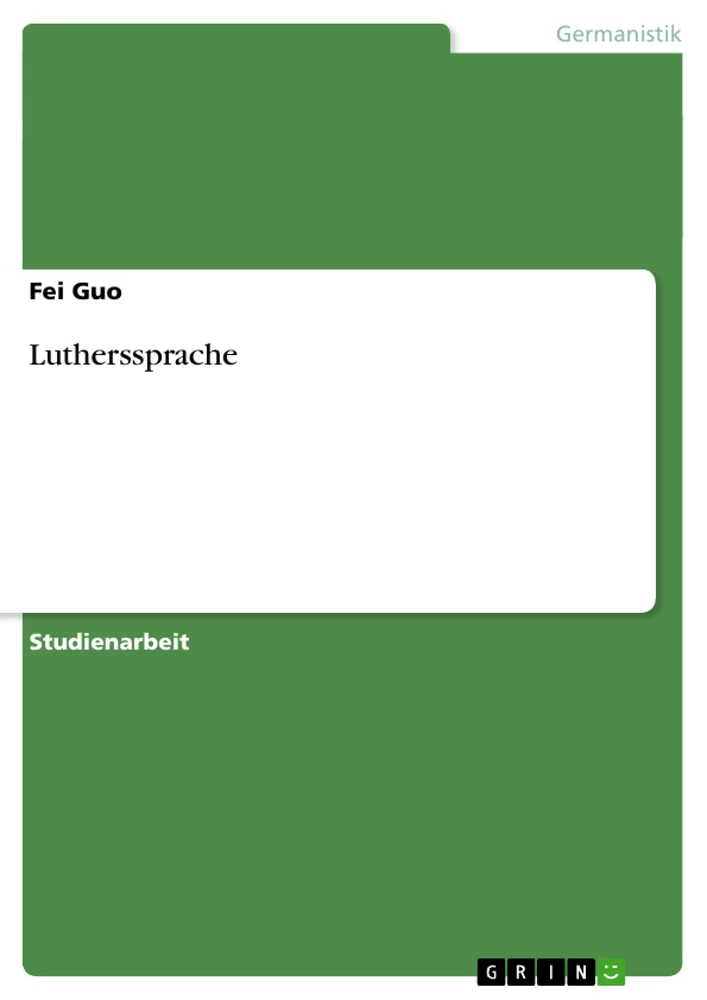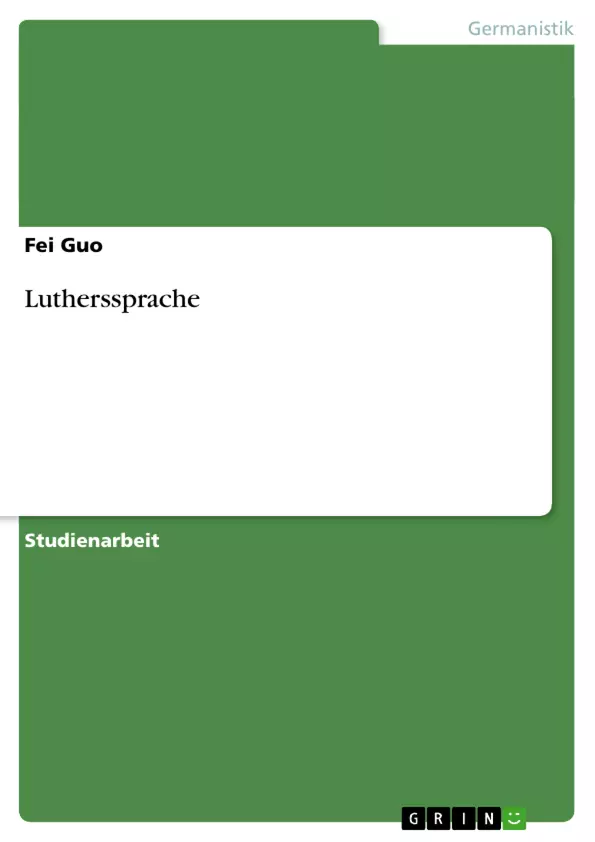Einleitung
Martin Luther wurde oft als „Schöpfer“ der neuhochdeutschen Schriftsprache betrachtet. Aber dies ist völlig falsch, denn Luther hat sich über das von ihm geschriebene Deutsch so geäußert:“ ich habe keine gewisse sonderliche eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche der gemeinen deutschen Sprache, das mich beide, Ober- und Niederländer, [d.i.Hoch –und Niederdeutsche] verstehen mögen. Ich rede nach der Sechsischen Cantzelei, welcher nachfolgen alle Fürsten und Könige in Deutschland. Alle Reichstete , Fürstenhöfe schreiben nach der sechsischen und unsers Fürsten Cantzelei ,darumb ists auch die gemeinste deutsche Sprache. „(Wolf ,1996,S. 32f.). Wir können diese Worte so verstehen: Martin Luther hat seine Sprache systematisch von allen lokalen Einflüssen freigemacht. Sie gehört keiner Mundart an, sondern einer Gattung des Hochdeutschen und wurde auch nicht, wie man vermuten könnte, von Luther geschaffen, sondern basiert auf dem früheren „ Gemeindeutschen „. Zwar ist Luther kein Schöpfer, aber seine Sprache hat dennoch großen Einfluss auf die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Ich werde dies im Folgenden anhand der Analyse seines Lautstandes von Vokalen und Konsonanten, der Entwicklung seiner Formenbildung des Verbs und des Substantivs zeigen , aber auch auf syntaktische Erscheinungen sowie auf den Wortschatz eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Lautstand in Luthers Sprache
- Vokalismus
- Übereinstimmungen mit dem Neuhochdeutschen
- Diphthongierung
- Monophthongierung
- Dehnung kurzer Vokale
- Senkung von mittelhochdeutschen u, ü und i
- Abweichungen vom Neuhochdeutschen
- Das e in unbetonten Nebensilben
- Andere lautliche Abweichungen
- Konsonantismus
- Die Entwicklung der s-Laute
- Die Entwicklung des mittelhochdeutschen h
- Formenbildung
- Formenbildung des Substantivs bei Luther
- Der Rückgang der Kasuskennzeichnung
- Der Ausbau der Numerusopposition
- Artikelgebrauch
- Formenbildung des Verbs -- Konjugation des Verbs
- Analytische Formenbildung bei Luther
- Luthers syntaktische Übereinstimmungen mit dem Nhd. und sein Wortschatz
- Luthers Übereinstimmungen bei der Ausbildung des nominalen Rahmens in der Substantivgruppe mit dem Nhd.
- Die Ausbildung des prädikativen Rahmens
- Luthers Wortschatz
- Forschungen um Luther und seine Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Sprache Martin Luthers und untersucht ihren Einfluss auf die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der lautlichen, morphologischen und syntaktischen Besonderheiten von Luthers Sprache im Vergleich zum Mittelhochdeutschen und zum Neuhochdeutschen.
- Lautliche Entwicklungen in Luthers Sprache: Diphthongierung, Monophthongierung, Dehnung kurzer Vokale, Senkung von Vokalen.
- Formenbildung des Substantivs und des Verbs: Rückgang der Kasuskennzeichnung, Ausbau der Numerusopposition, analytische Formenbildung.
- Syntaktische Übereinstimmungen mit dem Neuhochdeutschen: Ausbildung des nominalen und prädikativen Rahmens.
- Wortschatz: Einfluss von Luthers Sprache auf den Wortschatz der neuhochdeutschen Schriftsprache.
- Forschungen zu Luthers Sprache und ihre Bedeutung für die Sprachgeschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Luther keinen Einfluss auf die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache hatte, sondern die Sprache des „Gemeindeutschen“ übernahm.
- Der Lautstand in Luthers Sprache: Dieses Kapitel analysiert die lautlichen Besonderheiten von Luthers Sprache im Vergleich zum Mittelhochdeutschen und zum Neuhochdeutschen. Es zeigt Übereinstimmungen wie die Diphthongierung, Monophthongierung und Dehnung kurzer Vokale, aber auch Abweichungen, wie das e in unbetonten Nebensilben.
- Formenbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Formenbildung des Substantivs und des Verbs in Luthers Sprache. Es untersucht den Rückgang der Kasuskennzeichnung, den Ausbau der Numerusopposition und die analytische Formenbildung im Verb.
- Luthers syntaktische Übereinstimmungen mit dem Nhd. und sein Wortschatz: Dieses Kapitel analysiert die syntaktischen Gemeinsamkeiten zwischen Luthers Sprache und dem Neuhochdeutschen, sowie den Einfluss von Luthers Sprache auf den Wortschatz.
- Forschungen um Luther und seine Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet die Forschung zu Luthers Sprache und ihren Einfluss auf die Sprachgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Sprache Martin Luthers, die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, die lautliche und morphologische Entwicklung, den Vokalismus, den Konsonantismus, die Formenbildung des Substantivs und des Verbs, die Syntax, den Wortschatz und die Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Hat Martin Luther die neuhochdeutsche Sprache "erfunden"?
Nein, Luther war kein Schöpfer aus dem Nichts. Er nutzte die "gemeine deutsche Sprache" der sächsischen Kanzlei, die bereits als überregionale Verkehrssprache etabliert war.
Warum war Luthers Sprache dennoch so einflussreich?
Durch seine Bibelübersetzung und Schriften verbreitete er eine systematisch von lokalen Mundarten befreite Sprachform, die sowohl im Hoch- als auch im Niederdeutschen verstanden wurde.
Welche lautlichen Besonderheiten zeigt Luthers Sprache?
Die Arbeit analysiert Merkmale wie die Diphthongierung (mein statt mîn), Monophthongierung und die Dehnung kurzer Vokale, die den Übergang zum Neuhochdeutschen markieren.
Wie veränderte sich die Grammatik (Formenbildung) bei Luther?
Es lässt sich ein Rückgang der Kasuskennzeichnung bei Substantiven und ein Ausbau der Numerusopposition (Unterscheidung Einzahl/Mehrzahl) sowie eine analytische Formenbildung bei Verben feststellen.
Was ist die "Sächsische Kanzleisprache"?
Dies war die Verwaltungssprache der Kurfürsten von Sachsen, die aufgrund der politischen Bedeutung des Hofes als Vorbild für viele andere Fürstenhöfe und Reichsstädte diente.
- Arbeit zitieren
- Fei Guo (Autor:in), 2005, Lutherssprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42078