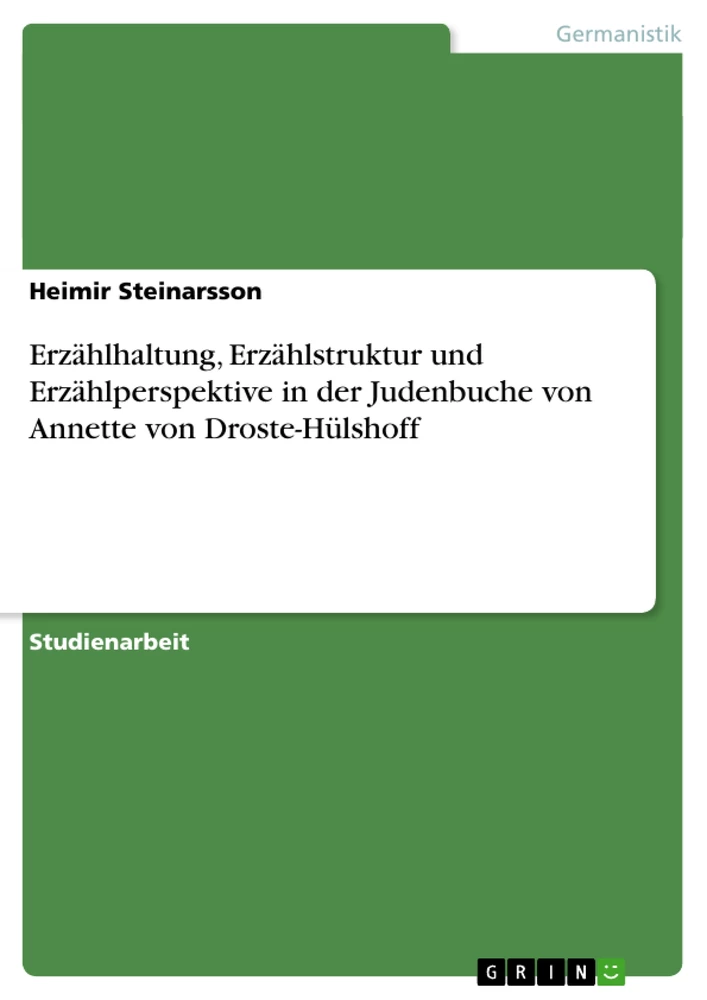Einleitung
Die Judenbuche von Annette von Droste Hülshoff ist eine der bekanntesten deutschen Erzählungen. Die Novelle, im 19. Jahrhundert geschrieben, ist seitdem immer wieder untersucht worden und ist auf verschiedenste Weise interpretiert worden.
Der Stoff beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Knecht Johann Georg Winkelhagen erschlug den Juden Soestmann-Behrens, floh vor der Verhaftung und geriet in algerische Sklaverei. 22 Jahre später kehrte er in die Heimat zurück und erhängte sich bald darauf am Ort des Verbrechens. 1818 wurde die Angelegenheit von August von Haxthausen 1818 als Geschichte eines Algierer-Sklaven veröffentlicht und sie hat der Dichterin als Quelle und Vorlage für ihre Novelle gedient.
Dieser Arbeit wird sich mit dem Aufbau der Novelle beschäftigen, mit der Erzählstruktur und der Perspektive, aus der die Erzählerin die Geschehnisse betrachtet. Außerdem wird die Zeitbehandlung in der Novelle analysiert und Fragen hinsichtlich des Stils und der Gattung behandelt.
Die literaturwissenschaftliche Forschung hat sich intensiv mit der Judenbuche auseinandergesetzt und vieles ist darüber geschrieben worden. In dieser Arbeit stütze ich mich auf zwei Analysen, zum einen die von Karl Philipp Moritz und zum anderen die in der Reihe Oldenbourg Interpretationen erschienene Untersuchung von Heinz Rölleke.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlung
- Wechsel von epischen und dialogischen Abschnitten
- Aufbauplan
- Epische Abschnitte
- Dialogische Szenen
- Aufbauplan
- Zeitbehandlung
- Zeitangaben
- "Zeitraffung und Zeitdehnung"
- Vorgriffe und Rückblenden
- Einstellung des Erzählers zum Erzählten
- Erzählperspektive
- Auktorialer Erzähler
- Anonyme Zeugen
- Stil
- "Gipfelstil"
- "Unterirdischer Erzählfluss"
- Filmische Erzählweise
- Enthüllungen und Verrätselungen
- Sprache
- Gattung
- "Eine unerhörte Begebenheit"
- Die Geschichte eines Mordes
- Die Kriminalgeschichte
- Ein Seelendrama
- Die Entwicklung eines Mörders
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Annette von Droste-Hülshoffs Novelle „Die Judenbuche“, fokussiert auf Erzählstruktur, -haltung und -perspektive. Die Zeitbehandlung, der Stil und die gattungsspezifische Einordnung werden ebenfalls untersucht. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des narrativen Aufbaus und der literarischen Gestaltung der Novelle zu entwickeln.
- Analyse der Erzählstruktur und des Wechsels zwischen epischen und dialogischen Abschnitten
- Untersuchung der Zeitgestaltung und ihrer Wirkung auf die Erzählung
- Erörterung des Erzählerstils und seiner Bedeutung für die Interpretation
- Klärung der gattungsspezifischen Merkmale der Novelle
- Interpretation der Entwicklung des Protagonisten Friedrich Mergel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung und die Rezeption von Annette von Droste-Hülshoffs „Die Judenbuche“. Sie skizziert den historischen Hintergrund, basierend auf der wahren Begebenheit um Johann Georg Winkelhagen, und benennt die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit, die sich mit dem Aufbau, der Erzählstruktur, der Perspektive, der Zeitbehandlung, dem Stil und der Gattung der Novelle auseinandersetzen wird. Die Arbeit stützt sich dabei auf ausgewählte literaturwissenschaftliche Analysen.
Handlung: Dieses Kapitel beschreibt die Handlung der Novelle, die das Leben des Protagonisten Friedrich Mergel von seiner Geburt bis zu seinem Tod nachzeichnet. Es wird seine schwierige Kindheit, sein Verhältnis zu seinem Umfeld, insbesondere zu seinem Onkel Simon und seinem Freund Johannes Niemand, sowie sein absteigender moralischer Werdegang geschildert. Der Fokus liegt auf Friedrichs Entwicklung zum Außenseiter und seiner schlussendlichen Beteiligung an einem Mord, seiner Flucht und seinem tragischen Ende durch Selbstmord nach seiner Rückkehr in die Heimat nach Jahren der Sklaverei. Die Handlung wird als Geschichte einer gescheiterten Existenz dargestellt, die durch gesellschaftliche und persönliche Umstände geprägt ist.
Wechsel von epischen und dialogischen Abschnitten: Dieser Abschnitt untersucht den charakteristischen Wechsel zwischen epischen und dialogischen Passagen in der Novelle. Er beleuchtet die unterschiedlichen Leseerfahrungen, die durch diese Technik erzeugt werden: während epische Abschnitte zur Reflexion anregen, vermitteln die Dialoge ein intensiveres, fast dramatisches Miterleben. Die Analyse bezieht sich auf die Arbeit von K.P. Moritz, der diesen Wechsel als rhythmisches Element beschreibt und dessen Wirkung auf die Leserhaltung herausstellt.
Zeitbehandlung: Das Kapitel analysiert die Zeitbehandlung in der Novelle. Es werden die verschiedenen Techniken der Zeitgestaltung, wie Zeitraffung, Zeitdehnung, Vorgriffe und Rückblenden, untersucht und deren Funktion innerhalb des narrativen Gefüges erörtert. Der Fokus liegt auf der Wirkung dieser Techniken auf die Spannung und die Erzählperspektive.
Einstellung des Erzählers zum Erzählten: Hier wird die Erzählperspektive und die Einstellung des Erzählers zum Erzählten analysiert. Die Analyse beleuchtet den auktorialen Erzähler und die Rolle anonymer Zeugen, die Informationen liefern und die Handlung mitgestalten. Es wird untersucht, wie die Erzählperspektive die Interpretation der Ereignisse und der Charaktere beeinflusst.
Stil: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Stil der Novelle. Es werden verschiedene Aspekte wie der "Gipfelstil", der "unterirdische Erzählfluss" und die filmische Erzählweise analysiert und deren Bedeutung für den Gesamteindruck der Novelle erläutert. Die Verwendung von Enthüllungen und Verrätselungen sowie die sprachliche Gestaltung werden ebenfalls thematisiert.
Gattung: Dieser Abschnitt widmet sich der gattungsspezifischen Einordnung der Novelle. Es werden verschiedene mögliche Gattungen betrachtet, wie z.B. "Eine unerhörte Begebenheit", Kriminalgeschichte, Seelendrama und die Entwicklung eines Mörders. Die Analyse untersucht die verschiedenen Aspekte, die auf diese verschiedenen Gattungen hinweisen und diskutiert die Vielschichtigkeit der Novelle und ihre Einordnung in die jeweilige Gattung.
Schlüsselwörter
Die Judenbuche, Annette von Droste-Hülshoff, Erzählhaltung, Erzählstruktur, Erzählperspektive, Zeitbehandlung, Stil, Gattung, Kriminalgeschichte, Seelendrama, Entwicklung eines Mörders, auktorialer Erzähler, epische und dialogische Abschnitte.
Häufig gestellte Fragen zu Annette von Droste-Hülshoffs „Die Judenbuche“
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit, die sich mit Annette von Droste-Hülshoffs Novelle „Die Judenbuche“ auseinandersetzt. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Analyse, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welches Thema wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Novelle „Die Judenbuche“ von Annette von Droste-Hülshoff, mit einem Fokus auf Erzählstruktur, -haltung und -perspektive. Weitere Untersuchungsschwerpunkte sind die Zeitbehandlung, der Stil und die gattungsspezifische Einordnung der Novelle.
Welche Aspekte der Erzähltechnik werden untersucht?
Die Analyse befasst sich detailliert mit dem Wechsel zwischen epischen und dialogischen Abschnitten, der Zeitgestaltung (Zeitraffung, Zeitdehnung, Vorgriffe, Rückblenden), der Erzählperspektive (auktorialer Erzähler, anonyme Zeugen) und dem Erzählerstil.
Wie wird der Stil der Novelle beschrieben?
Der Stil der Novelle wird anhand verschiedener Aspekte analysiert, darunter der "Gipfelstil", der "unterirdische Erzählfluss" und eine filmische Erzählweise. Die Verwendung von Enthüllungen und Verrätselungen sowie die sprachliche Gestaltung werden ebenfalls thematisiert.
Welche Gattungen werden im Zusammenhang mit der Novelle diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene mögliche gattungsspezifische Einordnungen der Novelle, darunter „Eine unerhörte Begebenheit“, Kriminalgeschichte, Seelendrama und die Entwicklung eines Mörders. Die Analyse untersucht die Aspekte, die auf diese verschiedenen Gattungen hinweisen und diskutiert die Vielschichtigkeit der Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Handlung, dem Wechsel zwischen epischen und dialogischen Abschnitten, der Zeitbehandlung, der Einstellung des Erzählers zum Erzählten, dem Stil und der Gattung der Novelle.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des narrativen Aufbaus und der literarischen Gestaltung von „Die Judenbuche“ zu entwickeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Judenbuche, Annette von Droste-Hülshoff, Erzählhaltung, Erzählstruktur, Erzählperspektive, Zeitbehandlung, Stil, Gattung, Kriminalgeschichte, Seelendrama, Entwicklung eines Mörders, auktorialer Erzähler, epische und dialogische Abschnitte.
Wie wird die Handlung der Novelle zusammengefasst?
Die Handlung beschreibt das Leben des Protagonisten Friedrich Mergel von Geburt bis Tod. Sie schildert seine schwierige Kindheit, sein Verhältnis zu seinem Umfeld und seinen absteigenden moralischen Werdegang, der ihn zum Außenseiter und schließlich zur Beteiligung an einem Mord führt. Seine Flucht und sein tragischer Selbstmord nach Jahren der Sklaverei bilden den Schluss.
- Quote paper
- Heimir Steinarsson (Author), 2004, Erzählhaltung, Erzählstruktur und Erzählperspektive in der Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42134