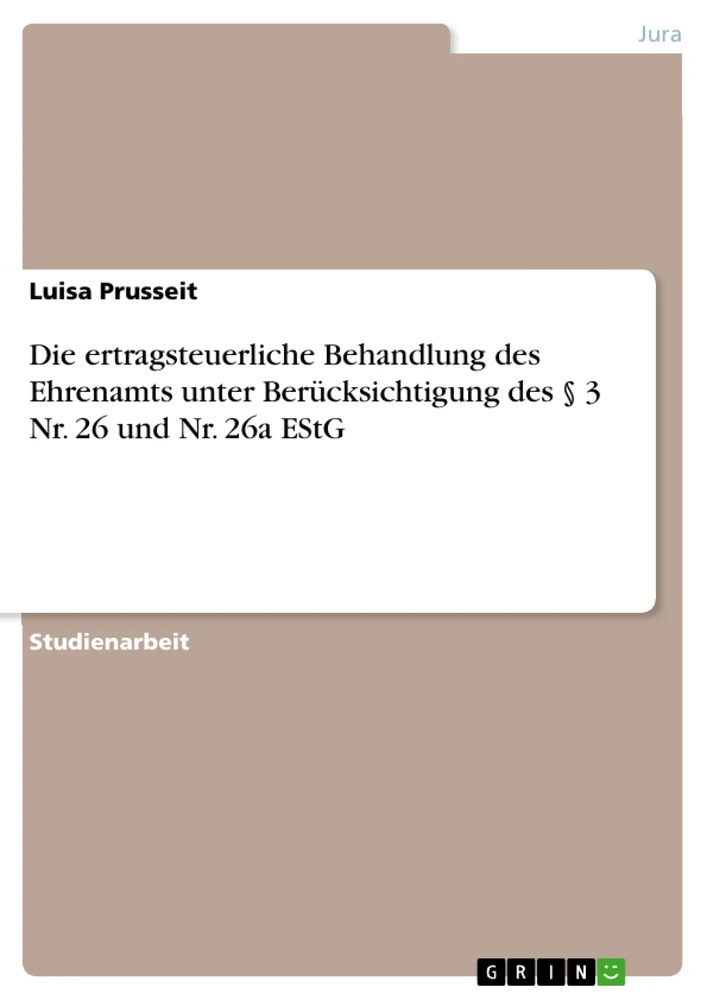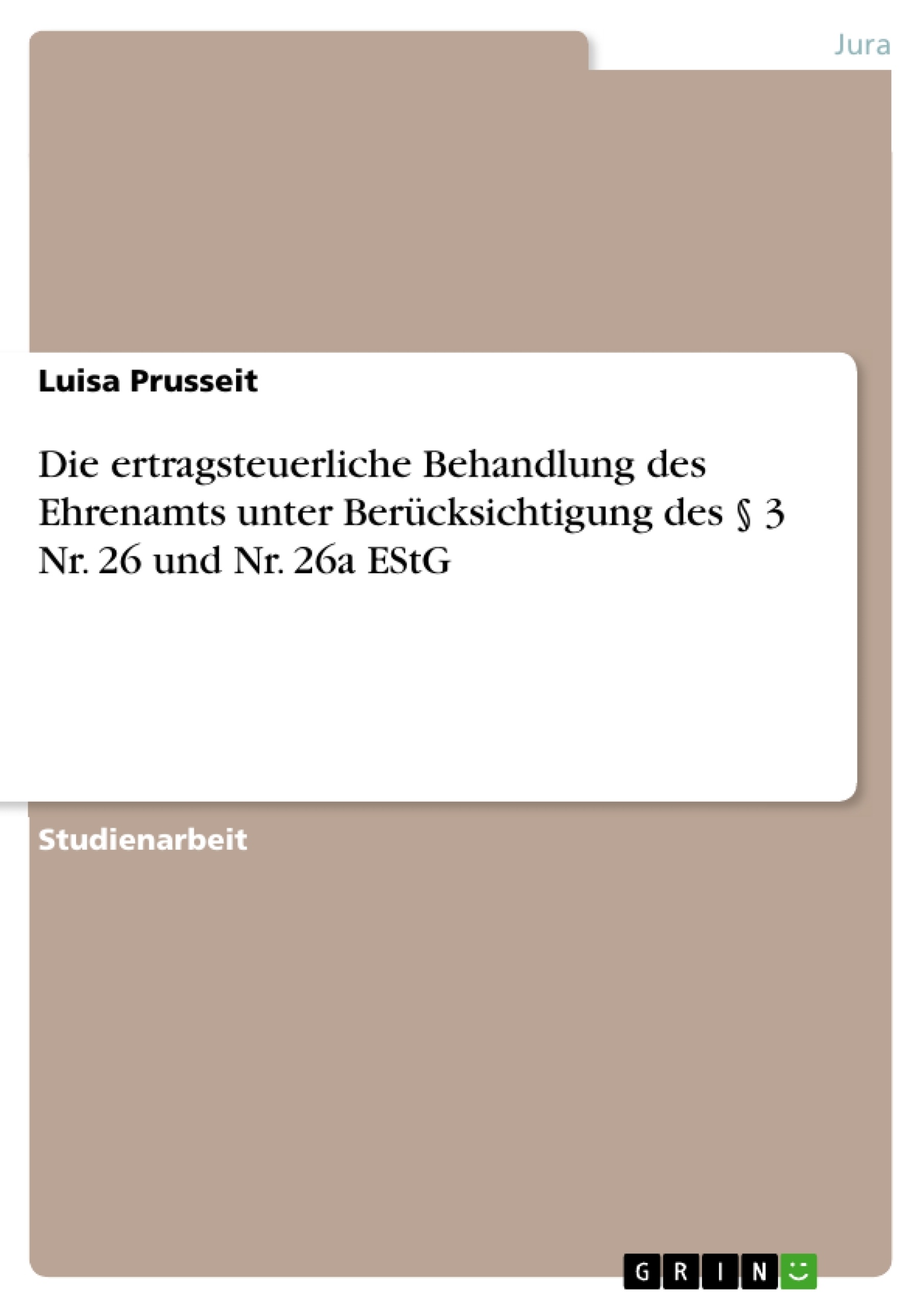In dieser Hausarbeit geht es um die ertragssteuerliche Behandlung des Ehrenamts. Welche Tätigkeiten sind steuerfrei? Wie hoch sind die begünstigten Freibeträge? Ab wann müssen die Einnahmen versteuert werden? Und was ist überhaupt das Ehrenamt? Diese und noch mehr Fragen werden hier erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Bedeutung der Vorschrift
- Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG
- Allgemeines
- Begünstigte Tätigkeiten
- Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher und Vergleichbare
- Pflege
- Künstlerische Tätigkeit
- Gemischte Tätigkeit
- Nebenberuflichkeit
- Begünstigte Auftraggeber
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Einrichtungen i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
- Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
- Höhe der Befreiung
- Höchstbetrag
- Abzug von Betriebsausgaben / Werbungskosten
- Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a EStG
- Gemeinsamkeiten / Unterschiede zu § 3 Nr. 26 EStG
- Höhe der Befreiung
- Höchstbetrag
- Abzug von Betriebsausgaben / Werbungskosten
- Ehrenamtlicher Vorstand
- Ehrenamtsstärkungsgesetz
- Auswirkungen im Vereinsrecht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der ertragsteuerlichen Behandlung des Ehrenamtes unter Berücksichtigung der §§ 3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die relevanten steuerlichen Regelungen zu geben und deren Anwendung in der Praxis zu beleuchten.
- Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft und den Einzelnen
- Steuerliche Behandlung von Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der §§ 3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG
- Auswirkungen des Ehrenamtsstärkungsgesetzes auf das Vereinsrecht
- Relevanz der steuerlichen Freistellungen für die Motivation von Ehrenamtlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Bedeutung der Vorschrift
Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung des Ehrenamtes in Deutschland und die Notwendigkeit einer steuerlichen Förderung durch die §§ 3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG. Es werden die Vorteile der Freistellung sowohl für die Steuerverwaltung als auch für die Steuerpflichtigen aufgezeigt.
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG
Dieses Kapitel beleuchtet die steuerliche Befreiung nach § 3 Nr. 26 EStG. Es werden die Voraussetzungen für die Anwendung der Regelung, insbesondere die begünstigten Tätigkeiten, die Nebenberuflichkeit und die Begünstigten Auftraggeber, sowie die Höhe der Befreiung und die Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben und Werbungskosten dargestellt.
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a EStG
Dieses Kapitel erläutert die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a EStG. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu § 3 Nr. 26 EStG, sowie die Höhe der Befreiung und die Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben und Werbungskosten betrachtet.
Ehrenamtlicher Vorstand
Dieses Kapitel analysiert die steuerliche Behandlung von ehrenamtlichen Vorständen und deren Einkünfte.
Ehrenamtsstärkungsgesetz
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Ehrenamtsstärkungsgesetz und seinen Auswirkungen auf die Steuerbefreiung für ehrenamtliche Tätigkeiten.
Auswirkungen im Vereinsrecht
Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Steuerbefreiungen auf das Vereinsrecht und die Bedeutung des Ehrenamtes für den Fortbestand von Vereinen und Organisationen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind: Ehrenamt, Steuerbefreiung, § 3 Nr. 26 EStG, § 3 Nr. 26a EStG, Nebenberuflichkeit, Begünstigte Tätigkeiten, Gemeinnützigkeit, Ehrenamtlicher Vorstand, Ehrenamtsstärkungsgesetz, Vereinsrecht.
- Arbeit zitieren
- Luisa Prusseit (Autor:in), 2016, Die ertragsteuerliche Behandlung des Ehrenamts unter Berücksichtigung des § 3 Nr. 26 und Nr. 26a EStG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421581