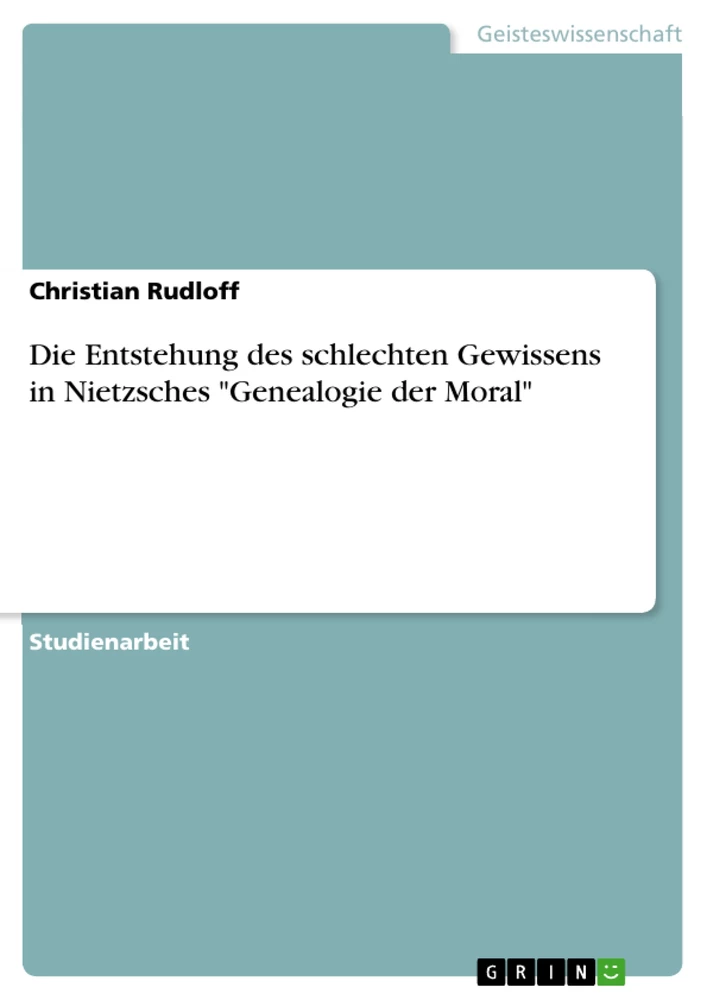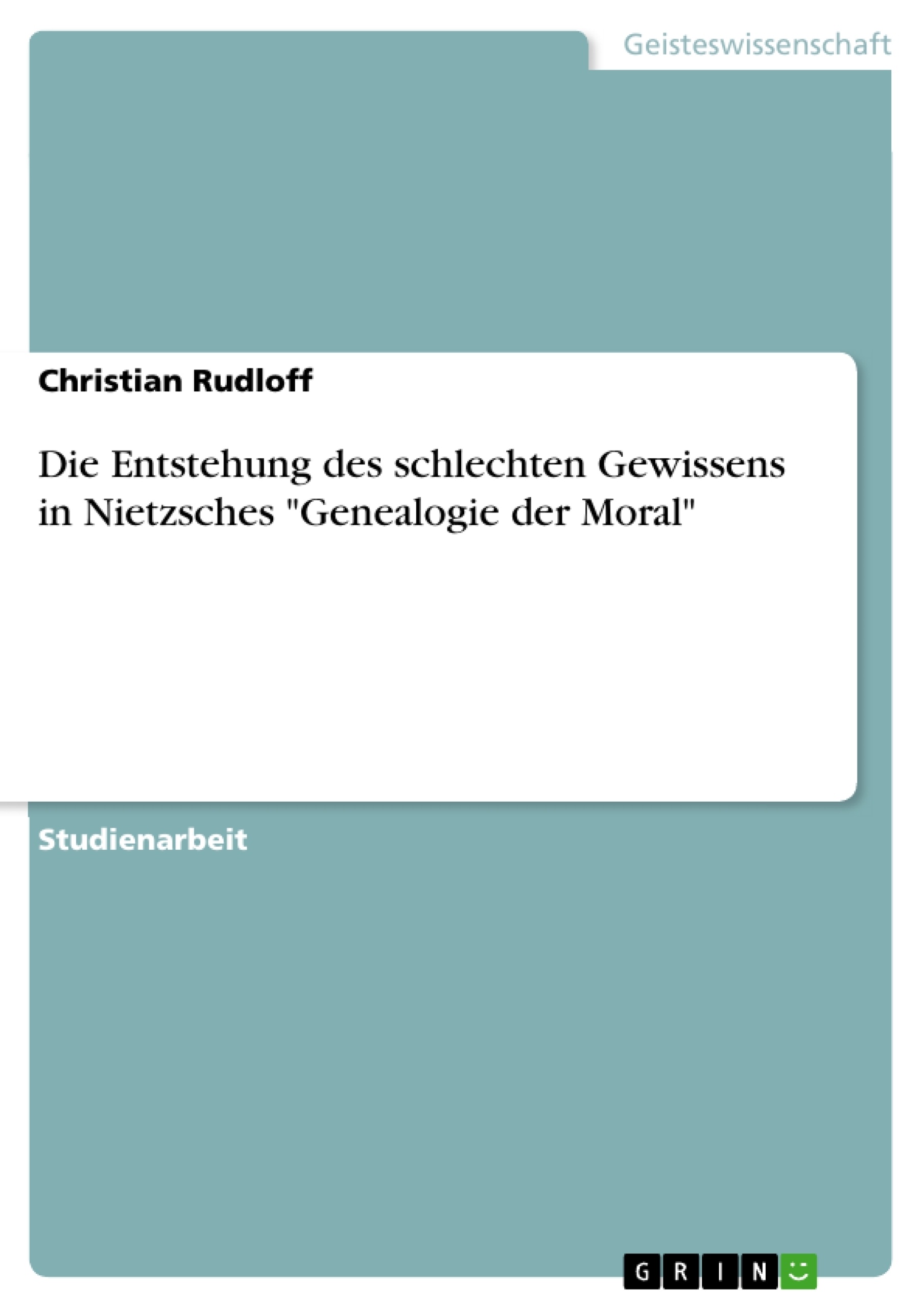Das Ziel meiner Arbeit ist die Herleitung des schlechten Gewissens aus der zweiten Abhandlung „Schuld, schlechtes Gewissen und Verwandtes“. Diese umfasst nach einem einleitenden Teil, in dem Nietzsche die Möglichkeit eines guten Gewissens durch ein “souveraines Individuum“ darlegt (Abschnitt 1-3), einen ausführlichen Teil über die Herleitung des schlechten Gewissens (Abschnitt 4-21) sowie einen Schlussteil, in dem er die Möglichkeit eines vom schlechten Gewissen befreiten Menschens aufzeigt.
Ich werde die Entwicklung des Gewissens zum schlechten Gewissen verfolgen und die Umstände darlegen, die dazu führten. Dazu werde ich mich entlang der einzelnen Abschnitte bewegen, ohne Sekundärliteratur mit einzubeziehen. Eine Herleitung direkt aus dem Text scheint mir das sinnvollste zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Vergessen und Versprechen
- 2.2 Das Gewissen
- 2.3 Die Strafe
- 2.3.1 Ursprünglicher Zweck der Strafe
- 2.3.2 Gläubiger und Schuldner
- 2.3.3 Recht und Gemeinschaft
- 2.3.4 Gerechtigkeit
- 2.3.5 Schlussfolgerungen über die Strafe
- 2.4 Die Herkunft des schlechten Gewissens
- 2.4.1 Das schlechte Gewissen als Krankheit
- 2.4.2 Die Ursache in der Gesellschaft
- 2.4.3 Die Schuld gegenüber Gott
- 2.4.4 Synthese von Schuld und schlechtem Gewissen
- 3 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entstehung des schlechten Gewissens in Nietzsches „Genealogie der Moral“, insbesondere in der zweiten Abhandlung „Schuld, schlechtes Gewissen und Verwandtes“. Sie verfolgt die Entwicklung des Gewissens zum schlechten Gewissen und beleuchtet die Umstände, die zu dieser Transformation führten.
- Die Rolle des Vergessens und des Versprechens für die Entwicklung des Gewissens
- Die Funktion der Strafe und ihre Auswirkungen auf die Entstehung des schlechten Gewissens
- Die Unterscheidung zwischen aktivem und reaktivem Menschen und ihre Gewissensphilosophie
- Die Entwicklung des schlechten Gewissens als Krankheit und die Ursachen dafür in der Gesellschaft
- Die Bedeutung der Schuld gegenüber Gott und die Synthese von Schuld und schlechtem Gewissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Herangehensweise. Sie legt dar, dass sich die Analyse auf die zweite Abhandlung Nietzsches „Genealogie der Moral“ konzentriert, wobei insbesondere der Abschnitt zur Herleitung des schlechten Gewissens im Vordergrund steht. Die Einleitung stellt die Bedeutung des Gewissens für die Entwicklung des Menschen in den Vordergrund.
Der Hauptteil beginnt mit der Erörterung von Vergessen und Versprechen als zwei fundamentalen menschlichen Fähigkeiten. Nietzsche argumentiert, dass Vergessen notwendig ist für die geistige Gesundheit und die Handlungsfähigkeit des Menschen, während Versprechen als Grundlage für Verantwortlichkeit und Schuld gegenüber anderen verstanden wird. Aus der Verinnerlichung dieser Verantwortlichkeit entsteht das Gewissen.
Im folgenden Abschnitt wird die Strafe in den Blick genommen. Nietzsche widerlegt die verbreitete Moralpsychologische Sichtweise, die Strafe als Abschreckung betrachtet. Er argumentiert, dass Strafe ursprünglich der Bestrafung eines Schuldners durch einen Gläubiger diente und erst im Laufe der Geschichte ihren Sinn wandelte.
Abschliessend untersucht die Arbeit die Entstehung des schlechten Gewissens aus der Sicht Nietzsches. Der Mensch wird als „krank“ betrachtet, er leidet unter der Last der Schuld. Diese Last resultiert aus der Verinnerlichung sozialer Zwänge, die das Gewissen belasten. Der letzte Abschnitt analysiert die Schuld gegenüber Gott und die Synthese von Schuld und schlechtem Gewissen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe: schlechtes Gewissen, Schuld, Verantwortung, Strafe, Vergessen, Versprechen, aktiver und reaktiver Mensch, Gesellschaft, Gott. Die zentrale Forschungsfrage ist die Entstehung des schlechten Gewissens in der Philosophie Nietzsches.
- Quote paper
- Christian Rudloff (Author), 2008, Die Entstehung des schlechten Gewissens in Nietzsches "Genealogie der Moral", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421586