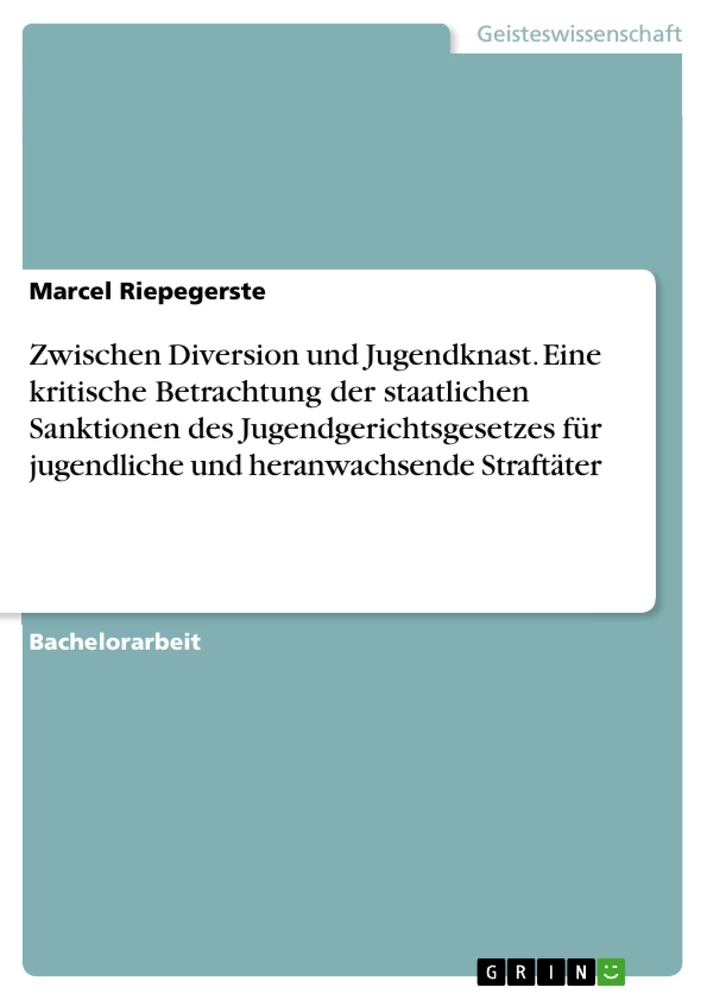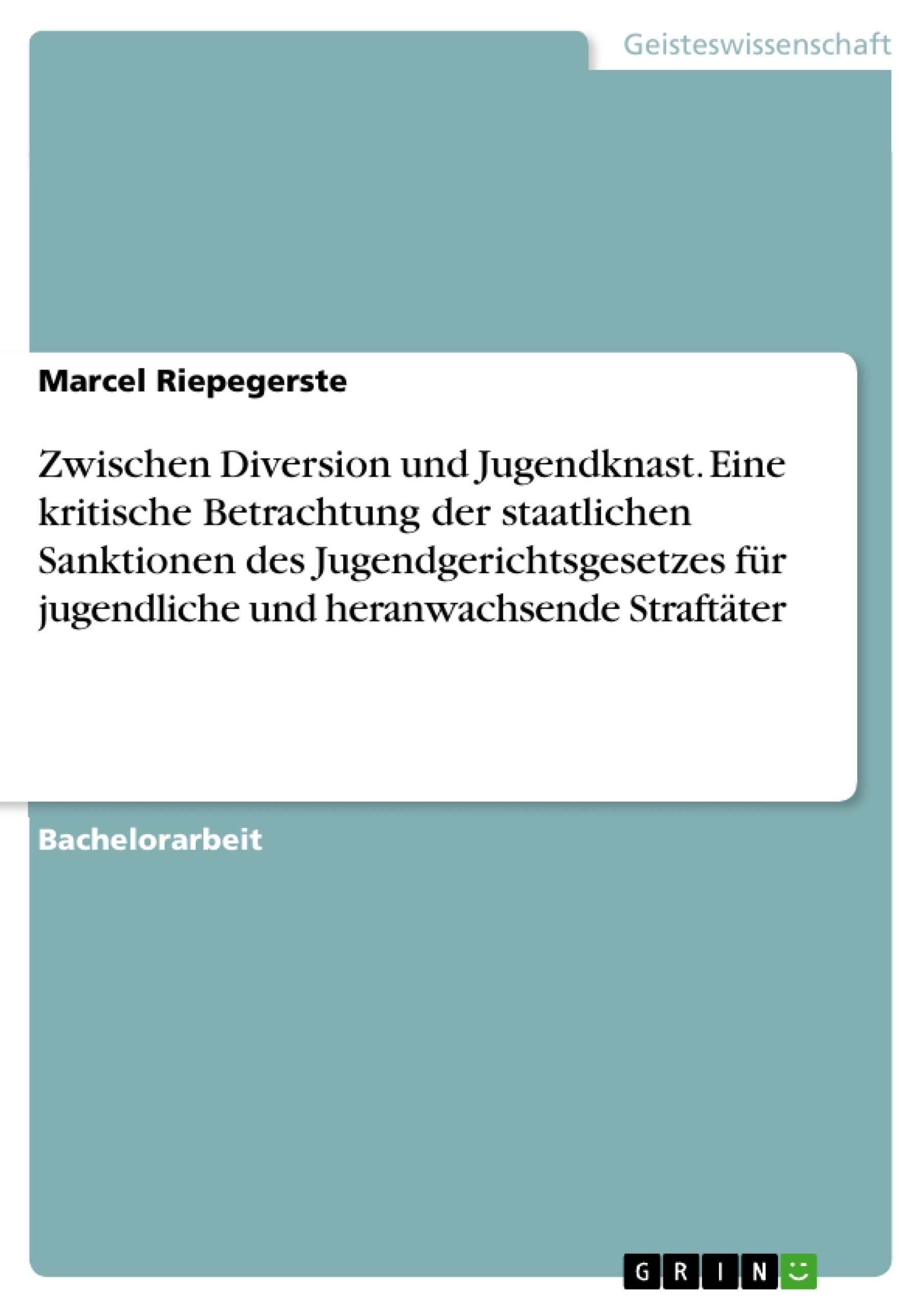Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, herauszufinden, wie geeignet die unterschiedlichen Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes sind, um eine erneute Straffälligkeit von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern zu vermeiden.
Dazu wurden im Kernteil der Arbeit verschiedene nationale und internationale Erkenntnisse der empirischen Sanktionsforschung exemplarisch zusammengetragen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Forschungsstand große Defizite aufweist, wobei die Forschungsfrage auf Grund einer Forschungsdesign-Problematik nicht beantwortet werden konnte, da hierzu Experimente notwendig wären, die juristisch und ethisch nicht vertretbar sind. So war nur eine Annäherung an die Fragestellung möglich.
Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass bei leichter und mittelschwerer Kriminalität von einer Austauschbarkeit der Sanktionen ausgegangen werden kann und keine bessere Wirkung von eingriffsintensiveren gegenüber weniger drastischen Sanktionen nachgewiesen werden konnte. Deshalb sollten diese unter dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Erst- und Gelegenheitstätern vorrangig genutzt werden. Für die vergleichsweise kleine Gruppe der Intensivtäter erfahren jedoch auch die „härteren“ Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes ihre Begründung. Die Bachelorarbeit ist sowohl für Studierende der Sozialen Arbeit und der Rechtswissenschaften als auch für alle Praktiker interessant, die in ihrer Arbeit Berührungspunkte mit Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht haben, vor allem solche, die selbst an der Urteilsfindung in Jugendstrafprozessen beteiligt sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen Jugendkriminalität
- 2.1. Lebensphase Jugend
- 2.2. Abweichendes Verhalten, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter
- 2.3. Empirische Befunde in Deutschland
- 2.3.1. Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
- 2.3.2. Ergebnisse der Strafverfolgungsstatistik (SVS)
- 2.3.3. Zusammenfassung der Befunde
- 3. Einführung in das Jugendgerichtsgesetz
- 3.1. Historische Entwicklung
- 3.2. Anwendungsbereich
- 3.3. Zielsetzungen und Unterschiede zum Erwachsenenstrafrecht
- 3.4. Inhalte
- 4. Die Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes
- 4.1. Diversion
- 4.1.1. Diversion durch die Staatsanwaltschaft
- 4.1.2. Diversion durch den Jugendrichter
- 4.2. Erziehungsmaßregeln
- 4.2.1. Erteilung von Weisungen
- 4.2.2. Anordnung Hilfe zur Erziehung in Anspruch zu nehmen
- 4.3. Zuchtmittel
- 4.3.1. Verwarnung
- 4.3.2. Erteilung von Auflagen
- 4.3.3. Jugendarrest
- 4.4. Jugendstrafe
- 5. Erkenntnisse der empirischen Sanktionsforschung
- 5.1. Was ist empirische Sanktionsforschung?
- 5.2. Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen
- 5.3. Experimentelle und Quasi-experimentelle Studien
- 5.3.1. Evaluation informeller Sanktionen
- 5.3.2. Evaluation formeller Sanktionen
- 5.4. Internationale Forschungsergebnisse
- 5.4.1. Evaluation informeller Sanktionen
- 5.4.2. Evaluation formeller Sanktionen
- 6. Alternative Möglichkeiten
- 6.1. Entkriminalisierung bestimmter Straftatbestände
- 6.2. Anwendung des § 171 StGB
- 6.3. Täter-Opfer-Ausgleich
- 6.4. „Teen Courts“ - Schülergerichte
- 6.5. Projekt „Gelbe Karte“ und Diversionstage
- 6.6. Häuser des Jugendrechts
- 6.7. Jugendstrafvollzug in freien Formen
- 7. Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Wirksamkeit der Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes in Bezug auf die Vermeidung erneuter Straftaten bei jugendlichen und heranwachsenden Straftätern. Sie beleuchtet den Forschungsstand der empirischen Sanktionsforschung, betrachtet alternative Möglichkeiten zur Strafverfolgung und diskutiert die Relevanz für die Soziale Arbeit.
- Wirksamkeit der Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes
- Empirische Befunde zur Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen
- Alternative Sanktionsformen und deren Auswirkungen
- Relevanz der Thematik für die Soziale Arbeit
- Vergleich von formellen und informellen Sanktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Phänomen Jugendkriminalität, beleuchtet die Lebensphase Jugend und die Ursachen für delinquentes Verhalten. Im Anschluss wird eine Einführung in das Jugendgerichtsgesetz gegeben, einschließlich seiner historischen Entwicklung, seines Anwendungsbereichs, seiner Zielsetzungen und Unterschiede zum Erwachsenenstrafrecht. Die zentralen Sanktionierungsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes, wie Diversion und Erziehungsmaßregeln, werden im Detail analysiert. Anschließend werden die Erkenntnisse der empirischen Sanktionsforschung vorgestellt, mit einem Schwerpunkt auf der Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Experimentelle und Quasi-experimentelle Studien sowie internationale Forschungsergebnisse werden beleuchtet. Die Arbeit untersucht alternative Möglichkeiten zur Strafverfolgung, wie Entkriminalisierung, Täter-Opfer-Ausgleich und „Teen Courts“. Schließlich wird die Bedeutung der Thematik für die Soziale Arbeit erörtert und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Jugendkriminalität, Jugendstrafrecht, Jugendgerichtsgesetz, empirische Sanktionsforschung, Legalbewährung und Soziale Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Marcel Riepegerste (Autor:in), 2018, Zwischen Diversion und Jugendknast. Eine kritische Betrachtung der staatlichen Sanktionen des Jugendgerichtsgesetzes für jugendliche und heranwachsende Straftäter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421591