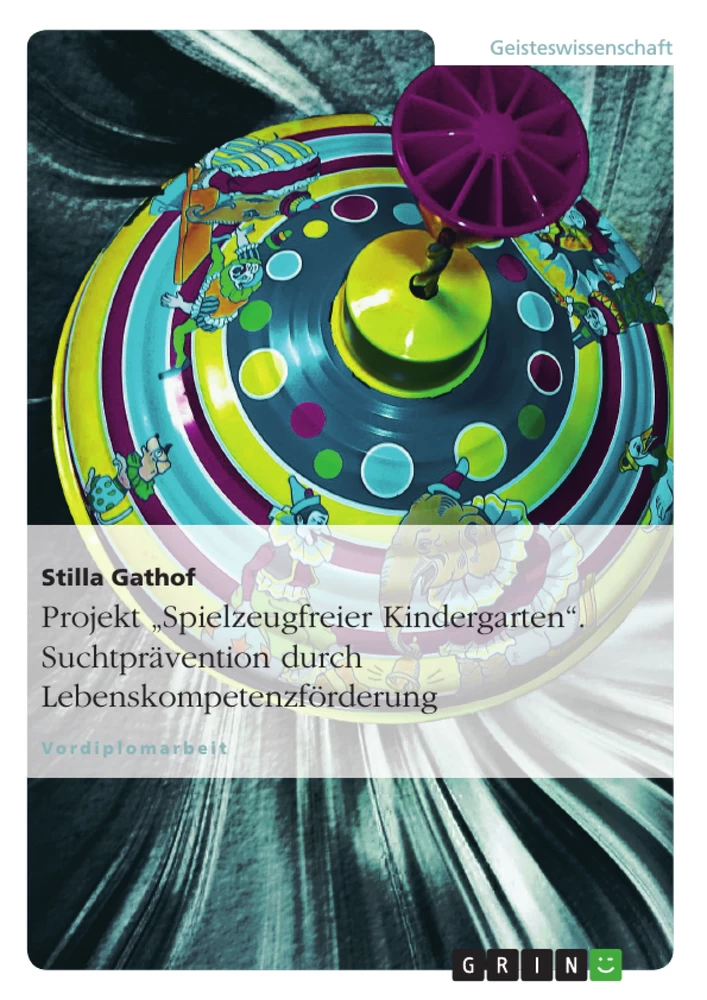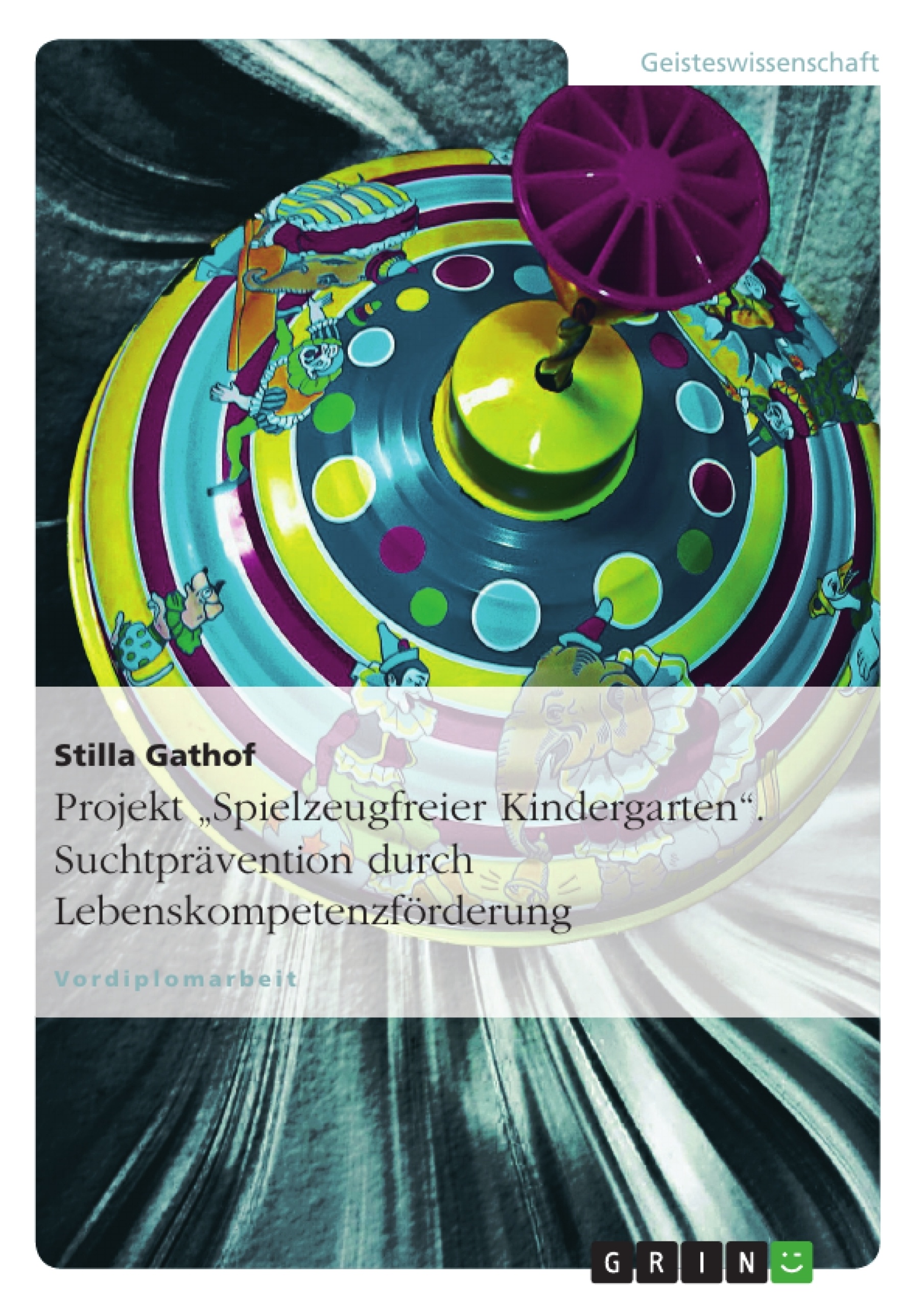Meine langjährigen Erfahrungen als Erzieherin im Arbeitsfeld Kindertagesstätten vermitteln mir den Eindruck, dass Konsum- und Suchtverhalten eng miteinander verknüpft sind. Auch im privaten Bereich mit zwei eigenen jugendlichen Kindern, deren Freundeskreis und darüber hinaus auch mit Kindern von Freunden im entsprechenden Alter setze ich mich fortwährend mit dieser Thematik auseinander.
Für mich stellen sich die Fragen:
- Wo liegen die Ursachen für Suchtverhalten und Abhängigkeit?
- Was bedeutet Suchtprävention konkret?
- Was kann Suchtprävention bewirken?
Dies wiederum führte zu der Frage:
- Wie können innovative Suchtprojekte aussehen, dass sie Kinder und Jugendliche ansprechen und wirksam sind?
In der Auseinandersetzung mit dieser Thematik stieß ich unter anderem auf das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ und führte dieses inzwischen zum wiederholten Male durch. In der vorliegenden Arbeit stelle ich einerseits meine persönlichen Erfahrungen dar, andererseits beantworte ich die oben genannte Ausgangsfrage. In der Einleitung der Arbeit gebe ich anhand einer Statistik einen Überblick über den aktuellen Konsum und beschreibe und definiere die verschiedenen Begrifflichkeiten. Der Hauptteil beschreibt die Möglichkeiten der Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen, stellt verschiedene Projekte, Möglichkeiten und Zielfelder vor. Im Anschluss daran werden das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“, sowie die Ergebnisse einer Begleitstudie umfassend vorgestellt. Im Schlussteil reflektiere ich meine eigenen Erfahrungen mit dem Projekt, stelle Erkenntnisse dar, beantworte abschließend die Eingangsfrage des Theorieprojektes und gebe einen Ausblick.
Die vorliegende Arbeit will somit einen Überblick schaffen, inwieweit das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ eine Möglichkeit der Suchtprävention durch Förderung der Lebenskompetenzen bei Kindern im Kindergarten darstellt. Damit ich dem Anspruch eines Überblicks gerecht werden konnte, waren einige Einschränkungen notwendig. Die Beschreibungen und Definitionen, sowie die Vorstellungen der einzelnen Projekte zur Suchtprävention erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Auswahl der Literatur musste ich in erster Linie auf Publikationen der Jahre 1993 bis 1997 zurückgreifen, da es keine neueren speziell zu der Thematik „Spielzeugfreier Kindergarten gibt. Auch die Auswahl der Autoren war stark beschränkt, weil immer nur die gleichen Autoren zu dem Thema veröffentlicht haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Begriffserläuterungen, Inhalte und zugrunde liegende Theorien
- 2.1 Begriffsdefinition "Sucht"
- 2.2 Theorien zur Entstehung von Sucht
- 2.3 Begriffsdefinition "Prävention"
- 2.3.1 Primärprävention
- 2.3.2 Sekundärprävention/Tertiärprävention
- 2.4 Inhaltliche Beschreibung „Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen“
- 2.5 Begriffsdefinition „Lebenskompetenzen“
- 3.0 Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten"
- 3.1 Suchtprävention bei Kindern im Vorschulbereich
- 3.2 Entstehungsgeschichte des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 3.3 Inhalte des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 3.4 Ziele des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 3.5 Vorbereitung und Durchführung des Projektes Spielzeugfreier Kindergarten“
- 3.6 Auswertungen des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 4.0 Vergleichende Untersuchungen
- 4.1 Ergebnisse der Begleitstudie zum Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 4.2 Eigene Erfahrungen zum Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“
- 5.0 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ als mögliche Maßnahme zur Suchtprävention durch die Förderung von Lebenskompetenzen bei Kindergartenkindern. Sie analysiert die Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten, Suchtentwicklung und der Bedeutung frühkindlicher Prävention. Die Arbeit stützt sich auf eigene Erfahrungen und die Ergebnisse einer Begleitstudie.
- Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Suchtentwicklung bei Kindern
- Konzepte und Methoden der Suchtprävention im Vorschulbereich
- Das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten": Konzept, Durchführung und Ergebnisse
- Förderung von Lebenskompetenzen als Ansatz zur Suchtprävention
- Auswertung und Reflexion der eigenen Erfahrungen mit dem Projekt
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: „Phänomen Sucht“, Statistik, Konsequenzen Begründung der Fragestellung: Die Einleitung präsentiert erschreckende Statistiken zum Suchtverhalten in Deutschland, untermauert die Relevanz des Themas und führt zur Fragestellung nach der Wirksamkeit von innovativen Suchtpräventionsprojekten, insbesondere im Hinblick auf den frühen Einstieg in den Konsum von legalen Drogen. Die hohe gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitliche Belastung durch Sucht wird hervorgehoben, um die Notwendigkeit von präventiven Maßnahmen zu unterstreichen. Die Zahlen belegen die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.
2.0 Begriffserläuterungen, Inhalte und zugrunde liegende Theorien: Dieses Kapitel liefert eine fundierte Basis für das Verständnis des Themas. Es definiert "Sucht" und "Prävention" und erläutert verschiedene Theorien zur Entstehung von Sucht. Es differenziert zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention und beschreibt den speziellen Kontext von Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen. Der Abschnitt zu Lebenskompetenzen legt die theoretische Grundlage für die Wirksamkeit des "Spielzeugfreien Kindergartens" dar. Die Definitionen und Theorien dienen als fundierte Basis für die spätere Diskussion des Projektes.
3.0 Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten": Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten". Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte, die konkreten Inhalte und Ziele, die Vorbereitung und Durchführung sowie die Auswertung des Projekts. Es verbindet die theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 mit der praktischen Umsetzung und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Die Kapitelteile beschreiben detailliert die verschiedenen Aspekte des Projektes.
4.0 Vergleichende Untersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Begleitstudie zum Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" und integriert die persönlichen Erfahrungen der Autorin. Der Vergleich verschiedener Studien und Erkenntnisse soll die Ergebnisse des Projektes einordnen und vertiefen. Die Integration von eigener Erfahrung bietet eine wichtige Perspektive, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisnahen Beobachtungen verbindet.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Lebenskompetenzförderung, Kindergarten, Spielzeugfreier Kindergarten, Primärprävention, Konsumverhalten, Kinder, Jugendliche, Suchtforschung, Begleitstudie, frühe Intervention.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Spielzeugfreier Kindergarten": Suchtprävention durch Lebenskompetenzförderung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" als mögliche Maßnahme zur Suchtprävention bei Kindergartenkindern. Der Fokus liegt auf der Förderung von Lebenskompetenzen und dem Zusammenhang zwischen Konsumverhalten, Suchtentwicklung und frühkindlicher Prävention. Die Arbeit basiert auf eigenen Erfahrungen und den Ergebnissen einer Begleitstudie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Suchtentwicklung bei Kindern, Konzepte und Methoden der Suchtprävention im Vorschulbereich, das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" (Konzept, Durchführung, Ergebnisse), die Förderung von Lebenskompetenzen als Ansatz zur Suchtprävention und die Auswertung und Reflexion der eigenen Erfahrungen mit dem Projekt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffserläuterungen und Theorien, Beschreibung des Projekts "Spielzeugfreier Kindergarten", vergleichende Untersuchungen (inkl. Begleitstudie und eigener Erfahrungen) und Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick.
Wie wird Sucht definiert?
Das Dokument bietet eine detaillierte Definition von "Sucht" und erläutert verschiedene Theorien zur Entstehung von Sucht. Es wird auch zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterschieden.
Was ist das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten"?
Das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" ist ein innovativer Ansatz zur Suchtprävention. Die Arbeit beschreibt detailliert die Entstehungsgeschichte, Inhalte, Ziele, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Projekts. Es werden die konkreten Maßnahmen und die dahinterliegenden pädagogischen Konzepte erläutert.
Welche Ergebnisse liefert die Begleitstudie?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Begleitstudie zum Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten". Diese Ergebnisse werden analysiert und im Kontext der eigenen Erfahrungen der Autorin interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, zieht Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und mögliche Weiterentwicklungen des Projekts "Spielzeugfreier Kindergarten".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Suchtprävention, Lebenskompetenzförderung, Kindergarten, Spielzeugfreier Kindergarten, Primärprävention, Konsumverhalten, Kinder, Jugendliche, Suchtforschung, Begleitstudie, frühe Intervention.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Erziehung, Suchtprävention, Sozialpädagogik und für alle, die sich für die Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen interessieren. Sie liefert wertvolle Einblicke in ein innovatives Projekt und seine Auswirkungen.
- Quote paper
- Stilla Gathof (Author), 2004, Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten". Suchtprävention durch Lebenskompetenzförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42172