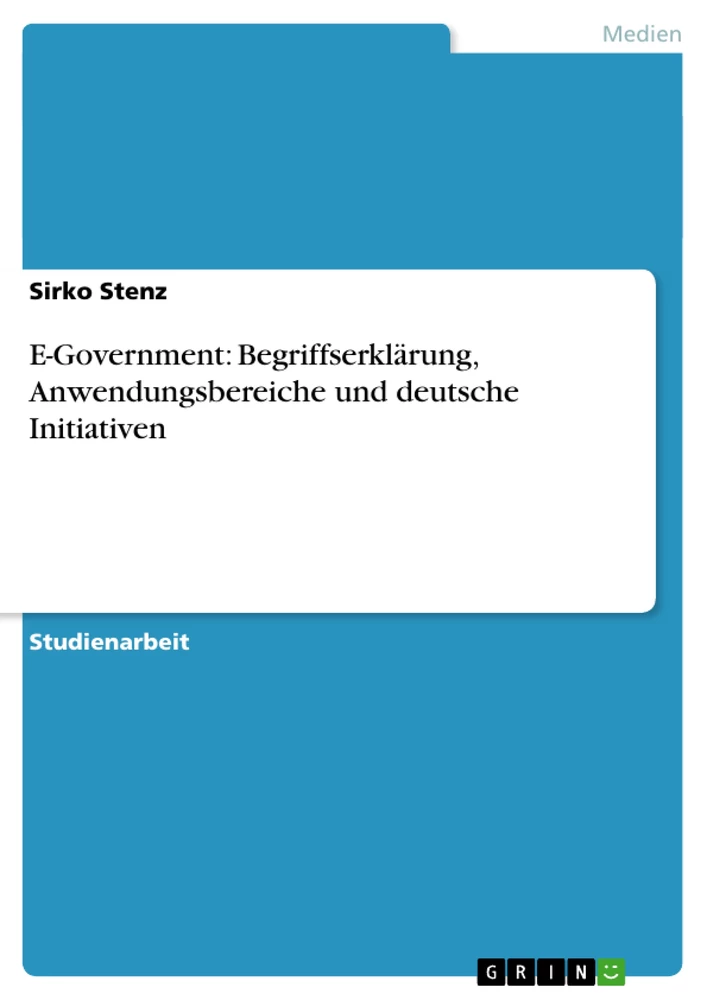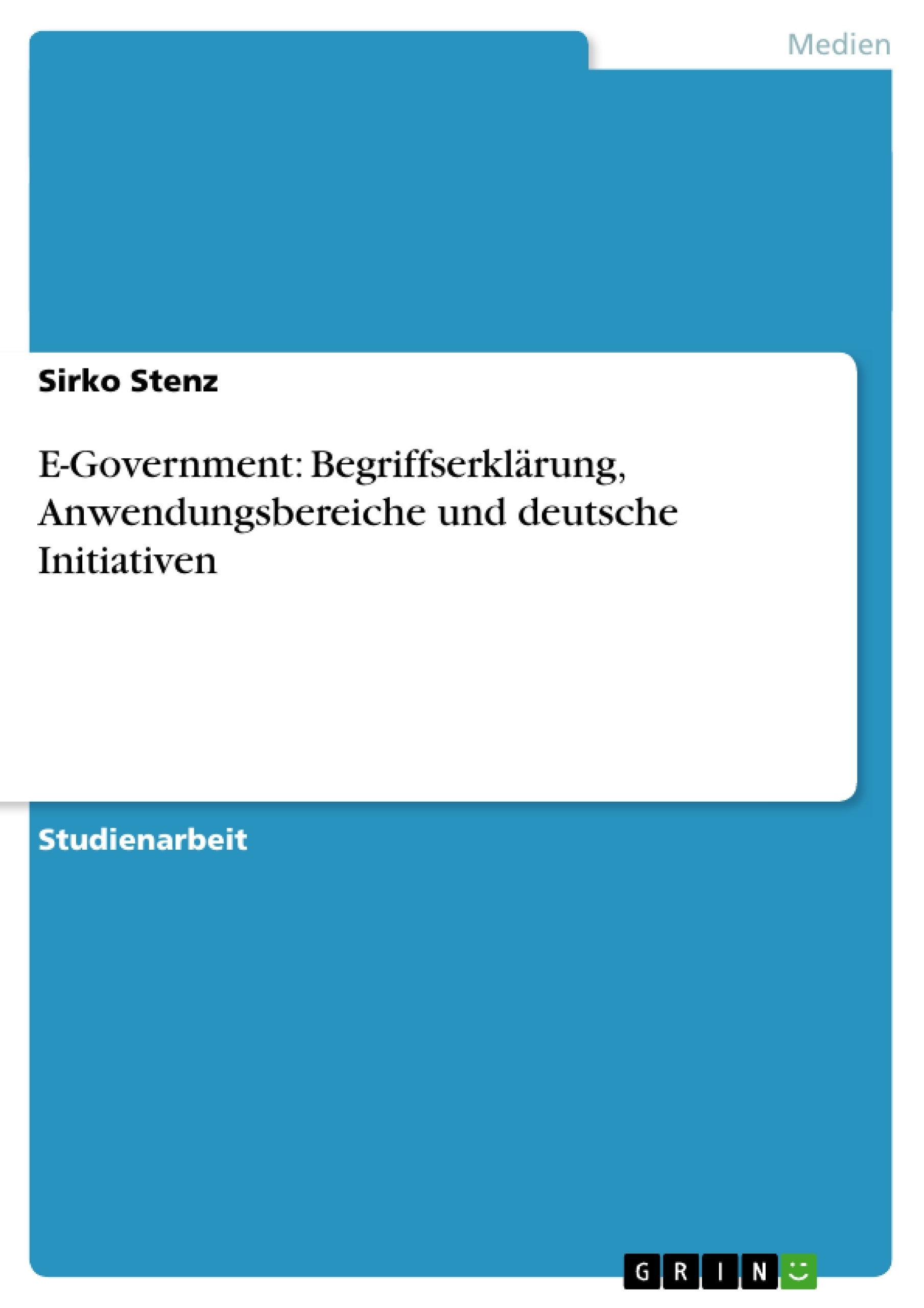Einleitung
Die Entwicklung des Internets und der Informationstechnik hat in nahezu allen Lebensbereichen zu Veränderungen geführt. Für viele Menschen sind Mobiltelefone, Computer und das WWW fester Bestandteil des Alltags geworden. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der Deutschen online. Online einkaufen, Informationen suchen oder Kontakte knüpfen ist für viele völlig normal geworden. Und jeder zweite deutsche Internetnutzer hat auch schon mal E-Government-Angebote in Anspruch genommen.
E-Government ist in den letzten Jahren ein häufig und kontrovers diskutiertes Thema. Bereits im September 2000 wurde die Initiative BundOnline 2005 gestartet, die sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, „alle onlinefähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung bis 2005 elektronisch verfügbar zu machen“. Dadurch soll mehr Bürgernähe geschaffen, Kosten gespart und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland gesteigert werden. Diese Dienstleistungen sollen z.B. Bürgern die behördlichen Angelegenheiten bei einem Umzug erleichtern. Einer Studie des Fraunhofer Institut Angewandte Informationstechnik zu Folge befindet sich Hamburg in punkto Bürgerorientierung kommunaler Internetdienstleistungen im unteren Drittel von 16 getesteten Städten. Hamburg stellt seinen neuen Bürgern zwar alle Informationen zur Abwicklung des Umzugs zur Verfügung, jedoch sind diese schlecht strukturiert und teilweise schwer auffindbar. Nach meinem Umzug in die Hansestadt Hamburg konnte ich persönliche Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. So habe ich die benötigten Informationen, wie z.B. Adresse und Öffnungszeiten des zuständigen Amtes und das Anmeldeformular schnell gefunden, war aber etwas enttäuscht, da ich trotz gründlicher Vorarbeit eine Stunde auf dem Amt warten musste. Meine Erwartungen an E-Government waren offensichtlich etwas hoch gesteckt. Eine Studie, die sich u. a. mit dem Thema Erwartungen der Bürger an E-Government beschäftigt, hat ergeben, dass ein Großteil der Bürger sich vor allem einen Nutzen im Service z.B. Zeitgewinn erhofft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist E-Government?
- Der Begriff E-Government
- Anwendungsbereiche
- E-Assistance
- E-Administration
- E-Democracy
- E-Procurement
- E-Organization
- E-Government in Deutschland
- Die Initiative Bund Online 2005
- Die nationale E-Government Strategie Deutschland-Online
- Stand der Entwicklung
- Deutschland im internationalen Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff E-Government, seine Anwendungsbereiche und den Stand der Entwicklung in Deutschland. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für E-Government zu schaffen und die deutschen Initiativen in diesem Bereich zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs E-Government
- Vielfältige Anwendungsbereiche von E-Government (G2C, G2B, G2G)
- Analyse der deutschen E-Government-Strategien und -Initiativen
- Bewertung des Fortschritts und der Herausforderungen im deutschen E-Government
- Einordnung Deutschlands im internationalen Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema E-Government ein und erläutert die wachsende Bedeutung des Internets und der Informationstechnologie im Alltag. Sie hebt die kontroverse Diskussion um E-Government hervor und benennt die Initiative BundOnline 2005 als ambitioniertes Ziel, alle onlinefähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung elektronisch verfügbar zu machen. Die Einleitung verweist auf persönliche Erfahrungen des Autors mit E-Government-Diensten und untersucht die Diskrepanz zwischen Erwartungen und Realität im Bezug auf Zeitersparnis und Effizienzsteigerung. Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit dar und skizziert den Aufbau.
Was ist E-Government?: Dieses Kapitel definiert den Begriff E-Government aus verschiedenen Perspektiven. Es werden unterschiedliche Definitionsansätze vorgestellt, darunter das „Memorandum Electronic Government“ mit seiner Betonung der Nutzung von Informationstechnik in der öffentlichen Willensbildung, Entscheidungsfindung und Leistungserstellung. Die Speyerer Definition wird eingeführt, die die Akteure und ihre Beziehungen (G2C, G2B, G2G) beschreibt. Schließlich wird die Unterscheidung zwischen regulierendem und partizipierendem E-Government nach Gisler und Spahni erläutert, wobei der Fokus auf dem partizipierenden E-Government liegt, da die internen Prozesse in Behörden bereits weitgehend durch moderne Technik abgewickelt werden.
E-Government in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich den deutschen Initiativen im Bereich E-Government. Es analysiert die Initiative Bund Online 2005 und die nationale E-Government-Strategie Deutschland-Online, bewertet den Stand der Entwicklung und diskutiert die Fortschritte, Herausforderungen und Potenziale. Der Fokus liegt auf der Analyse konkreter Projekte und Maßnahmen zur Förderung des elektronischen Regierungsverkehrs in Deutschland. Der aktuelle Stand der Entwicklung wird skizziert und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
E-Government, elektronische Verwaltung, Informationstechnologie, Deutschland-Online, BundOnline 2005, G2C, G2B, G2G, Bürgerorientierung, Online-Dienstleistungen, Informationsgesellschaft, Partizipation, Effizienzsteigerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "E-Government in Deutschland"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über E-Government in Deutschland. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition von E-Government, seinen Anwendungsbereichen (G2C, G2B, G2G), der Analyse deutscher E-Government-Strategien (BundOnline 2005, Deutschland-Online) und dem internationalen Vergleich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernthemen: Definition und Abgrenzung von E-Government, verschiedene Anwendungsbereiche (E-Assistance, E-Administration, E-Democracy, E-Procurement, E-Organization), Analyse der deutschen E-Government-Strategien (BundOnline 2005 und Deutschland-Online), Bewertung des Fortschritts und der Herausforderungen im deutschen E-Government, sowie der internationale Vergleich Deutschlands im Bereich E-Government.
Welche deutschen E-Government-Initiativen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Initiative "BundOnline 2005" und die nationale E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Es wird der Stand der Entwicklung bewertet und der Fortschritt, die Herausforderungen und Potenziale dieser Initiativen diskutiert.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für E-Government zu schaffen und die deutschen Initiativen in diesem Bereich zu beleuchten. Die Themenschwerpunkte liegen auf der Definition von E-Government, seinen vielfältigen Anwendungsbereichen (G2C, G2B, G2G), der Analyse deutscher E-Government-Strategien und -Initiativen, der Bewertung des Fortschritts und der Herausforderungen sowie der Einordnung Deutschlands im internationalen Vergleich.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfragen formuliert. Es folgen Kapitel zu der Definition von E-Government, E-Government in Deutschland und einem internationalen Vergleich. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Government, elektronische Verwaltung, Informationstechnologie, Deutschland-Online, BundOnline 2005, G2C, G2B, G2G, Bürgerorientierung, Online-Dienstleistungen, Informationsgesellschaft, Partizipation, Effizienzsteigerung.
Welche Arten von E-Government werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von E-Government, insbesondere die Interaktionen zwischen Regierung und Bürgern (G2C), Regierung und Unternehmen (G2B) und Regierung und anderen Regierungseinheiten (G2G). Zusätzlich wird die Unterscheidung zwischen regulierendem und partizipierendem E-Government erläutert.
Wie wird der internationale Vergleich in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beinhaltet ein Kapitel, das den Stand von E-Government in Deutschland im internationalen Kontext einordnet und vergleicht. Konkrete Vergleichsländer werden jedoch nicht im FAQ genannt.
- Quote paper
- Sirko Stenz (Author), 2005, E-Government: Begriffserklärung, Anwendungsbereiche und deutsche Initiativen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42173