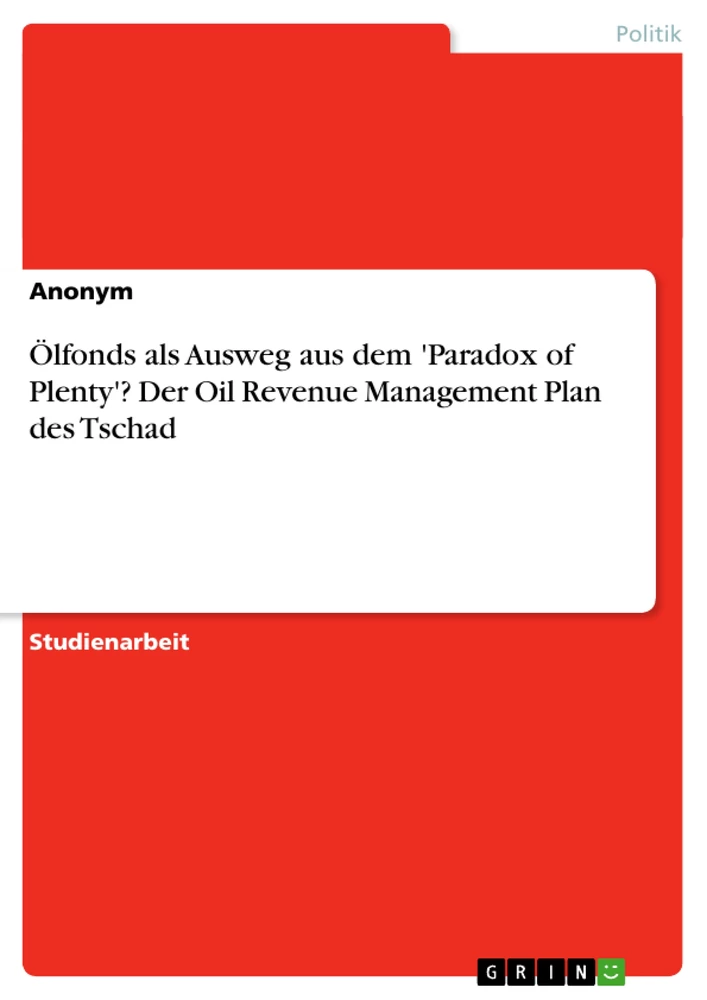Einleitung
Die Wechselbeziehung zwischen Ressourcenreichtum und gehemmter oder sogar negativer Entwicklung ist vor allem für Staaten mit schwachen Institutionen und fehlenden demokratischen Gesellschaftsstrukturen vielfach belegt worden. Dies gilt insbesondere für Entwicklungsländer, deren vornehmliche Ressource Öl ist.1 Darüber hinaus gehört die Mehrzahl der von Ölexporten besonders abhängigen Länder zu den aus politischer Sicht unstetigsten Staaten der Erde, die sich obendrein noch als besonders konfliktträchtig herauskristallisiert haben.2 Mit dem Beginn der industrialisierten Ölförderung in den Staaten am Golf von Guinea in den letzten zwei Jahrzehnten ist diese The matik wieder auf eine breite entwicklungspolitische Agenda gerückt. Von besonderer Brisanz ist hier der riesige Kapitalschub, der in den frischgebackenen Ölexportstaaten Afrikas auf zumeist weitgehend unfertige Strukturen moderner Staatlichkeit trifft.
Ein Lösungsansatz – unter vielen anderen - diesem „Ressourcenfluch“ entgegenzuwirken, ist der Aufbau von Ölfonds - finanzpolitische Institutionen, die neben einer makroökonomischen Stabilisierung eine sinnvolle und gerechte Verteilung der Ölgewinne ermöglichen sollen. Einen exemplarischen Länderfall stellt in diesem Zusammenhang der Tschad dar, ein Entwicklungsland der untersten Regionen einer jeden globalen Armuts- und Korruptionsstatistik, in dem seit Juli 2003 Öl exportiert wird. Von Besonderheit ist hier die harte Konditionierung von Seiten der Weltbank im Rahmen eines Fondskonzepts. In dieser Arbeit soll nach dem politischen Potential von Ölfonds zur Bekämpfung des Ressourcenfluchs gefragt werden und vor diesem Hintergrund eine Prognose auf seine Wirkmächtigkeit im Tschad abgegeben werden. Die wissenschaftliche Diskussion um Ölfonds wurde bis in die jüngste Zeit fast ausnahmslos von Ökonomen geführt. Diese sahen Ölfonds meist ausschließlich als finanzwirtschaftliches Instrument, das keinerlei politische Eigendynamik habe, sondern im Gegenteil eine effektive Haushaltspolitik sogar erschwere.3 Hier soll hingegen von einem institutionalistischen Ansatz ausgegangen werden, der - eingebettet in einen regimetheoretischen Zusammenhang - Institutionen wie Ölfonds eine gewisse Eigendynamik zuschreibt, die politische Strukturen aufbauen oder verändern kann...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ressourcenfluch - Dutch Disease und Rent Seeking
- Ölfonds - drei Konzepte
- Erprobte Ansätze ausgewählter Länder
- Alaska (USA) – ein strikt verwalteter Allokations- und Generationenfonds
- Norwegen – einer der weltweit erfolgreichsten Generationenfonds
- Venezuela - ein gescheiterter Fonds
- Ölfonds in Staaten des Persischen Golfs - Diskretion als Leitlinie
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Der Tschad - ein Ölfonds als Regime für nachhaltige Entwicklung?
- Die Ausgangslage
- Öl im Tschad
- Der Revenue Management Plan
- Die Umsetzung des RMP
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das politische Potenzial von Ölfonds zur Bekämpfung des Ressourcenfluchs. Sie analysiert die Rolle von Ölfonds als finanzpolitische Institutionen zur makroökonomischen Stabilisierung und gerechten Verteilung von Ölgewinnen. Der Fokus liegt auf dem Tschad, einem Entwicklungsland mit hohen Armuts- und Korruptionsraten, das seit 2003 Öl exportiert. Die Arbeit hinterfragt, ob ein Ölfonds als Regime für nachhaltige Entwicklung dienen kann und welche Auswirkungen er auf die politische Landschaft des Tschad haben kann.
- Die Auswirkungen des Ressourcenfluchs auf Entwicklungsländer
- Die Rolle von Ölfonds als Mittel zur Stabilisierung der Staatsfinanzen und zur Bekämpfung von Korruption
- Die Herausforderungen bei der Implementierung von Ölfonds in Entwicklungsländern
- Das politische Potenzial von Ölfonds als Instrument der Governance
- Die Fallstudie des Tschad und die Analyse des Oil Revenue Management Plans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Ressourcenfluchs und die Bedeutung von Ölfonds als möglicher Lösungsansatz vor. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Ressourcenfluchs, insbesondere die Dutch Disease und die Folgen des Rent Seeking, beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich verschiedenen Ölfonds-Konzepten und präsentiert erprobte Ansätze aus verschiedenen Ländern. Kapitel vier untersucht den Länderfall Tschad und analysiert den Oil Revenue Management Plan der Weltbank. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die das politische Potenzial von Ölfonds unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Fallstudie beurteilt.
Schlüsselwörter
Ressourcenfluch, Dutch Disease, Rent Seeking, Ölfonds, nachhaltige Entwicklung, politische Stabilität, Korruption, Governance, Tschad, Oil Revenue Management Plan, Weltbank, Regimetheorie, institutionalistische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Paradox of Plenty" (Ressourcenfluch)?
Das Paradoxon beschreibt das Phänomen, dass rohstoffreiche Länder (insbesondere Ölexportstaaten) oft ein geringeres Wirtschaftswachstum, schwächere demokratische Strukturen und höhere Korruptionsraten aufweisen als rohstoffarme Länder.
Was ist die "Dutch Disease"?
Die holländische Krankheit bezeichnet den wirtschaftlichen Effekt, bei dem ein Rohstoffboom zu einer Aufwertung der Landeswährung führt. Dies macht andere Exportsektoren (wie Industrie oder Landwirtschaft) international unwettbewerbsfähig und schadet der langfristigen Entwicklung.
Wie können Ölfonds gegen den Ressourcenfluch helfen?
Ölfonds dienen der makroökonomischen Stabilisierung und der gerechten Verteilung von Gewinnen. Sie können Einnahmen für zukünftige Generationen sparen (Generationenfonds) oder Schwankungen des Ölpreises im Staatshaushalt ausgleichen (Stabilisierungsfonds).
Was ist das Besondere am Oil Revenue Management Plan des Tschad?
Im Tschad wurde der Export von Öl durch die Weltbank an harte Bedingungen geknüpft. Es wurde ein Fondskonzept implementiert, das eine sinnvolle Verwendung der Einnahmen für Armutsbekämpfung sicherstellen sollte, was jedoch politisch vor großen Herausforderungen stand.
Welche Länder gelten als erfolgreiche Beispiele für Ölfonds?
Norwegen gilt mit seinem staatlichen Pensionsfonds als eines der weltweit erfolgreichsten Beispiele. Auch Alaska (USA) nutzt einen strikt verwalteten Allokations- und Generationenfonds erfolgreich zur Beteiligung der Bürger am Ressourcenreichtum.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Ölfonds als Ausweg aus dem 'Paradox of Plenty'? Der Oil Revenue Management Plan des Tschad, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42237