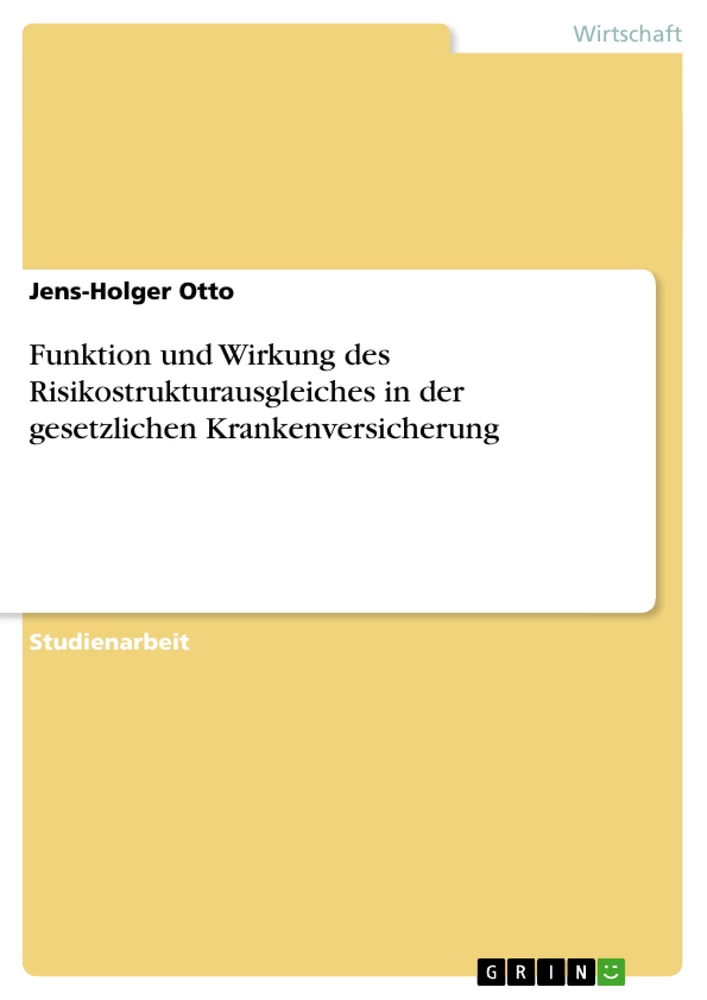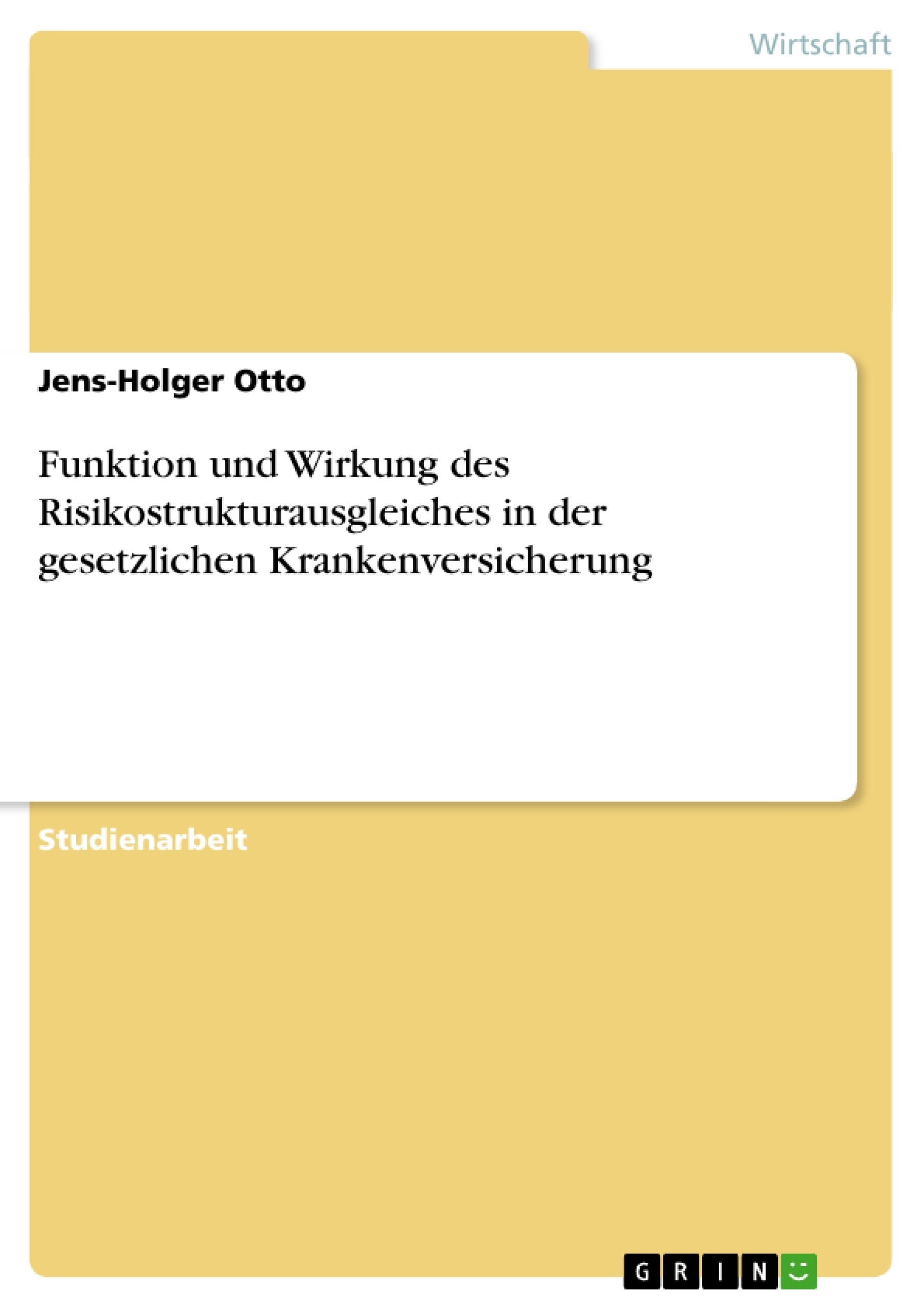Durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 (GSG) ist die Steuerungsfunktion des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erheblich intensiviert worden. In der Begründung des Entwurfes des Gesundheitsstrukturgesetzes heißt es:
„Das Gesundheitssystem in Deutschland steht auf hohem medizinischen Niveau. Gleichwohl gibt es erhebliche Strukturmängel und Fehlsteuerungen. Zunehmende Überkapazitäten und Unwirtschaftlichkeiten in einzelnen Leistungsbereichen, unzureichende Verzahnung der verschiedenen Versorgungsebenen, verzerrte Wettbewerbsbedingungen der Krankenkassen im gegliederten System und eine damit einhergehende Gefährdung des Solidaritätsprinzips, teilweise falsche Anreizstrukturen und mangelnde Effektivität haben eine Situation entstehen lassen, die im weiten Umfang gesetzgeberisches Handeln erfordert. “ „Die mitgliedschaftsrechtliche Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten in der GKV ist nur historisch erklärbar und vor dem Hintergrund teilweise sehr hoher Beitragssatzunterschiede – derzeit zwischen 8 % und 16 % - verfassungsrechtlich bedenklich. Die Einführung weitgehend freier und ungehinderter Kassenwahlrechte für alle Versicherungspflichtigen und Versicherungsberechtigten ist von daher unabdingbar. Dazu müssen aber zunächst die Finanzstrukturen der GKV neu geordnet werden. Zudem ist die Ausweitung der Kassenwahlmöglichkeiten eine notwendige, allein aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen im Interesse aller Versicherten funktionierenden, das Solidarprinzip wahrenden Wettbewerb in der GKV. Deshalb wird ein einnahmeorientierter bundesweiter Risikostrukturausgleich zwischen allen Krankenkassen und Kassenarten eingeführt, der die Faktoren beitragspflichtige Einnahmen, mitversicherte Familienangehörige sowie alters- und geschlechtsbedingte Belastungsfaktoren der Versicherten umfasst. “ „Dem Risikostrukturausgleich kommt dabei die zentrale Aufgabe einer solidarischen Verteilung der Risikobelastung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung zu. Die Erlangung von Beitragssatz- und Wettbewerbsvorteilen durch die Selektion günstiger Versichertenrisiken soll damit ausgeschlossen werden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass der Beitragssatz Ausdruck der jeweiligen Wirtschaftlichkeit einer Kasse und nicht Ergebnis einer mehr oder weniger erfolgreichen Auswahl risikogünstiger Versichertengruppen ist. “
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Funktion des RSA
- Hintergrund der Einführung des RSA
- Ziele des Risikostrukturausgleiches
- Die Ebenen des Ausgleichverfahrens
- Die Ausgleichsparameter
- Im RSA berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben
- Die Technik des Risikostrukturausgleiches
- Der Beitragsbedarf
- Ausgleichsbedarfssatz
- Finanzkraft
- Vergleich von Finanzkraft und Beitragsbedarf
- Der Risikopool
- Die Wirkung des Risikostrukturausgleichs
- Die abstrakte Wirkung der RSA-Zielfunktion
- Grenzen der RSA-Wirkung und seine Strategieanfälligkeit
- Die RSA-Wirkung in der Praxis
- Quellennachweis
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat analysiert die Funktion und Wirkung des Risikostrukturausgleiches (RSA) innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung des RSA und seiner Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen der Krankenkassen.
- Die Einführung und politische Zielsetzung des RSA im Kontext der GKV-Reform
- Die technischen Funktionsweisen und Mechanismen des RSA-Verfahrens
- Die theoretischen und praktischen Auswirkungen des RSA auf die Krankenkassen und Versicherten
- Die Grenzen und Herausforderungen des RSA im Hinblick auf seine Effektivität und Strategieanfälligkeit
- Die Rolle des RSA bei der Verteilung von Risiken und Ressourcen innerhalb der GKV
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einführung des Risikostrukturausgleiches (RSA) in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Kontext der GKV-Reform von 1992. Es analysiert die politischen Ziele und Beweggründe hinter der Einführung des RSA und stellt die zentrale Bedeutung des RSA im Hinblick auf die Gewährleistung eines funktionierenden Wettbewerbs im GKV-System dar.
Kapitel Zwei widmet sich der technischen Funktionsweise des RSA. Es werden die verschiedenen Ebenen des Ausgleichverfahrens erläutert, die Ausgleichsparameter definiert und die im RSA berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben beschrieben. Zudem wird die Technik des RSA anhand der Berechnung von Beitragsbedarf, Ausgleichsbedarfssatz und Finanzkraft detailliert dargestellt.
Im dritten Kapitel werden die Auswirkungen des RSA auf die GKV beleuchtet. Neben der abstrakten Betrachtung der RSA-Wirkung und seinen Grenzen wird auch die praktische Umsetzung des RSA analysiert und mit den tatsächlichen Gegebenheiten abgeglichen.
Schlüsselwörter
Risikostrukturausgleich, gesetzliche Krankenversicherung, GKV-Reform, Wettbewerb, Krankenkassen, Versicherte, Beitragssatz, Leistungsausgaben, Finanzkraft, Risikopool, Disease-Management-Programme, Strategieanfälligkeit, Solidaritätsprinzip, Wettbewerbsbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Aufgabe des Risikostrukturausgleiches (RSA)?
Der RSA soll die Risikobelastung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) solidarisch verteilen und verhindern, dass Krankenkassen Wettbewerbsvorteile durch die Selektion „günstiger“ Versicherter erzielen.
Welche Faktoren werden beim Risikostrukturausgleich berücksichtigt?
Zu den Ausgleichsparametern gehören die beitragspflichtigen Einnahmen, die Anzahl der mitversicherten Familienangehörigen sowie alters- und geschlechtsbedingte Belastungsfaktoren.
Warum wurde der RSA im Jahr 1992 eingeführt?
Er wurde im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) eingeführt, um bei freier Kassenwahl faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und das Solidarprinzip trotz hoher Beitragssatzunterschiede zu wahren.
Wie beeinflusst der RSA den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen?
Der RSA sorgt dafür, dass der Beitragssatz einer Kasse eher ihre Wirtschaftlichkeit widerspiegelt und nicht das Ergebnis einer erfolgreichen Auswahl risikoarmer Versichertengruppen ist.
Was sind die Grenzen und Herausforderungen des RSA?
Herausforderungen liegen in der Strategieanfälligkeit des Systems und der Frage, wie effektiv die tatsächlichen Leistungsausgaben und Krankheitsstrukturen abgebildet werden können.
Was versteht man unter dem Beitragsbedarf im RSA-Verfahren?
Der Beitragsbedarf ist eine technische Größe im RSA, die beschreibt, welche finanziellen Mittel eine Kasse benötigt, um die Leistungen für ihre spezifische Versichertenstruktur zu decken.
- Quote paper
- Dipl. Kfm. (FH) Jens-Holger Otto (Author), 2005, Funktion und Wirkung des Risikostrukturausgleiches in der gesetzlichen Krankenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42330