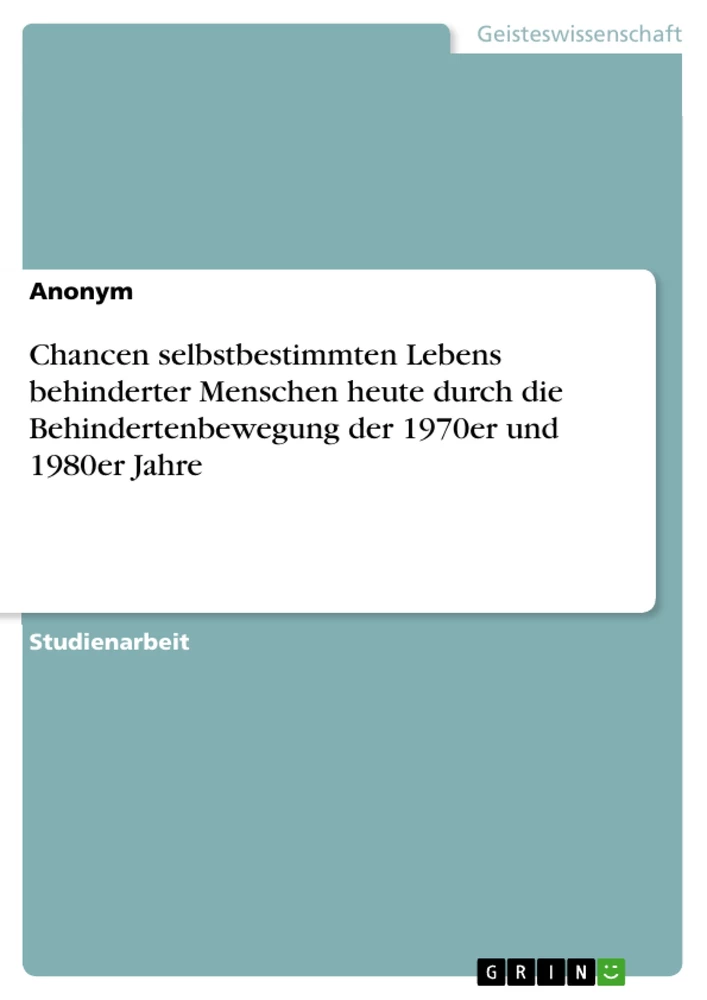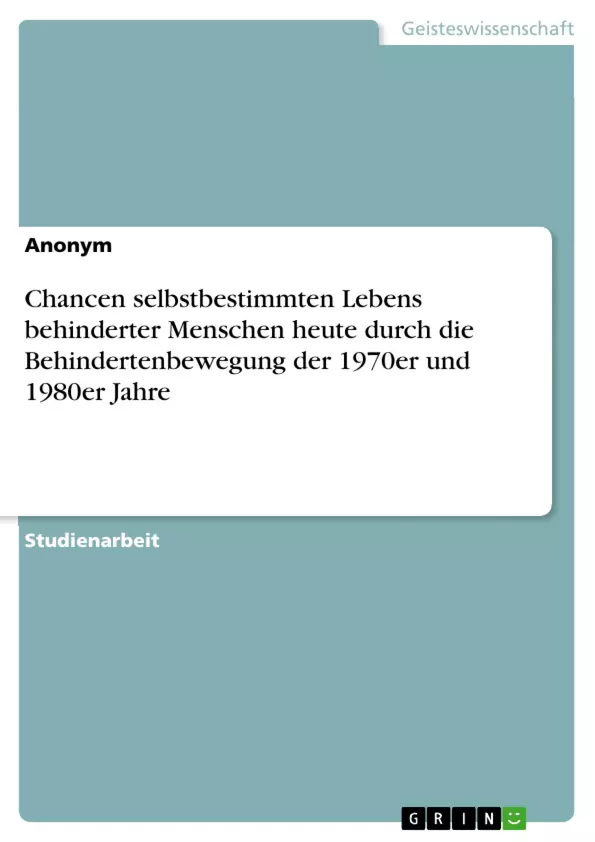Diese Arbeit wird sich mit den Auswirkungen der Behindertenbewegung auf die Chancen selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen in der heutigen Zeit auseinandersetzen.
Dafür werden zuerst der historische Kontext und schließlich die Ereignisse der 1970er und 1980er Jahre genau beschrieben, um ausreichend Wissen über die autonome Behindertenbewegung zu erlangen. Anschließend werden die verschiedenen Institutionen und Errungenschaften, die sich durch die Bewegung ergeben haben, vorgestellt. Danach wird die Situation behinderter Menschen heute in verschiedenen Bereichen des Lebens und deren Chancen der Selbstbestimmung beleuchtet, wonach ein Fazit über die Erkenntnisse die Arbeit abschließen wird. Nachdem sich die Situation behinderter Menschen bezüglich ihrer Selbstbestimmung in den letzten Jahren rapide verändert hat und noch keine aktuelle Fachliteratur dazu vorliegt, bezieht sich die Arbeit hierbei vor allem auf Internetressourcen.
Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung sind weit verbreitete Themen in der Behindertenpädagogik, aber auch in öffentlichen Debatten. Fachkräfte, Angehörige und PolitikerInnen versuchen dies in vielen Bereichen des Lebens umzusetzen und Barrieren zu entfernen.
Noch vor einigen Jahren wurden behinderte Menschen in Sondereinrichtungen abgetrennt vom Rest der Gesellschaft untergebracht, wobei nicht an Inklusion und Integration behinderter Menschen gedacht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hatten behinderte und beeinträchtigte Menschen kein hohes Ansehen in der Gesellschaft.
1980 gingen behinderte Menschen erstmals auf die Straßen, um für ihre Rechte einzustehen und Selbstbestimmung zu verwirklichen. Nach dem Vorbild der Independent-Living-Bewegung der USA aus den 1960er und 1970er Jahren machten sie durch provokante Mittel öffentlich auch sich aufmerksam und kämpften gegen Diskriminierung und Bevormundung. Die autonome Behindertenbewegung strebte die politische Selbstvertretung und Selbstbestimmung an, „um so von (geschlechtslosen) Objekten der „Wohltäter“ zu Subjekten ihrer Leben zu werden“.
Inwieweit ihre Anliegen erfüllt und ihre Ziele umgesetzt wurden, wird im Folgenden erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Die Entwicklung der Bewegung
- Die Autonome Behindertenbewegung
- Die Behindertenbewegung nach 1981
- Ambulante Hilfsdienste und persönliche Assistenz
- Beratung
- Rechtliche Gleichstellung
- Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen heute
- Das Bundes-Teilhabe-Gesetz als Grundlage selbstbestimmten Lebens
- Wohnen
- Arbeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie sich die Chancen selbstbestimmten Lebens für Menschen mit Behinderung durch die Behindertenbewegung der 1970er und 1980er Jahre verändert haben. Sie analysiert den historischen Kontext, die Entwicklung der Bewegung und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in der heutigen Zeit.
- Entwicklung der Behindertenbewegung und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung
- Analyse der Ziele und Strategien der autonomen Behindertenbewegung
- Bewertung der aktuellen Situation: Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Lebensbereichen
- Untersuchung des Bundes-Teilhabe-Gesetzes und dessen Relevanz für die Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderung
- Reflexion der Herausforderungen und Möglichkeiten für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den zeitgeschichtlichen Kontext, in dem sich die Behindertenbewegung entwickelte. Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Kontext, indem es auf die vorherrschende Sichtweise auf Menschen mit Behinderung und die damaligen Lebensbedingungen eingeht. Die Kapitel drei und vier beschreiben die Entwicklung der Behindertenbewegung und die zentralen Anliegen der autonomen Behindertenbewegung. Das fünfte Kapitel analysiert die Entwicklungen in der Behindertenbewegung nach 1981 und beleuchtet die Bereiche ambulanter Hilfsdienste, Beratung und rechtliche Gleichstellung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Behindertenbewegung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Inklusion, Lebensbedingungen, historische Entwicklung, Ambulante Dienste, Rechtliche Gleichstellung, Bundes-Teilhabe-Gesetz, Menschen mit Behinderung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Behindertenbewegung der 1970er/80er Jahre?
Ziel war die politische Selbstvertretung und Selbstbestimmung, um von Objekten der Wohltätigkeit zu Subjekten des eigenen Lebens zu werden.
Was ist das „Independent Living“-Modell?
Ein aus den USA stammendes Konzept, das behinderten Menschen ermöglicht, durch persönliche Assistenz und ambulante Dienste ein eigenständiges Leben außerhalb von Heimen zu führen.
Welche rechtlichen Verbesserungen wurden erreicht?
Die Bewegung legte den Grundstein für die rechtliche Gleichstellung und moderne Gesetze wie das Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG).
Wie hat sich die Situation beim Wohnen verändert?
Früher wurden behinderte Menschen oft in Sondereinrichtungen isoliert; heute stehen Inklusion und die Wahlfreiheit des Wohnortes im Vordergrund.
Was bedeutete der Protest von 1980?
Behindertengruppen gingen erstmals massiv auf die Straße, um mit provokanten Mitteln gegen Diskriminierung und Bevormundung durch „Wohltäter“ zu kämpfen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Chancen selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen heute durch die Behindertenbewegung der 1970er und 1980er Jahre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423490